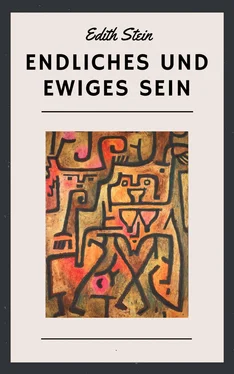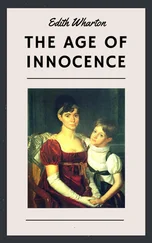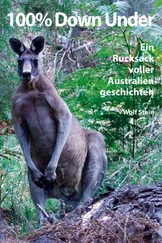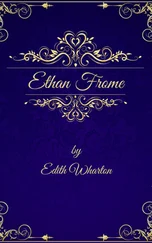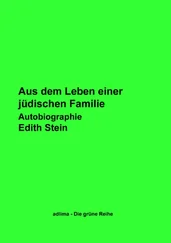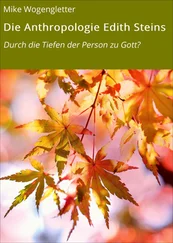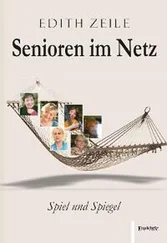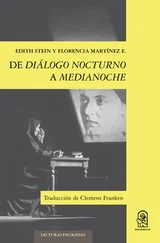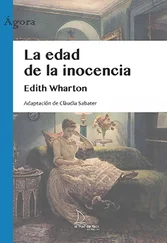1 ...6 7 8 10 11 12 ...30 Wir nehmen den Glauben auf das Zeugnis Gottes hin an und gewinnen dadurch Erkenntnisse, ohne einzusehen: wir können die Glaubenswahrheiten nicht als in sich selbst einleuchtend annehmen wie notwendige Vernunftwahrheiten oder auch wie Tatsachen der sinnlichen Wahrnehmung: wir können sie auch nicht nach logischen Gesetzen aus unmittelbar einleuchtenden Wahrheiten ableiten. Das ist der eine Grund, warum der Glaube ein »dunkles Licht« genannt wird. Es kommt aber hinzu, daß er als »credere Deum« und »credere in Deum« immer über alles hinausstrebt, was offenbarte Wahrheit ist, Wahrheit, von Gott in der Weise des menschlichen Erkennens in Begriffe und Urteile gefaßt, in Worten und Sätzen ausgedrückt. Er will mehr als einzelne Wahrheiten von Gott, er will Ihn selbst, der die Wahrheit ist, den ganzen Gott, und ergreift Ihn, ohne zu sehen: »obgleich's bei Nacht ist«. Das ist die tiefere Dunkelheit des Glaubens gegenüber der ewigen Klarheit, der er zustrebt. Von dieser doppelten Dunkelheit spricht unser hl. Vater Johannes vom Kreuz, wenn er sagt: »… das Vorwärtsschreiten des Verstandes ist ein Mehrsichbefestigen im Glauben; und so ist das Vorwärtsgehen ein Verfinstertwerden, da der Glaube Finsternis für den Verstand ist.« Dennoch ist es ein Vorwärtsschreiten: ein Hinausgehen über alle begrifflich faßbare Einzelerkenntnis hinein in das einfache Umfassen der Einen Wahrheit. Darum steht der Glaube der göttlichen Weisheit näher als alle philosophische und selbst theologische Wissenschaft. Weil uns aber das Gehen im Dunkeln schwer wird, darum ist jeder Strahl des Lichtes, das als ein Vorbote der künftigen Klarheit in unsere Nacht fällt, eine unschätzbare Hilfe, um an unserem Weg nicht irre zu werden. Und selbst das kleine Licht der natürlichen Vernunft vermag wertvolle Dienste zu leisten. Eine »Christliche Philosophie« wird es als ihre vornehmste Aufgabe ansehen, Wegbereiterin des Glaubens zu sein. Gerade darum war es dem hl. Thomas so sehr am Herzen gelegen, eine reine Philosophie auf Grund der natürlichen Vernunft aufzubauen: weil sich nur so ein Stück gemeinsamen Weges mit den Ungläubigen ergibt; wenn sie einwilligen, diese Strecke mit uns zu gehen, werden sie sich in der Folge vielleicht noch etwas weiter führen lassen, als es ihre ursprüngliche Absicht war. Vom Standpunkt der »Christlichen Philosophie« besteht also kein Bedenken gegen eine gemeinsame Arbeit. Sie kann in die Schule der Griechen und der Modernen gehen und nach dem Grundsatz: »Prüfet alles und das Beste behaltet« sich aneignen, was ihren Maßstäben standhält. Sie kann andererseits zur Verfügung stellen, was sie selbst zu geben hat, und den andern Nachprüfung und Auswahl überlassen. Es besteht für den Ungläubigen kein sachlicher Grund, gegen die Ergebnisse ihres natürlichen Verfahrens mißtrauisch zu sein, weil sie außer an den obersten Vernunftwahrheiten auch an der Glaubenswahrheit gemessen sind. Es bleibt ihm selbst unbenommen, den Maßstab der Vernunft in aller Strenge zu handhaben und alles abzulehnen, was ihm nicht genügt. Es steht ferner bei ihm, ob er weiter mitgehen und auch die Ergebnisse zur Kenntnis nehmen will, die mit Hilfe der Offenbarung gewonnen sind. Er wird die verwendeten Glaubenswahrheiten nicht als »Sätze« (Thesen) annehmen wie der Gläubige, sondern nur als »Ansätze« (Hypothesen). Aber ob die Folgerungen, die daraus gezogen werden, den Vernunftwahrheiten entsprechen oder nicht, dafür gibt es wieder auf beiden Seiten einen gemeinsamen Maßstab. Ob er dann die Zusammenschau, die sich für den gläubigen Philosophen aus natürlicher Vernunft und Offenbarung ergibt, mitvollziehen kann und ob er damit ein tieferes und umfassenderes Verständnis des Seienden gewinnen wird, das dürfte er ruhig abwarten. Wenn er so vorurteilsfrei ist, wie es nach seiner Überzeugung der Philosoph sein soll, so wird er vor dem Versuch jedenfalls nicht zurückschrecken.
II. Akt und Potenz als Seinsweisen
§ 1. Darstellung nach »De ente et essentia«
Die Lehre von Akt und Potenz war wie das Portal eines großen Gebäudes, das sich aus der Ferne in seiner ganzen Höhe zeigte. Schon dieser erste Blick aus der Ferne hat ein vorläufiges Verständnis dafür gegeben, daß mit diesem Begriffspaar der ganze Umfang des Seienden zu umspannen ist. Aber es ist auch schon durch eine kleine sprachliche Prüfung klar geworden, daß die Ausdrücke nicht eindeutig sind, sondern eine Mannigfaltigkeit des Sinnes umschließen. Diese Mannigfaltigkeit auseinanderzulegen und ihre innere Gesetzlichkeit zu ergründen, ist nun die Aufgabe.
Die erste Einführung in die Lehre von Akt und Potenz war dem Werke des Aquinaten entnommen, das sich am ausführlichsten mit diesen Fragen beschäftigt: den Quaestiones disputatae de potentia. Sie sind ein Werk des reifen Meisters, nach den Untersuchungen von Martin Grabmann zwischen 1265 und 1267 entstanden, etwa zur gleichen Zeit, in der er mit der Arbeit am I. Teil der Theologischen Summe, der Gotteslehre, beschäftigt war. Was in der »Summa«, die ein Lehrbuch der gesamten Theologie werden sollte, nur kurz berührt werden durfte, das konnte hier gründlich und ausführlich behandelt werden. So ist es zu verstehen, daß die Fragestellung in den Quaestiones disputatae de potentia eine vorwiegend theologische ist. Dadurch ist nicht ausgeschlossen – wie jeder Thomaskenner weiß –, daß aus ihnen eine Fülle rein philosophischer Belehrung zu gewinnen ist. Aber es ist nicht immer leicht, das philosophisch Belangvolle aus den theologischen Zusammenhängen herauszulösen. Und vor allem wird der Fernstehende, der sich über das Ineinandergreifen theologischer und philosophischer Fragen nicht klar ist, schwer die Besorgnis los, daß er sich auf einem für den Philosophen unerlaubten Boden befinde. Darum dürfte es gut sein, für die sachliche Behandlung jetzt nicht weiter den Gedanken jenes Werkes zu folgen, sondern auf das schon früher erwähnte Jugendwerk zurückzugreifen, in dem der hl. Thomas noch ganz als Schüler »des Philosophen« erscheint: das opusculum »De ente et essentia«. Freilich finden wir hier nur einen ersten Ansatz, der sich zu der ausgeführten Lehre wie ein Samenkorn zu einem großen Baum verhält. Aber gerade das kann uns vielleicht helfen, zu einem ursprünglichen sachlichen Verständnis vorzudringen.
Schon in diesem kleinen Grundriß einer Seinslehre betrachtet Thomas die Gesamtheit des Seienden als ein Stufenreich. Er unterscheidet drei Hauptstufen:
1. Stoffliche oder zusammengesetzte Dinge (aus Stoff und Form zusammengesetzte); das ist die Körperwelt – die »toten« Dinge und alle Lebewesen, der Mensch eingeschlossen.
2. Geistige oder einfache; dabei dachte Aristoteles an die Geister, durch die – nach seiner Auffassung – die Gestirne bewegt werden. Die mittelalterlichen Denker verstanden darunter die Engel. »Einfach« nannte Thomas sie, weil er sie für »reine Formen« ansah. (Die Frage, ob zum Aufbau der »reinen Geister« etwas Stoffliches nötig sei oder nicht, war zu seiner Zeit sehr umstritten.)
3. Das erste Seiende – Gott. Daß das erste Seiende, die Ursache alles anderen, völlig einfach, reines Sein, sei, darüber war man sich einig. Lehnte man nun – wie Thomas – für die geschaffenen Geister eine Zusammensetzung aus Stoff und Form ab, so mußte man ein anderes Mittel suchen, um sie von dem ersten Seienden zu unterscheiden. Thomas kommt in diesem Zusammenhang zu der Trennung von Form und Sein bei den geschaffenen Geistern. (»Form« ist bei ihnen gleichbedeutend mit »Wesen« – »essentia«). »… das Geistwesen (intelligentia) ist Form und Sein und hat sein Sein von dem ersten Seienden, das nur Sein ist, und das ist die erste Ursache, die Gott ist. Alles aber, was etwas von einem anderen empfängt, ist im Verhältnis dazu in Potenz, und das, was in ihm aufgenommen ist, ist sein Akt. Also muß die Washeit oder Form selbst, die das Geistwesen ist, im Verhältnis zu dem Sein, das es von Gott empfängt, in Potenz sein, und jenes empfangene Sein ist in der Weise des Aktes. Und so findet sich Potenz und Akt in den Geistwesen, jedoch nicht Form und Stoff … Und weil die Washeit (quidditas) des Geistwesens das Geistwesen selbst ist, darum ist seine Washeit oder sein Wesen (essentia) eben das, was es selbst ist, und sein Sein, das es von Gott empfangen hat, ist das, wodurch es in der wirklichen Welt ein selbständiges Sein hat (quo substitit in rerum natura) …« »Und da in den Geistwesen Potenz und Akt angenommen wird, kann unschwer eine Vielzahl von Geistwesen gefunden werden; das wäre unmöglich, wenn keine Potenz in ihnen wäre … Es gibt also zwischen ihnen einen Unterschied nach dem Grade von Potenz und Akt, so daß das höhere, dem ersten Sein näherstehende, mehr Aktualität und weniger Potenzialität in sich hat, und entsprechend die anderen.«
Читать дальше