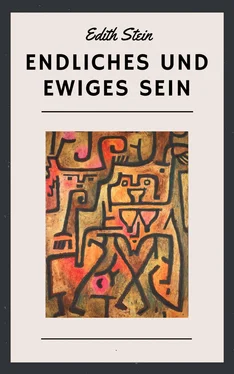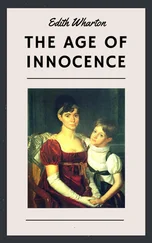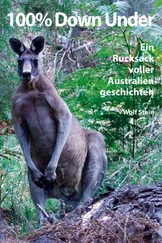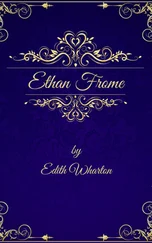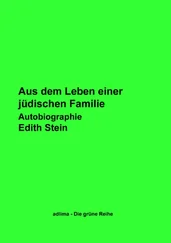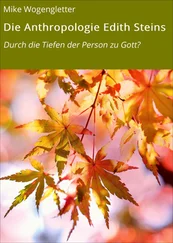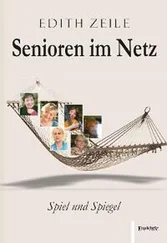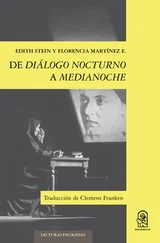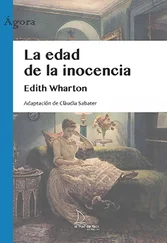Edith Stein - Edith Stein - Endliches und ewiges Sein
Здесь есть возможность читать онлайн «Edith Stein - Edith Stein - Endliches und ewiges Sein» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Edith Stein: Endliches und ewiges Sein
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Edith Stein: Endliches und ewiges Sein: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Edith Stein: Endliches und ewiges Sein»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Edith Stein (1891 – 1942) gilt als Brückenbauerin zwischen Glaubensrichtungen und Wertesystemen. Ihr Werk «Endliches und ewiges Sein» erschien erstmals 1937.
Edith Stein: Endliches und ewiges Sein — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Edith Stein: Endliches und ewiges Sein», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Jacques Maritain weist in seiner Darstellung der thomistischen Lösung darauf hin, daß es für die Frage nach Sinn und Möglichkeit einer »christlichen Philosophie« wichtig sei, zwischen »Natur« und »Zustand« der Philosophie zu unterscheiden. Ihrer Natur nach sei die Philosophie von Glauben und Theologie völlig unabhängig. Aber die Natur verwirklicht sich jeweils unter bestimmten geschichtlichen Bedingungen. Und mit Rücksicht auf ihre Verwirklichung könne man von einem christlichen Zustand der Philosophie sprechen. Um klarzumachen, was er unter der »Natur der Philosophie« – d. h. unter dem, »was sie in sich selbst ist« – versteht, weist er darauf hin, daß »nach dem heiligen Thomas von Aquin die Substanzen in absoluter Weise und durch sich selber in ihrem besonderen, ihrem eigentümlichen Wesen bestimmt sind, die Betätigungsmöglichkeiten der Substanzen hingegen … durch die den Substanzen wesensmäßig entsprechenden Akte und diese wiederum durch die den Akten zugeordneten Objekte. Wenn sich nun in uns jene bestimmte Ausprägung und auf Entfaltung hindrängende Gestaltung des Geistes ausbildet, die den Namen Philosophie trägt, so bezieht sie sich – wie jegliches Erkennen, Forschen und Urteilen – mit Wesensnotwendigkeit auf etwas Gegenständliches, sie läßt den Verstand auf die Natur dieses Gegenständlichen eingehen, und sie empfängt ihre besondere Charakterisierung durch nichts als durch dieses Gegenständliche. So ist also die Philosophie einzig und allein von ihrem Gegenstand her in ihrer Eigenart bestimmt. Das Gegenständliche, dem sie sich auf Grund ihres Wesens zuwendet (keineswegs etwa das Subjekt, in welchem sie Wohnung nimmt), ist das bestimmende Moment für ihre Natur«. Wir möchten in der Klärungsarbeit noch etwas weiter gehen. Die Philosophie wird hier als eine »Ausprägung und … Gestaltung des Geistes« in Anspruch genommen, als eine Art des »Erkennens, Forschens und Urteilens«, darum auf etwas Gegenständliches bezogen und »durch nichts als durch dieses Gegenständliche« seiner Art nach gekennzeichnet. Eine Ausprägung des Geistes: das ist eine Festlegung in einer bestimmten Richtung, auf eine bestimmte Betätigungsmöglichkeit (die Formung der »Potenz« zum »Habitus«). Wenn man von »Erkennen, Forschen, Urteilen« spricht, denkt man aber weniger an eine dauernde Geisteshaltung als an den entsprechenden »Akt«, die lebendige Betätigung. Unter Philosophie kann man beides verstehen: das lebendige Philosophieren und die dauernde Geisteshaltung. (Der Philosoph ist auch Philosoph in den Augenblicken, in denen er nicht philosophiert.) Darüber hinaus aber noch ein Drittes – und ich möchte sogar sagen, dies Dritte in erster Linie: Philosophie als Wissenschaft. Das lateinische Wort ›scientia‹ bedeutet zugleich »Wissen« (und dies sowohl als »Habitus« wie als »Akt«) und »Wissenschaft«. Und der theologische Sprachgebrauch verwendet auch den Ausdruck »Wissenschaft« im Sinne von »Wissen« (so, wenn von der Wissenschaft als einer Gabe des Heiligen Geistes gesprochen wird). Die moderne Logik und Wissenschaftstheorie aber versteht unter Wissenschaft ein gedankliches Gebilde, das ein von den einzelnen denkenden Geistern unabhängiges Dasein hat, ein innerlich zusammenhängendes, nach bestimmten Gesetzen geordnetes Gebäude von Begriffen, Urteilen, Beweisen. Das, was eine Wissenschaft zu einem innerlich einheitlichen und zusammenhängenden Ganzen macht und von anderen abgrenzt, ist ihre Bezogenheit auf ein bestimmtes Gegenstandsgebiet und die Bedingtheit durch dieses Gebiet, das ihrem ganzen Verfahren die Regel vorschreibt. Wenn Wissenschaft als Gebilde zu fassen ist, das nicht von einem einzelnen denkenden Geist abhängig und an ihn gebunden ist, so setzt sie doch das Gegenüber eines Seienden und erkennender Geister – sogar bestimmt gearteter, nämlich in schrittweisem Vorgehen erkennender Geister – voraus. Fassen wir Wissenschaft in diesem Sinn, so bleibt dem Wort immer noch ein Doppelsinn, der dem Unterschied von »Natur« und »Zustand« entspricht. Es kann einmal darunter das verstanden werden, was jeweils als geschichtliche Tatsache vorliegt, z. B. die Mathematik in ihrem gegenwärtigen Stande. Von ihr gilt, was Husserl sagt: »Objektiven Bestand hat die Wissenschaft nur in ihrer Literatur, nur in der Form von Schriftwerken hat sie ein eigenes, wenn auch zu dem Menschen und seinen intellektuellen Betätigungen beziehungsreiches Dasein; in dieser Form pflanzt sie sich durch die Jahrtausende fort und überdauert die Individuen, Generationen und Nationen. Sie repräsentiert so eine Summe äußerer Veranstaltungen, die, wie sie aus Wissensakten vieler Einzelner hervorgegangen sind, wieder in eben solche Akte ungezählter Individuen übergehen können …« Etwas vorher heißt es: »Wissenschaft geht, wie der Name besagt, auf Wissen.« Und bald danach: »Im Wissen aber besitzen wir die Wahrheit.« Die Wissenschaft in ihrem jeweiligen Zustand ist der Niederschlag alles dessen, was der Menschengeist zur Erforschung der Wahrheit getan hat, in Gebilden, die sich von dem forschenden Geist abgelöst haben und die nun ein eigenes Dasein führen. Was daran sinnenfällig ist, das ist Ausdruck eines Sinnes, der verstanden werden will. Die Wissenschaft in ihrem jeweiligen Zustand ist immer ein Bruchstück; und es gehören dazu auch alle Irrtümer, Umwege und Entstellungen der Wahrheit, denen der Menschengeist bei seinen Bemühungen verfallen ist.
Davon zu unterscheiden ist die Wissenschaft, wie sie ihrer »Natur« nach ist, oder (wie ich lieber sagen möchte) die Wissenschaft als Idee. Wir können uns denken, daß ein Sachgebiet vollständig erforscht wäre (obgleich wir wissen, daß der menschliche Geist in seinem irdischen Bemühen tatsächlich niemals diese Vollendung erreichen wird), daß alles, was sich überhaupt darüber aussagen läßt, in Form wahrer Sätze vorläge und daß all diese Sätze in dem sachgemäß geforderten Begründungszusammenhang stünden oder – was dasselbe besagt – die Einheit einer »geschlossenen Theorie« bildeten. Das wäre eine Wissenschaft in idealer Vollendung, »ohne Makel und Runzel« {{Eph 5, 27}}. Für unsere Erfahrung als geschichtliches Gebilde wird es so etwas niemals geben: es ist das Leitbild, dem wir uns mit all unserem Forschen und Mühen zu nähern suchen. Es ist aber darüber hinaus zu fragen, wieweit ein solches Leitbild sinnvoll sei: ob es überhaupt ein Sachgebiet gebe, das sich durch eine Wissenschaft »ausschöpfen« lasse, ob es für alle Sachgebiete in Betracht komme oder nur für bestimmt geartete. Um diese Fragestellung verständlich zu machen, müssen wir (wiederum späteren ausführlichen Erörterungen vorgreifend) kurz überlegen, was denn wohl unter der »Wahrheit« zu verstehen sei, die wir im Wissen besitzen. Ich weiß, daß in unserem Garten jetzt die Kirschen blühen. Der Satz »Die Kirschen blühen …« ist wahr. Die Kirschen blühen »in Wahrheit«. Der Satz als sprachliches Gebilde ist Ausdruck eines Sinnes, den ich mit meinem Wissen umfasse; er baut sich aus einer Reihe von verständlichen Ausdrücken auf. Daß ich diesen Sinn wissend umfasse (und nicht etwa bloß meinend), besagt, daß der Satz nicht bloß Ausdruck eines verständlichen Sinnes ist, sondern daß er »wahr« ist oder daß ihm etwas »in Wahrheit« entspricht. »Wahr« bedeutet in diesen beiden Wendungen nicht ganz dasselbe, aber die beiden Bedeutungen stehen in einem inneren Zusammenhang. Wenn man – wie es sprachüblich ist – von »Wahrheiten« spricht, so meint man damit »wahre Sätze«. Das ist eine ungenaue Ausdrucksweise. Der Satz ist nicht »eine Wahrheit« (veritas), sondern »ein Wahres« (verum). Seine Wahrheit (im strengen Sinn) besteht darin, daß er mit einem Seienden in Übereinstimmung ist oder daß ihm etwas entspricht, was unabhängig von ihm besteht. Der Wahrheit des Satzes liegt das wahre – d. h. das in sich begründete und den Satz begründende – Sein zugrunde. Das wahre Sein ist es, worauf alle Wissenschaft abzielt. Es liegt aller Wissenschaft voraus, nicht nur der menschlichen Wissenschaft als einer Veranstaltung zur Gewinnung von richtigem Wissen und damit zugleich von wahren Sätzen und als des greifbaren Niederschlages aller dahinzielenden Bemühungen, sondern selbst noch der Wissenschaft als Idee. Der Satz beschäftigt sich mit einem Gegenstand, von dem er etwas aussagt und den wir den »Satz-Gegenstand« nennen. Was aber der Satz, seinem eigentlichen Abzielen nach, »setzt« oder behauptet, ist nicht dieser Gegenstand (in unserem Beispiel: »die Kirschen«), auch nicht das, was er von dem Gegenstand aussagt (»blühen«), sondern der ganze »bestehende Sachverhalt« (»Die Kirschen blühen …«). Sätze sind Ausdruck bestehender Sachverhalte und haben in ihnen ihre Seinsgrundlage. Die Sachverhalte wiederum sind nicht in sich selbst begründet, sondern haben ihre Seinsgrundlage in »Gegenständen« (in einem besonderen Sinne des Wortes). Jedem Gegenstand gehört ein Bereich von Sachverhalten zu, in denen sich sein innerer Aufbau und die Beziehungen, in denen er vermöge seinem Standort im Zusammenhang des Seienden sich befindet, auseinanderlegen. Jedem Sachverhalt wiederum gehört ein Bereich von Sätzen zu, in denen er Ausdruck finden kann. (Daß es für denselben Sachverhalt eine Mannigfaltigkeit von Ausdrucksmöglichkeiten gibt, das liegt an der Sinnfülle der einzelnen Sachverhaltsglieder.) Schon die Sachverhalte sind mit ihrer Gliederung bezogen auf die mögliche Erkenntnis schrittweise vorgehender Geister. Das ist aber nicht so zu verstehen, als würden sie vom erkennenden Geist »erzeugt«: vielmehr schreiben sie ihm die Regel seines Verfahrens vor. In den Sachverhalten sind auch die Sätze als Ausdrucksmöglichkeiten schon begründet, und in dieser Weise »gibt es« sie, ehe sie von einem Menschengeist gedacht und in den »Stoff« einer menschlichen Sprache, in Laute oder Schriftzeichen, hineingeformt werden. Unter der »Wissenschaft als Idee«, die aller menschlichen Wissenschaft zugrunde liegt, ist also der »reine« (gleichsam noch körperlose) Ausdruck aller Sachverhalte zu verstehen, in denen sich das Seiende gemäß seiner eigenen Ordnung auseinanderlegt. Es ist aber nun die Frage, ob »alle Sachverhalte«, die dem Seienden entsprechen würden, und schon der Bereich von Sachverhalten, die einem einzelnen Gegenstand entsprechen, als ein abschließbares Ganzes zu denken sind, das seinen Gegenstand erschöpfen würde. Es kann hier dahingestellt bleiben, wie es sich damit bei den Sachgebieten verhalten mag, die von den »exakten« Wissenschaften behandelt werden. Jedenfalls ist sie zu verneinen für die wirkliche Welt in ihrer Fülle, die für eine zergliedernde Erkenntnis unausschöpfbar ist. Und wenn es so ist, dann ist jede »Wirklichkeitswissenschaft« (als Wissenschaft von der vollen Wirklichkeit) schon ihrer Idee nach etwas, was niemals zum Abschluß kommen wird.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Edith Stein: Endliches und ewiges Sein»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Edith Stein: Endliches und ewiges Sein» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Edith Stein: Endliches und ewiges Sein» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.