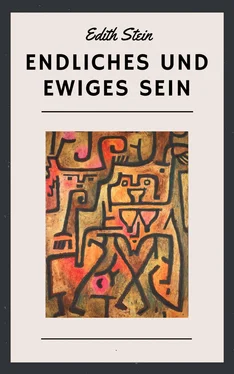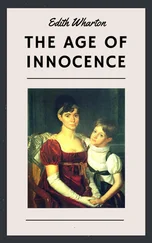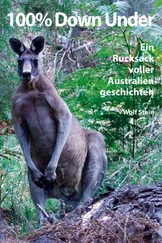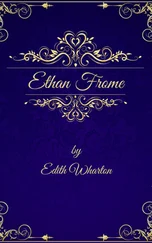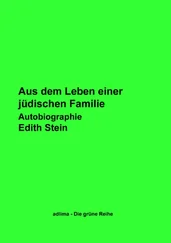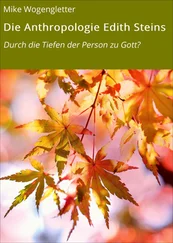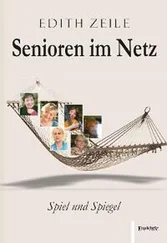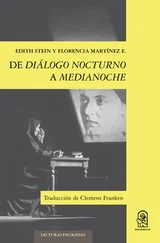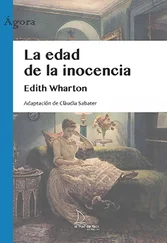Denn das ist die andere Seite der Sache: etwa zur selben Zeit, in der die »christliche Philosophie« aus ihrem Dornröschenschlaf erwachte, machte die »moderne Philosophie« die Entdeckung, daß es auf dem Wege, den sie seit etwa drei Jahrhunderten verfolgte, nicht mehr weiterging. Aus dem Versanden im Materialismus suchte sie zunächst Rettung durch die Rückkehr zu Kant, aber das reichte nicht aus. Der Neukantianismus verschiedener Prägung wurde abgelöst durch die Richtungen, die wieder dem Seienden zugewandt waren. Sie brachten den verachteten alten Namen Ontologie (Seinslehre) wieder zu Ehren. Sie kam zuerst als Wesensphilosophie (die Phänomenologie Husserls und Schelers); dann stellte sich ihr die Existenzphilosophie Heideggers zur Seite und Hedwig Conrad-Martius' Seinslehre als deren Gegenpol. Die wiedergeborene Philosophie des Mittelalters und die neugeborene Philosophie des 20. Jahrhunderts – können sie sich in einem Strombett der philosophia perennis zusammenfinden? Noch sprechen sie verschiedene Sprachen, und es wird erst eine Sprache gefunden werden müssen, in der sie sich verständigen können.
§ 3. Schwierigkeiten des sprachlichen Ausdruckes
Damit ist ein Punkt berührt, der für den Philosophen der Gegenwart ein wahres Kreuz bedeutet. Wir leben wirklich in einer babylonischen Sprachverwirrung. Man kann kaum einen Ausdruck gebrauchen, ohne fürchten zu müssen, daß der andere etwas ganz anderes darunter versteht, als man selbst meint. Die meisten »Fachausdrücke« sind mehrfach geschichtlich belastet. Ich habe in den kurzen vorbereitenden Ausführungen absichtlich den hl. Thomas in seiner Sprache reden lassen und die Namen »Potenz« und »Akt« nicht übertragen. Es ist nicht meine Absicht, dabei stehen zu bleiben. Es sind seit einigen Jahren in Deutschland Bestrebungen am Werk, der Philosophie eine eigene – deutsche – Sprache zu schaffen. Die mittelhochdeutschen Schriften der großen Mystiker bilden eine wertvolle Grundlage. Ein kühner Vorstoß in dieser Richtung ist die deutsche Ausgabe der Summa theologica des hl. Thomas von Joseph Bernhart. Die Summa-Übersetzung des Katholischen Akademikerverbandes strebt dasselbe, nur in viel gemäßigterer Form an. Diese Versuche zeigen aber zugleich die Gefahren einer solchen Verdeutschung. Wer sich im Übersetzen aus fremden Sprachen versucht hat, weiß, wieviel Unübersetzbares es gibt – obgleich andererseits die Möglichkeit viel weiter geht als das, womit man sich vielfach zufrieden gibt –, und wer darüber nachgedacht hat, was die Sprache und was Sprachen sind, der weiß auch, daß es gar nicht anders sein kann. Die Sprachen wachsen aus dem Geist der Völker hervor als Niederschlag und Ausdrucksform ihres Lebens, die Mannigfaltigkeit und die Eigenart der Völker muß sich darin spiegeln. Die Griechen, die ein philosophisches Volk waren, hatten sich auch eine philosophische Sprache geschaffen. Wo aber sollten die Römer eine philosophische Sprache hernehmen? Sie holten sich ihre Philosophie auf den griechischen Universitäten, von ihren griechischen Gästen oder Sklaven und waren wohl noch am besten daran, solange sie griechisch lasen und schrieben. Sobald sie aber daran gingen, eine römische Literatur zu schaffen, mußten sie sich bitter plagen, um ihrer Sprache das abzunötigen, was ihr fehlte. Seneca schreibt darüber an Lucilius: »Du wirst die römische Beschränktheit noch mehr verurteilen, wenn Du erfährst, daß es eine einzelne Silbe gibt, die ich nicht übersetzen kann. Du fragst, welche das sei: ὄν (das Seiende). Ich komme Dir schwerfällig vor: es liegt nahe zu übersetzen: ›Quod est‹ (was ist). Doch ich sehe einen erheblichen Unterschied zwischen beiden: ich muß einen zusammengesetzten Ausdruck für ein einzelnes Wort (verbum pro vocabulo) setzen; wenn es aber nicht zu umgehen ist, werde ich ›Quod est‹ setzen.« Auf die Bildung »ens« (Seiendes) ist Seneca noch nicht verfallen. (Boëthius verwendet sie bereits, wenn er auch meist noch »quod est« sagt.) Sie wäre ihm wohl auch gar zu barbarisch erschienen. Schon den Ausdruck »essentia« (Wesen) wagte er einem Mann von Geschmack nicht ohne weiteres zuzumuten. Er schickt eine bewegliche Klage über die Armut der lateinischen Sprache voraus und fährt dann fort: »›Was soll diese lange Einleitung?‹ fragst Du. ›Worauf läuft sie hinaus?‹ Ich will es Dir nicht verheimlichen: ich möchte, daß Du, wenn möglich, mit gnädigen Ohren den Ausdruck ›essentia‹ anhörst; sonst werde ich ihn auch vor ungnädigen aussprechen … Was soll man für οὐσία sagen – das notwendige Ding, die Natur, die die Grundlage für alles in sich enthält? Ich bitte Dich also, erlaube mir, dies Wort zu gebrauchen. Indessen will ich mir Mühe geben, von dem zugestandenen Recht den sparsamsten Gebrauch zu machen: vielleicht werde ich mich sogar mit der Erlaubnis begnügen.«
Sehen wir hier nicht wie in einem klaren Spiegel die Schwierigkeiten, mit denen wir selbst zu kämpfen haben? Freilich über Armut der deutschen Sprache haben wir uns nicht zu beklagen. Darin sind wir dem Griechischen gegenüber weit besser daran als die Römer. Unsere Schwierigkeit im Verhältnis zur lateinischen Sprache ist die entgegengesetzte: es ist von vornherein aussichtslos, ihre vieles umspannenden Ausdrücke mit je einem deutschen Wort wiedergeben zu wollen. Man wird immer nur eine Seite der Sache treffen und in manchen Zusammenhängen zu bedenklichen Sinnentstellungen kommen. Was tun? Natürlich von dem Reichtum unserer Sprache Gebrauch machen und, so weit nötig und möglich, an verschiedenen Stellen verschiedene Ausdrücke setzen, die den verschiedenen Bedeutungszusammenhängen gerecht werden. Aber das hat auch seine Gefahren. Es wird einmal nur einem Übersetzer möglich sein, der nicht nur die Sprachen – die eigene Muttersprache und die fremde – sicher beherrscht, sondern auch in der Gedankenwelt des betreffenden Werkes und seines Verfassers zu Hause ist und überdies selbst in unmittelbarer Fühlung mit den sachlichen Fragen lebt, um die es geht. Welcher Übersetzer wird sich aber all das zutrauen? Um nicht in die Gefahr zu kommen, seine eigenen persönlichen Einfälle statt der wahren Meinung des Verfassers darzubieten, wird er in vielen Fällen auf den lateinischen Ausdruck zurückgreifen müssen. Mitunter ist es auch darum nötig, weil wir trotz des größeren Reichtums der deutschen Sprache doch für manche Begriffe keinen ganz entsprechenden Ausdruck haben. Der wichtigste Grund aber, der mir einen völligen Verzicht auf die lateinischen Fachausdrücke unmöglich erscheinen läßt, ist noch ein anderer. Die Wortkargheit des Lateinischen ist nicht Armut schlechthin, es liegt darin auch eine Stärke. Wenn das Griechische mit der Freiheit und Leichtigkeit seiner Ausdrucksmöglichkeiten die Sprache der lebendigen Denkbewegung ist, so ist das Lateinische mit seiner strengen Gesetzlichkeit und herben Knappheit berufen zur Formung scharf geprägter Ausdrücke für zusammenfassende Ergebnisse. Die Mannigfaltigkeit der Bedeutungen, die durch ein lateinisches Wort ausgedrückt werden, ist keine beliebige, sondern eine geordnete, sinnmäßig zusammenhängende. Diese für die sachlichen Zusammenhänge, für die Ordnung des Seienden überaus aufschlußreichen Sinneinheiten geben wir preis, wenn wir uns der lateinischen »Terminologie« einfach entledigen. Wir verzichten auf das reife Ergebnis einer jahrhundertelangen Gedankenarbeit und eines Volksgeistes, der mit seiner Eigenart – wie jeder Volksgeist – zu besonderer Leistung für die ganze Menschheit berufen war. Wer wollte sich vermessen, mit leichter Hand etwas anderes an die Stelle zu setzen?
Also: das eine tun und das andere nicht lassen. Was sich in deutschen Worten sagen läßt: dafür eigene, möglichst angemessene Ausdrücke suchen, aber das feste Grundgerüst der überlieferten Schulsprache beibehalten und durchblicken lassen, es zur Richtschnur nehmen und darauf zurückgreifen, so oft die Gefahr einer Sinnesverfälschung oder bedenklicher Einseitigkeit droht. (Man muß nämlich auch erwägen, daß das Bedeutungsganze, dem eine Teilbedeutung entnommen ist, ihr eine Färbung verleiht, die bei der Absonderung leicht verloren geht.)
Читать дальше