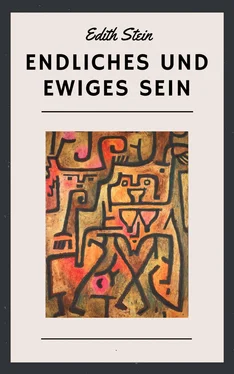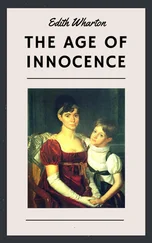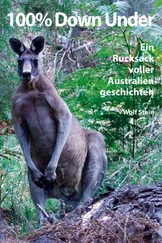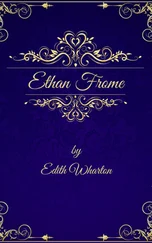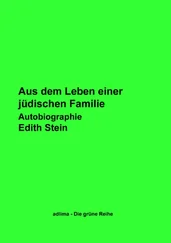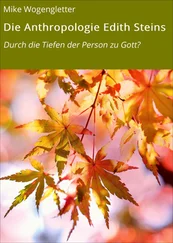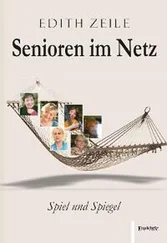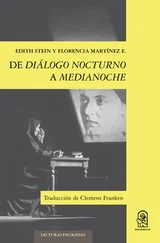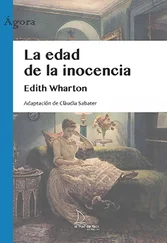1 ...7 8 9 11 12 13 ...30 Der kleine Ausschnitt zeigt deutlich, wie eng in der Seinslehre des hl. Thomas die Begriffe »Akt« und »Potenz« mit einer Reihe von anderen aristotelischen Grundbegriffen – Form, Stoff, Substanz (= das, was »subsistiert«) usw. – zusammenhängen. Es wird daher in der Folge notwendig sein, auch auf sie einzugehen. Aber sich hier auf sie zu stützen, hieße eine Unbekannte durch andere erklären wollen. Es soll also aus der angeführten Stelle vorläufig nur das herausgelöst werden, was sich ohne Erörterung jener Begriffe zum Verständnis der Ausdrücke »Akt« und »Potenz« daraus entnehmen läßt.
Es ist bei den reinen Geistern das, was sie sind, von ihrem Sein unterschieden worden, und das Sein ist als ihr Akt bezeichnet worden. Das stimmt zusammen mit der Auffassung des ersten Seienden, das sowohl reines Sein als reiner Akt genannt wurde. Andererseits wurde gesagt, das, was das Sein empfange, sei »in Potenz« im Verhältnis zu dem Sein, das es empfange. Folgen wir dem Wortsinn von »potentia« (oder δύναμιϚ), das »Können« oder »Vermögen« besagt, so ist das »in potentia esse« ein »im Vermögen« oder »in der Möglichkeit sein« oder ein »Sein-Können«. Das, was »sein kann«, hat – wie es hier dargestellt wurde – nicht von sich aus die »Macht«, zum Sein überzugehen. Andererseits besagt sein »Sein-Können« mehr als: es sei nichts darin, was das Hinzutreten des Seins ausschließe. Vielmehr steckt in dem »in der Möglichkeit sein« schon ein Sein in doppeltem Sinne darin: einmal eine Hinordnung oder ein Hingerichtetsein auf das Sein, das als Akt angesprochen wurde. Sodann aber schon eine gewisse Art des Seins. Denn »möglich sein« heißt ja nicht einfach »nicht sein«. Wäre es nicht so, daß schon das mögliche Sein selbst eine Art des Seins wäre, so hätte es keinen Sinn, von »Graden« der »Potenzialität« zu sprechen. Wenn man nur einen, überall gleichen Sinn von »Sein« annehmen dürfte und wenn Akt und Sein schlechthin zusammenfielen, dann wäre es auch unmöglich, zu sagen, daß es etwas gebe, was mehr oder minder Akt wäre und dem ersten Sein entsprechend näher oder ferner stünde. So kommen wir dazu, Abstufungen des Seins zu unterscheiden und Akt und Potenz als Weisen des Seins zu verstehen. Der Übergang von der Potenz zum Akt oder – wie wir jetzt sagen können – vom möglichen zum wirklichen Sein ist ein Übergang von einer Seinsweise zur anderen, und zwar von einer niederen zu einer höheren. Aber auch innerhalb des möglichen und des wirklichen Seins gibt es noch Abstufungen. So wird erst die Rede von einem »reinen Akt« verständlich, und es wird klar, daß der reine Akt das höchste Sein bezeichnen muß. Aus den früheren Erwägungen ging schon hervor, daß damit der Sinn der Ausdrücke »Akt« und »Potenz« nicht erschöpft ist. Aber vorläufig wollen wir bei der gewonnenen Bedeutung stehen bleiben.
Was wir bisher erreicht haben, ist ein gewisses Verständnis der Worte. Wir verbinden jetzt mit ihnen einen bestimmt umrissenen Sinn. Haben wir aber auch schon ein ausreichendes sachliches Verständnis? Wenn der Blinde von Rot und Blau und Grün reden hört, so sind das für ihn keine sinnlosen Worte, er weiß, daß damit verschiedene Farben gemeint sind, aber er kennt die Farben nicht. Wissen wir von Akt und Potenz jetzt mehr als der Blinde von den Farben? Ein wenig wohl. Der Unterschied von Möglichkeit und Wirklichkeit ist ziemlich deutlich. Die feineren Abstufungen allerdings bereiten vielleicht schon Schwierigkeiten; und alles in allem befinden wir uns doch noch in einer großen Entfernung von dem, was mit Akt und Potenz als Stufen oder Weisen des Seins gemeint ist. Gibt es einen Weg zu größerer Sachnähe?
§ 2. Die Tatsache des eigenen Seins als Ausgangspunkt der sachlichen Untersuchung
Wem mittelalterliches Denken fremd ist, dem mögen die Gegenstände, die der hl. Thomas zur Untersuchung des Seins heranzieht, unerreichbar fern erscheinen: Gott und die Engel – was wissen wir von ihnen und woher? »… Cherubim und Seraphim: … wie Abwesende glauben wir sie, gemäß dem Wort, das uns von gewissen himmlischen Gewalten kündet.« Aber es gibt etwas, das uns ganz anders nahe ist, ja unentrinnbar nahe. So oft der Menschengeist bei seinem Forschen nach der Wahrheit nach einem unbezweifelbar gewissen Ausgangspunkt gesucht hat, ist er auf dieses unentrinnbar Nahe gestoßen: die Tatsache des eigenen Seins. »… wieviel von allem, was wir wissen, bleibt, das wir so wissen, wie wir wissen, daß wir leben? In diesem Wissen fürchten wir gar nicht, durch irgendeinen Wahrheitsanschein getäuscht zu werden, da doch gewiß ist, daß auch, wer sich täuscht, lebt.« Wir sind hier aller Sinnestäuschungen enthoben. »… denn hier sieht man ja nicht mit den Augen des Fleisches. Innerlichstes Wissen ist es, darin wir um unser Leben wissen, und da kann auch kein Zweifler sagen: vielleicht schläfst du und weißt es nicht … Wer gewiß ist im Wissen um sein Leben, sagt hierin nicht: ich weiß, daß ich wache, sondern: ich weiß, daß ich lebe – ob er schläft oder wacht: er lebt.«
Als Descartes in seinen »Meditationes de prima philosophia« es unternahm, die Philosophie als eine zuverlässige Wissenschaft auf einem unbezweifelbar gewissen Grunde neu aufzubauen, da begann er mit dem bekannten allgemeinen Zweifelsversuch. Er schaltete alles aus, was sich – als der Täuschung unterworfen – bezweifeln läßt. Es blieb ihm als unstreichbarer Rest die Tatsache des Zweifelns und – allgemein gefaßt – des Denkens selbst, und in dem Denken das Sein: cogito, sum. In verwandter Weise hat Edmund Husserl bei seinen Bemühungen um die Begründung der phänomenologischen Methode Urteilsenthaltung (ἐποχή) gegenüber all dem verlangt, was wir in »natürlicher Einstellung«, als in der Welt unserer Erfahrung lebende Menschen, unbefangen gläubig einfach hinnehmen, gegenüber der gesamten Existenz der natürlichen Welt und der Geltung der bestehenden Wissenschaft. Was als Feld der Untersuchung übrig bleibt, ist das Feld des Bewußtseins im Sinne des Ichlebens: ich kann es dahingestellt sein lassen, ob das Ding, das ich mit meinen Sinnen wahrnehme, wirklich existiert oder nicht – aber die Wahrnehmung als solche läßt sich nicht durchstreichen; ich kann bezweifeln, ob die Schlußfolgerung, die ich ziehe, richtig ist – aber das schlußfolgernde Denken ist eine unbezweifelbare Tatsache; und so all mein Wünschen und Wollen, mein Träumen und Hoffen, mein Freuen und Trauern – kurz alles, worin ich lebe und bin, was sich als das Sein des sein{{er}} selbst bewußten Ich selbst gibt. Denn überall – in dem »Leben« Augustins, in dem »ich denke« Descartes', im »Bewußt-sein« oder »Erleben« Husserls –, überall steckt ja ein »ich bin«. Es wird nicht daraus erschlossen, wie es die Formel »cogito, ergo sum« anzudeuten scheint, sondern es liegt unmittelbar darin: denkend, fühlend, wollend oder wie immer geistig mich regend, bin ich und bin dieses Seins inne. Diese Gewißheit des eigenen Seins ist – in einem gewissen Sinne – die ursprünglichste Erkenntnis: nicht die zeitlich erste, denn die »natürliche Einstellung« des Menschen ist vor allem anderen der äußeren Welt zugewandt, und es braucht lange, bis er sich einmal selbst findet; auch nicht im Sinne eines Grundsatzes, aus dem sich alle anderen Wahrheiten logisch ableiten ließen oder auf dem, wie an einem Maßstab, alle anderen zu messen wären; sondern im Sinne des mir Nächsten, von mir Unabtrennbaren und damit eines Ausgangspunktes, hinter den nicht weiter zurückgegangen werden kann. Diese Seinsgewißheit ist eine »unreflektierte« Gewißheit, d. h. sie liegt vor allem »rückgewandten« Denken, mit dem der Geist aus der ursprünglichen Haltung seines den Gegenständen zugewandten Lebens heraustritt, um auf sich selbst hinzublicken. Versenkt sich aber der Geist in solcher Rückwendung in die einfache Tatsache seines Seins, so wird sie ihm zu einer dreifachen Frage: Was ist das Sein, dessen ich inne bin? Was ist das Ich, das seines Seins inne ist? Was ist die geistige Regung, in der ich bin und mir meiner und ihrer bewußt bin? Wende ich mich dem Sein zu, so zeigt es, wie es in sich ist, ein Doppelgesicht: das des Seins und des Nichtseins. Das »Ich bin« hält dem Blick nicht stand. Das »worin ich bin« ist jeweils ein anderes, und da das Sein und die geistige Regung nicht getrennt sind, da ich »darin« bin, ist auch das Sein ein jeweils anderes; das Sein von »vorhin« ist vergangen und hat dem Sein von »jetzt« Platz gemacht. Das Sein, dessen ich als meines Seins inne bin, ist von Zeitlichkeit nicht zu trennen. Es ist, als »aktuelles« Sein – d. h. als gegenwärtig-wirkliches – punktuell: ein »Jetzt« zwischen einem »Nicht mehr« und einem »Noch nicht«. Aber indem es sich in seinem fließenden Charakter in Sein und Nichtsein spaltet, enthüllt sich uns die Idee des reinen Seins, das nichts von Nichtsein in sich hat, bei dem es kein »Nicht mehr« und kein »Noch nicht« gibt, das nicht zeitlich ist, sondern ewig.
Читать дальше