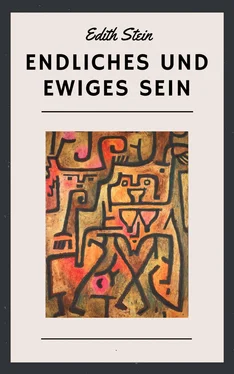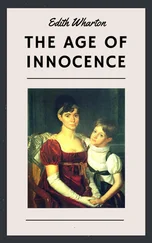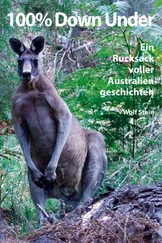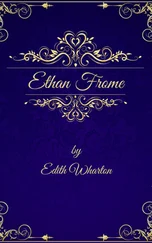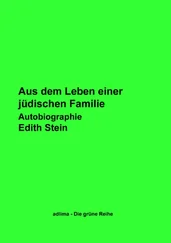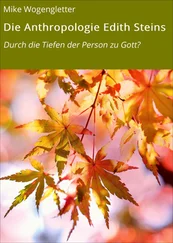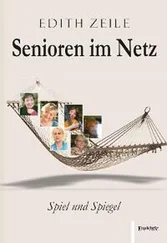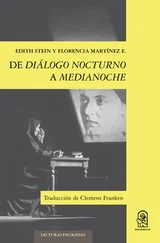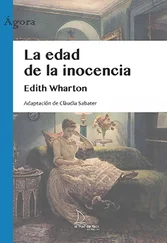Die Berücksichtigung der offenbarten Wahrheit kann ferner darin bestehen, daß der Philosoph in ihr Aufgaben für sich entdeckt, die ihm ohne ihre Kenntnis entgangen waren. P. A. R. Motte O.P. hat in seinem Vortrag in Juvisy darauf hingewiesen, daß die Glaubenslehre von Gott und der Schöpfung der Philosophie Anlaß gab zur Scheidung von Wesen und Dasein, die Lehre von der Allerheiligsten Dreifaltigkeit und von der Menschwerdung zur Scheidung von Natur und Person, die Lehre von der Hl. Eucharistie zur scharfen begrifflichen Herausarbeitung von Substanz und Akzidens. Die Begegnung mit einem bis dahin unbekannten Seienden zeigt das Seiende und das Sein als solches von einer neuen Seite. Die Offenbarung spricht in einer dem natürlichen Menschenverstand zugänglichen Sprache und bietet Stoff zu einer rein philosophischen Begriffsbildung, die von den Offenbarungstatsachen als solchen ganz absehen kann und deren Ergebnis Gemeingut aller späteren Philosophie wird (z. B. die Begriffe »Person« und »Substanz«).
Diese beiden Arten der Berücksichtigung von Glaubenswahrheiten zeigen die Philosophie in ihrem jeweiligen Zustand – als geschichtliches Gebilde – in Abhängigkeit von Glauben und Theologie als von äußeren Bedingungen ihrer Verwirklichung. Sie ergeben »Christliche Philosophie« in dem Sinne, in dem der Thomismus so genannt werden kann, aber keine christliche Philosophie, die die offenbarte Wahrheit als solche in ihren Gehalt mit aufnimmt. Wenn dagegen die Philosophie in der Erforschung des Seienden auf Fragen stößt, die sie mit ihren eigenen Mitteln nicht beantworten kann (z. B. die Frage nach dem Ursprung der menschlichen Seele), und wenn sie sich dann die Antworten zu eigen macht, die sie in der Glaubenslehre findet, um so zu einer umfassenderen Erkenntnis des Seienden zu gelangen, dann haben wir eine christliche Philosophie, die den Glauben als Erkenntnisquelle benutzt. Sie ist dann nicht mehr »reine« und »autonome« Philosophie. Es scheint mir aber nicht berechtigt, sie nun als Theologie anzusprechen. Wenn in einem geschichtlichen Werk über das Geistesleben des 20. Jahrhunderts die Umwandlung der modernen Physik durch den Einfluß der Einsteinschen Relativitätstheorie dargestellt wird, dann muß der Geschichtsforscher beim Naturwissenschaftler in die Schule gehen; sein Werk wird aber dadurch, daß er das Gelernte hineinarbeitet, kein naturwissenschaftliches. Das Ausschlaggebende ist die leitende Absicht. Das Verhältnis zwischen Philosophie und Theologie ist nicht genau dasselbe, weil es dem Geschichtsforscher nicht um die Richtigkeit oder Falschheit der Einsteinschen Theorie zu tun ist, sondern nur um ihren geschichtlichen Einfluß. Dem Philosophen aber geht es, wenn er eine Anleihe bei der Theologie macht, um die offenbarte Wahrheit als Wahrheit. Das Gemeinsame ist, daß in beiden Fällen eine andere Wissenschaft in Anspruch genommen werden muß, um in der eigenen weiterzukommen, und daß auf Grund des erlangten Hilfsmittels dann auf dem eigenen Gebiet weitergearbeitet wird. Allerdings kann die Philosophie für das, was sie mit Hilfe der Glaubenslehre feststellt, nicht die Einsichtigkeit in Anspruch nehmen, die das Kennzeichen ihrer eigenen, selbständigen Ergebnisse ist (sofern es sich um echte philosophische Erkenntnis handelt). Was aus der Zusammenschau von Glaubenswahrheit und philosophischer Erkenntnis stammt, das trägt den Stempel der doppelten Erkenntnisquelle, und der Glaube ist ein »dunkles Licht«. Er gibt uns etwas zu verstehen, aber nur, um uns auf etwas hinzuweisen, was für uns unfaßlich bleibt. Weil der letzte Grund alles Seienden ein unergründlicher ist, darum rückt alles, was von ihm her gesehen wird, in das »dunkle Licht« des Glaubens und des Geheimnisses, und alles Begreifliche bekommt einen unbegreiflichen Hintergrund. Das ist es, was P. Przywara als »reductio ad mysterium« bezeichnet hat. Wir stimmen mit ihm – wie aus den letzten Ausführungen ersichtlich ist – auch darin überein, daß die Philosophie »durch Theologie, nicht als Theologie« vollendet werde. Dagegen vermochte ich bei ihm nicht klar zu ersehen, von welcher Seite die Vereinigung von »Theologie und Philosophie innerhalb einer Metaphysik« erfolgt. Der »Form-Primat« der Theologie ist gewiß anzuerkennen in dem Sinn, daß der letzte Richterspruch über die Wahrheit sowohl theologischer als philosophischer Sätze der Theologie – in ihrer höchsten Bedeutung als Sprechen Gottes durch das kirchliche Lehramt – zusteht. Aber gerade weil die Philosophie (nicht die Theologie) einer inhaltlichen Ergänzung bedarf, fällt ihr die Aufgabe zu, die Einheit einer umfassenden Lehre herzustellen. So ist nach unserer Auffassung »christliche Philosophie« nicht bloß der Name für die Geisteshaltung des christlichen Philosophen, auch nicht bloß die Bezeichnung für die tatsächlich vorliegenden Lehrgebäude christlicher Denker – es bezeichnet darüber hinaus das Ideal eines »perfectum opus rationis«, dem es gelungen wäre, die Gesamtheit dessen, was natürliche Vernunft und Offenbarung uns zugänglich machen, zu einer Einheit zusammenzufassen. Das Streben nach diesem Ziel fand seinen Niederschlag in den »Summen« des Mittelalters; diese großen Gesamtdarstellungen waren die angemessene äußere Form einer auf das Ganze gerichteten Forschung. Die Verwirklichung dieses Ideals aber – in dem Sinn, daß alles Seiende in seiner Einheit und in seiner Fülle erfaßt wäre – entzieht sich grundsätzlich aller menschlichen Wissenschaft: schon das endliche Wirkliche ist etwas, was sich begrifflich nicht ausschöpfen läßt, um so mehr das unendliche Sein Gottes. Die reine Philosophie als Wissenschaft vom Seienden und vom Sein aus seinen letzten Gründen, soweit die natürliche Vernunft des Menschen reicht, ist auch in ihrer denkbar größten Vollendung wesenhaft ein Unvollendetes. Sie ist zunächst offen zur Theologie hin und kann von daher ergänzt werden. Aber auch die Theologie ist kein geschlossenes und je abschließbares Gedankengebilde. Sie entfaltet sich geschichtlich als fortschreitende gedankliche Aneignung und Durchdringung des überlieferten Offenbarungsgutes. Darüber hinaus aber ist zu bedenken, daß die Offenbarung nicht die unendliche Fülle der göttlichen Wahrheit in sich befaßt. Gott teilt sich dem Menschengeist mit in dem Maß und in der Weise, wie es Seiner Weisheit entspricht. Es steht bei Ihm, das Maß zu erweitern. Es steht bei Ihm, die Offenbarung in einer Form zu geben, die der menschlichen Denkweise angemessen ist: dem schrittweisen Erkennen, der begrifflichen und urteilsmäßigen Fassung; oder den Menschen über seine natürliche Denkweise hinauszuheben zu einer völlig anderen Erkenntnisart, zu einem Teilhaben an der göttlichen Schau, die in einem einfachen Blick alles umfaßt. Die vollendete Erfüllung dessen, worauf die Philosophie, als Streben nach Weisheit, abzielt, ist allein die göttliche Weisheit selbst, die einfache Schau, mit der Gott sich selbst und alles Geschaffene umfaßt. Die für einen geschaffenen Geist – freilich nicht aus eigener Kraft – erreichbare höchste Verwirklichung ist die »selige Schau«, die Gott ihm schenkt, indem Er ihn mit sich vereinigt: er gewinnt Anteil an der göttlichen Erkenntnis, indem er das göttliche Leben mitlebt. Die größte Annäherung an dieses höchste Ziel ist während des Erdenlebens die mystische Schau. Es gibt aber auch eine Vorstufe, zu der nicht diese höchste Begnadung nötig ist, und das ist der echte lebendige Glaube. Nach der Lehre der Kirche ist »der Glaube eine übernatürliche Tugend, durch die wir, auf die Eingebung und mit dem Beistand der göttlichen Gnade, für wahr halten, was Gott offenbart und uns durch die Kirche gelehrt hat, nicht wegen der inneren, sachlichen Wahrheit, die wir mit dem Licht der natürlichen Vernunft erkennen würden, sondern wegen der Autorität des offenbarenden Gottes selbst, der weder getäuscht werden noch täuschen kann«. Der theologische Sprachgebrauch bezeichnet als Glauben nicht nur die Tugend (fides, qua creditur), sondern auch das, was wir glauben, die offenbarte Wahrheit (fides, quae creditur), und schließlich die lebendige Betätigung der Tugend, das Glauben (credere) oder den »Glaubensakt«. Und dieses lebendige Glauben ist es, das wir jetzt im Auge haben. Es ist darin Verschiedenes enthalten: indem wir auf die Autorität Gottes hin die Glaubenswahrheiten annehmen, halten wir sie für wahr, und eben damit schenken wir Gott Glauben (credere Deo). Wir können aber nicht Gott Glauben schenken, ohne an Gott zu glauben (credere Deum), d. h. zu glauben, daß Gott ist und Gott ist: das höchste und damit vollkommen wahrhaftige Wesen, das wir mit dem Namen »Gott« meinen. Die Glaubenswahrheiten annehmen heißt darum Gott annehmen, denn Gott ist der eigentliche Gegenstand des Glaubens, von dem die Glaubenswahrheiten handeln. Gott annehmen, das heißt aber auch, sich Gott im Glauben zuwenden oder »zu Gott hin glauben« (credere in Deum), Gott zustreben. So ist der Glaube ein Ergreifen Gottes. Das Ergreifen aber setzt ein Ergriffenwerden voraus: wir können nicht glauben ohne Gnade. Und Gnade ist Anteil am göttlichen Leben. Wenn wir uns der Gnade öffnen, den Glauben annehmen, haben wir den »Anfang des ewigen Lebens in uns«.
Читать дальше