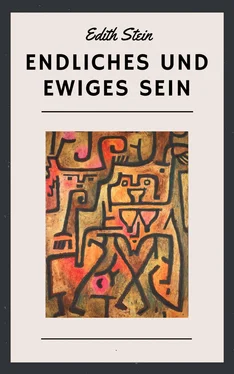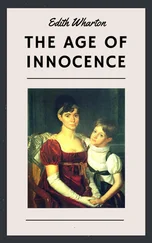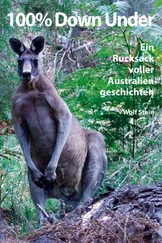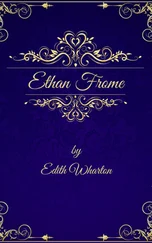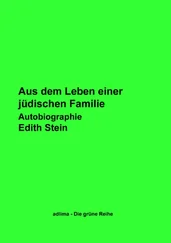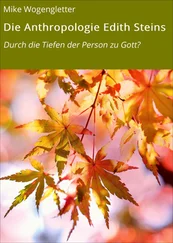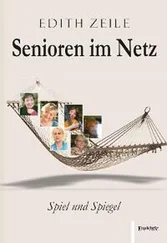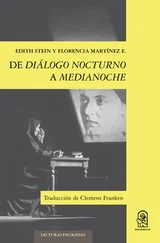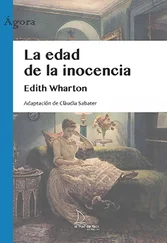Edith Stein - Edith Stein - Endliches und ewiges Sein
Здесь есть возможность читать онлайн «Edith Stein - Edith Stein - Endliches und ewiges Sein» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Edith Stein: Endliches und ewiges Sein
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Edith Stein: Endliches und ewiges Sein: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Edith Stein: Endliches und ewiges Sein»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Edith Stein (1891 – 1942) gilt als Brückenbauerin zwischen Glaubensrichtungen und Wertesystemen. Ihr Werk «Endliches und ewiges Sein» erschien erstmals 1937.
Edith Stein: Endliches und ewiges Sein — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Edith Stein: Endliches und ewiges Sein», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
§ 5. Aufbau und Seinsbedingungen der Erlebniseinheit
Es sollen zunächst die Dauereinheiten weiter betrachtet werden, die man als »gegenwärtig« zu bezeichnen pflegt, d. h. die in lebendigem Werden begriffenen. Dadurch, daß beständig etwas von ihnen die Seinshöhe – wenn auch nur für einen Augenblick – erreicht, erhält das Ganze Anteil am Sein und gibt sich als gegenwärtig-wirklich, als »etwas Aktuelles«. Das, was diesen Charakter des Gegenwärtig-Wirklichen hat und ihn verliert, sobald es abgeschlossen ist und als »Ganzes« »in die Vergangenheit rückt« – d. h. als etwas, was war, aber nicht mehr ist, im Blick behalten werden kann –, ist von diesem Charakter, von der Seinsweise, zu unterscheiden. Wir nennen es den Erlebnisgehalt. Der Gehalt ist wesentlich – wenn auch nicht allein – bestimmend für die Einheit des Gebildes. Die Freude über eine gute Nachricht ist eine solche Einheit. Sie setzt das verständnisvolle Vernehmen der Nachricht und die Erkenntnis ihrer Erfreulichkeit voraus; aber dieses gehört nicht zur Einheit der Freude als solcher. Es kann sein, daß ich schon eine ganze Weile um die Nachricht weiß, ehe ich anfange, mich darüber zu freuen. Entweder hatte ich ihre Bedeutung anfangs noch nicht recht erfaßt, oder ich war mir wohl klar über die Erfreulichkeit, aber ich war von anderen Dingen so in Anspruch genommen, daß ich mich nicht freuen konnte. Das Erleben des Gehaltes »Freude« ist also von zwei Seiten her bedingt: vom »Gegenstand« und vom »Ich«. Der Gegenstand – in diesem Fall der Inhalt der Nachricht – gehört nicht als »Teil« zur Freude als Erlebnisgehalt, wohl gehört aber dazu die Richtung auf diesen Gegenstand (die »Intention«, nach dem Sprachgebrauch der Phänomenologen); die Eigentümlichkeit, daß sie Freude über diesen Gegenstand ist, gehört zu ihrem Bestand, und »intentional«, d. h. als das »von ihr Gemeinte«, gehört auch der Gegenstand ihr zu. Das Ganze der Erlebniseinheit »diese Freude« ist abgeschlossen, wenn ich mich nicht mehr freue oder wenn zwar »wieder eine« Freude in mir ist, aber eine Freude über etwas anderes oder an etwas anderem. Auch das »Ich« ist in verschiedenem Sinn an der Erlebniseinheit beteiligt. Wenn ich sage: »Ich sehe wohl ein, daß dies etwas Erfreuliches ist, aber ich bin jetzt nicht imstande, mich zu freuen«, so ist das Ich aus dem erlebten »Einsehen« und dem erlebten »Nicht-imstande-sein« nicht zu streichen. Ich kann nichts erleben, ohne daß »ich« erlebtermaßen dabei wäre. Aber was ist das für ein »Ich«? Wenn ich versuche, mir über den Grund Rechenschaft zu geben, warum ich mich nicht freuen kann, so ist es vielleicht möglich festzustellen, daß eine große Sorge mich zu sehr erfüllt, um noch für eine Freude Raum zu lassen. Es kann aber auch sein, daß ich nur einfach mein Unvermögen fühle, ohne einen Grund angeben zu können. Trotzdem bin ich überzeugt, daß es »an mir liegt«, daß »in mir« ein Grund vorhanden ist, dem ich nur nicht auf die Spur kommen kann. Es gibt also »in mir« etwas – und gar mancherlei –, was mir unbekannt ist. Und in diesem Sinn gehört das Ich nicht zum Erlebnisgehalt, es liegt {{sic!}} – in ähnlicher, wenn auch nicht ganz in derselben Weise wie der Gegenstand, dem das Erlebnis zugewandt ist – über das Erlebnis hinaus. Husserl bezeichnet beide, den Gegenstand und das »psychische Ich«, als transzendent.
§ 6. Das »reine Ich« und seine Seinsweisen
Im Gegensatz zu diesem verborgen hinter dem unmittelbar bewußten Erleben stehenden Ich nennt er das im Erleben unmittelbar bewußte das »reine Ich«. Nur von diesem soll vorläufig die Rede sein, solange die Betrachtung sich im Bereich des unmittelbar Bewußten, des uns Nächsten und von uns Unabtrennbaren, hält. Husserl sagt von ihm, es habe keinen Inhalt und sei an sich unbeschreiblich: »reines Ich und nichts weiter«. Das heißt, es sei das Ich, das in jedem »ich nehme wahr«, »ich denke«, »ich ziehe Schlüsse«, »ich freue mich«, »ich wünsche« usw. lebt und in dieser oder jener besondern Weise auf das Wahrgenommene, Gedachte, Gewünschte usw. gerichtet ist. Es kann hier dahingestellt bleiben, ob die »Reinheit« des reinen Ich wirklich so zu verstehen sei, daß es in sich – inhaltlich – kein so oder so geartetes und daß es darum von anderen nur zahlenmäßig unterschieden wäre. Es kommt zunächst nur darauf an, zu sehen, daß es in jedem Erlebnis lebt und daraus nicht zu streichen ist. Es ist vom Erlebnisgehalt unabtrennbar, aber es ist nicht eigentlich als »Teil« dieses Gehalts anzusehen. Vielmehr gehört jedes Erlebnis ihm zu, das Ich ist das, das in einem jeden lebt; der Fluß, in dem sich immer neue Erlebniseinheiten aufbauen, ist sein Leben. Das besagt aber noch etwas mehr als daß ihm alle Erlebnisgehalte zugehören. Das Ich lebt, und das Leben ist sein Sein. Es lebt jetzt in der Freude, ein wenig später in der Sehnsucht, und dann wieder in einem Nachdenken (meist in verschiedenen solchen Erlebniseinheiten zugleich) – die Freude verklingt, die Sehnsucht vergeht, das Denken hört auf: aber das Ich vergeht nicht und hört nicht auf, sondern ist in jedem Jetzt lebendig. Damit soll nicht ausgesprochen sein, daß ihm »ewiges« Leben zukomme. Ob es immer war und immer sein wird, danach brauchen wir hier nicht zu fragen. Es soll nur aufgezeigt werden, daß es nicht entsteht und vergeht wie die Erlebniseinheiten, sondern ein lebendiges ist, dessen Leben sich mit wechselnden Gehalten erfüllt. Dies wiederum heißt nicht, daß sein Leben ein fertiges Gefäß wäre, das sich allmählich mit Gehalten füllte, – es ist selbst ein in jedem Augenblick neu aufquellendes. Es heißt aber, daß sein Sein in jedem Augenblick gegenwärtig-wirklich, aktuell ist. So wird es etwas weniger rätselhaft, daß die Erlebnisgehalte zum wirklichen Sein gelangen, obwohl sie jeweils nur einen Augenblick, mit einem »Punkt« daran rühren. Es ist eigentlich gar nicht ihr Sein, sie sind für sich allein nicht zum wirklichen Sein fähig, sondern erhalten nur durch das Ich, in dessen Leben sie eingehen, an dessen Sein Anteil. Das Ich ist also im Verhältnis zu dem, was ihm das Sein verdankt, was aus ihm und in ihm zum Sein emporsteigt, Seiendes in einem ausgezeichneten Sinn: hier nicht im Sinn der »Seinshöhe« zu ihren »Vorstufen«, sondern im Sinn des Tragenden zu dem von ihm Getragenen. Ehe wir aber diesem höchst bedeutsamen Unterschied von Tragendem und Getragenem weiter nachgehen, soll das Verhältnis des Ich zur Seinshöhe und ihren Vorstufen (zu Akt und Potenz) geklärt werden. Nach dem, was bisher festgestellt wurde, hat es den Anschein, als müßte das Ich immer aktuell, als könnte es gar nicht potenziell sein. Wir haben ja unter Potenzialität nicht die bloße logische Möglichkeit des Übergangs vom Nichtsein zum Sein verstanden, sondern eben eine Vorstufe zum Sein, die selbst schon eine Weise des Seins ist. Die Möglichkeit, aus dem Nichts ins Dasein zu treten, besteht auch für das Ich. Aber sein, ohne lebendig zu sein – wie die vergangene Freude ein »unlebendiges Sein« hat –, das scheint unmöglich. Wenn das Ich nicht lebt, dann ist es auch nicht, und ist auch nicht Ich, sondern ist Nichts. Es ist an sich leer und bekommt alle Fülle durch die Erlebnisgehalte; sie aber bekommen von ihm das Leben. Dennoch scheint es, als ob von verschiedenen Graden der Lebendigkeit beim Ich gesprochen werden könnte und müßte. Um das einzusehen, muß man das eigentümliche Leben des Ich noch etwas näher betrachten. Weil alles Leben der Gehalte dem Ich entspringt und weil es in allen Erlebnissen lebt, darum ist es verständlich, daß die Erlebniseinheiten – obgleich durch ihre verschiedenen Gehalte in sich geschlossen und von anderen abgegrenzt – sich nicht wie die Glieder einer Kette aneinander- und nebeneinanderreihen, sondern daß es berechtigt ist, wenn Husserl von einem Erlebnisstrom spricht. Das immer lebendige Ich geht von einem Gehalt zum anderen, aus einem Erlebnis ins andere, und so ist sein Leben ein fließendes Leben. Vom Ich her ist es aber auch zu verstehen, daß das »nicht mehr Lebendige«, das »Vergangene« nicht einfach ins Nichts versinkt, sondern in abgewandelter Weise fortbesteht, und daß das »noch nicht Lebendige«, das »Zukünftige«, schon in gewisser Weise ist, ehe es lebendig wird. Das Ich läßt das, was es erlebt hat, nicht sogleich los, sondern behält es noch eine Weile im Griff, und ebenso streckt es sich schon dem Kommenden entgegen und greift danach. Und auch das, was es gegenwärtig nicht festhält, bleibt in gewisser Weise erreichbar. Es braucht hier nicht die Frage erörtert werden, ob überhaupt etwas völlig vergessen werden könne – so vergessen, daß es nicht wieder »auftauchen« oder »ins Gedächtnis zurückgerufen« werden könnte. Sicher ist, daß weit Zurückliegendes, woran ich sehr lange gar nicht mehr gedacht habe, erinnernd »vergegenwärtigt« werden kann: z. B. die Freude, die wir als Kinder hatten, wenn unsere Mutter von einer Reise zurückkam. Die Vergegenwärtigung kann auf sehr verschiedene Weise geschehen. Entweder weiß ich bloß um die Tatsache, daß und wie ich mich damals gefreut habe. Dann ist das Wissen das, worin ich gegenwärtig lebe, und die Tatsache, daß ich mich damals gefreut habe, ist der Gegenstand meines Wissens. Die Freude, um die ich nur weiß, ist keine lebendige Freude, auch keine »lebendig vergegenwärtigte«; das Ich lebt nicht darin. Es ist sodann möglich, daß ich mich in jene Zeit »zurückversetze«, »gleichsam« in der Erwartung des Wiedersehens lebe und dann Zug um Zug das Wiedersehen und die Wiedersehensfreude noch einmal nacherlebe. Was ist nun »lebendig«, gegenwärtig-wirklich? Jetzt vollziehe ich das nach, was damals ursprünglich sich vollzog. Es ist etwas Ähnliches wie das verstehende Miterleben dessen, was ein Anderer gegenwärtig neben mir erlebt. Solange die Freude des anderen oder die Freude von damals nur nachvollzogen ist, ist nur dieser Nachvollzug mein gegenwärtiges Leben, die Freude ist aber nicht vollebendige, sondern »meine frühere« oder die fremde in der Weise der Vergegenwärtigung, die hinter der vollen Lebendigkeit meiner gegenwärtigen Freude zurückbleibt. Wie steht es in diesem Fall mit dem Ich? Lebe ich, wenn ich mich in die Vergangenheit zurückversetze, im Jetzt oder im vergangenen Augenblick? Lebe ich, das gegenwärtige Ich, in der vergangenen Freude? Oder gehört zu der vergangenen Freude ein anderes, ein vergangenes Ich, das dann doch wohl ein nichtaktuelles wäre? Was zunächst den Zeitpunkt anlangt: das Ich lebt – so scheint es – zugleich »jetzt« und »damals«. Jetzt – denn ich versetze mich aus dem gegenwärtigen Augenblick in den vergangenen und gebe den gegenwärtigen nicht preis. Damals – denn ich »versetze mich« in den vergangenen Augenblick und lebe darin. Was kann das aber heißen, wenn wir bedenken, daß in der Vergangenheit nichts wirklich sein kann? Ich bin nur jetzt wirklich und kann an eine Stelle, an der ich früher wirklich war, nicht wieder zurückkehren. Aber ich habe die Stelle mit dem, was einmal »dort« wirklich war, und mit ihrem (nicht streng abgegrenzten und gemessenen) Abstand vom Jetzt geistig im Griff und habe die Freiheit, das, was damals war, jetzt zu wiederholen – freilich nur, soweit es noch in der abgewandelten Weise, die wir »potenziell« nennen – in mir ist. In Wahrheit ist es also nicht möglich, zugleich jetzt und damals zu leben, das Vergangene bleibt vergangen; ich kann nur, was damals wirklich war, jetzt wiederholen mit dem Bewußtsein, daß es Wiederholung von Vergangenem ist. Das Damals – d. h. das einstige Jetzt – wird dadurch nicht zum gegenwärtigen Jetzt. Es bleibt bewußtseinsmäßig davon getrennt durch das erlebte »Sichzurückversetzen« oder Herbeiholen, durch den erlebten Gegensatz der gegenwärtigen und der vergangenen Gesamtlage und durch die von meinem vergangenen Leben »erfüllte« Zeitstrecke zwischen dem Damals und Jetzt. Ich lebe in der vergangenen Freude nicht wie in einer gegenwärtigen, solange ich sie nur nachlebe. Dabei kann es sein, daß ich, das gegenwärtige Ich, an der Stelle des vergangenen Ich stehe und an seiner Stelle sein Leben nachlebe. Ich weiß wohl, daß ich »damals« anders in der Freude lebte als »jetzt«, wo ich sie nur nachlebe, aber es ist kein doppeltes Ich da. Es kann aber auch sein, daß mir in der Vergegenwärtigung mein Ich von damals wie ein fremdes begegnet und daß ich seine Freude wie eine fremde mitvollziehe. Ich, das lebendige Ich von jetzt, stehe dann neben dem Ich von damals, das jetzt nicht lebendig ist. Ich weiß nur, daß es – oder vielmehr ich – damals lebendig war. Haben wir in diesem Fall ein potenzielles Ich vor uns und müssen wir sagen, daß das Ich doppelt vorhanden sei, einmal als aktuelles und einmal als potenzielles? Das würde nicht der Sachlage entsprechen. Das »vergangene Ich« ist nur ein »Bild« meiner selbst, wie ich einst lebendig war, und das Bild des Ich ist kein Ich.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Edith Stein: Endliches und ewiges Sein»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Edith Stein: Endliches und ewiges Sein» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Edith Stein: Endliches und ewiges Sein» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.