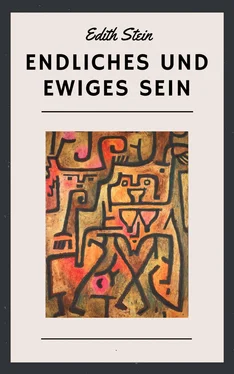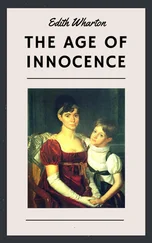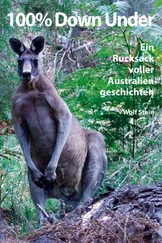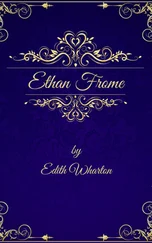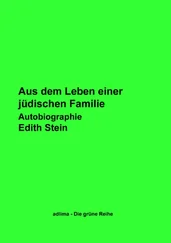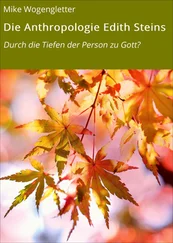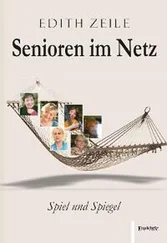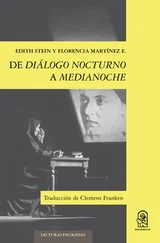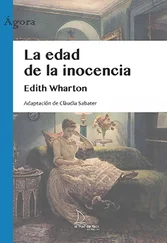Wir brauchen die Frage des Einzelseins geometrischer Gebilde hier nicht weiter zu verfolgen. Worauf es in unserm Zusammenhang ankommt, das ist das eigentümliche Sein der »idealen Gegenstände« – für die uns die geometrischen Gebilde als Beispiel dienten – in seinem Unterschied zum wirklichen Sein einerseits, zum bloßen Gedachtsein auf der andern Seite zu erfassen. Diese Gebilde können in der Zeit »verwirklicht« oder »gedacht« werden, aber sie haben unabhängig davon ein zeitloses Sein, sie selbst, als in sich bestimmte Gebilde, werden nicht. Kann es dann noch einen Sinn haben, sie als »geschaffen«, als Verwirklichungen schöpferischer Gottesgedanken« zu bezeichnen? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns den Doppelsinn des Seins der »Ideen« »in Gott« vor Augen halten. Die Ideen sind einmal das »Was« alles Seienden, so wie es als gegliederte SinnMannigfaltigkeit vom göttlichen Geist umspannt ist. Darin haben auch die Ideen ihre bestimmte Stelle. Ihr eigenes Sein ist gegenüber diesem »Sein im Logos« nicht etwas Späteres und Abgeleitetes, sie werden mit ihrem eigenen Sein, das ein zeitloses und wandelloses ist im Unterschied zum anfangenden und fließenden wirklichen Sein der Dinge, vom Logos umfaßt. Die Ideen als Ursache alles endlichen Seienden sind das eine einfache göttliche Wesen, zu dem alles Endliche in einem eigentümlichen Abbildverhältnis steht; dieses Abbildverhältnis muß für alles endliche Seiende angenommen werden, für das zeitlose wie für das zeitliche. Sofern das »Urbild« das Erste ist und die »Abbilder« das Abgeleitete, das durch das Abbildverhältnis seinen Daseinssinn empfängt, ist alles Endliche als durch das Ursprüngliche und Einfache in sein Sondersein hineingesetzt und in diesem Sinn als geschaffen anzusehen.
Von daher leuchtet wieder der nahe Zusammenhang zwischen dem »Logos« und der Schöpfung auf. Der Logos nimmt eine eigentümliche MittelStellung ein; er hat gleichsam ein doppeltes Antlitz, wovon eines das eine und einfache göttliche Wesen widerspiegelt, das andere die Mannigfaltigkeit des endlichen Seienden. Er ist das göttliche Wesen als erkanntes und ist die Sinn-Mannigfaltigkeit des Geschaffenen, die von göttlichem Geist umspannt wird und das göttliche Wesen abbildet. Von daher ist ein Weg zum Verständnis einer doppelten sichtbaren Offenbarung des Logos: im menschgewordenen Wort und in der geschaffenen Welt. Und von da aus führt ein weiterer Schritt zum Gedanken der untrennbaren Zusammengehörigkeit des menschgewordenen und des »weltgewordenen« Logos in der Einheit des »Haupt und Leib – ein Christus«, wie sie uns in der Theologie des Apostels Paulus und in der Lehre vom Königtum Christi bei Duns Scotus entgegentritt. Aber das sind schon rein theologische Fragen, die über unsern Rahmen hinausgehen.
Die herangezogenen Glaubenswahrheiten – der Trinität und der Erschaffung alles endlichen Seienden durch den göttlichen Logos – sollten Licht geben in der Schwierigkeit, in die uns die rein philosophische Erforschung der Seinsfrage führte: wir waren auf der einen Seite, vom endlichen Seienden und seinem Sein herkommend, auf ein erstes Seiendes gestoßen, das Eines und einfach sein muß, Was, Wesen und Sein in Einem; auf der andern Seite gelangten wir, vom Was des endlichen Seienden ausgehend, zu einer Mannigfaltigkeit letzter Wesenselemente. Rein philosophisch zum Verständnis dieses doppelten Antlitzes des »ersten Seienden« zu gelangen, ist nicht möglich, weil uns keine erfüllende Anschauung des ersten Seienden zu Gebote steht. Die theologischen Überlegungen können zu keiner rein philosophischen Lösung der philosophischen Schwierigkeit führen, d. h. zu keiner unausweichlich zwingenden »Einsicht«, aber sie eröffnen den Ausblick auf die Möglichkeit einer Lösung jenseits der philosophischen Grenzpfähle, die dem entspricht, was noch philosophisch zu erfassen ist, wie andererseits die philosophische Seinserforschung den Sinn der Glaubenswahrheiten aufschließt.
IV. Wesen – essentia, οὐσία – Substanz, Form und Stoff
§ 1. »Wesen«, »Sein« und »Seiendes« nach »De ente et essentia«. Verschiedene Begriffe von »Sein« und »Gegenstand« (Sachverhalte, Privationen und Negationen, »Gegenstände« im engeren Sinn)
Das Gebiet des wesenhaften Seins, das uns von phänomenologischer Seite her erschlossen wurde, ist ein Feld großer Untersuchungen, in die wir nur einen ersten Einblick gewonnen haben. Aber schon dieser erste Einblick mit den Unterscheidungen, die er uns zu machen gelehrt hat, fordert zu einer klärenden Gegenüberstellung mit der »Seins- und Wesenslehre« auf, die in der überlieferten »Metaphysik« enthalten ist. Wir erinnern uns an das opusculum »De ente et essentia«, das uns Potenz und Akt als Seinsweisen kennen lehrte. Wir haben »essentia« mit »Wesen« übersetzt und uns andererseits klargemacht, daß es die Übersetzung des aristotelischen Ausdrucks οὐσία sei. Daraus ergibt sich die Aufgabe, das, was wir unter »Wesen« verstanden, mit dem, was Thomas unter »essentia« und Aristoteles unter οὐσία versteht, zu vergleichen.
Das erste Kapitel von »De ente et essentia« ist der Klärung der Wortbedeutung von »ens« und »essentia« gewidmet. Aristoteles braucht den Ausdruck ὄν (= ens = Seiendes) in doppeltem Sinn. Daran knüpft der hl. Thomas hier an. »In einem Sinn ist es das, was durch die zehn Kategorien eingeteilt wird. Im andern das, was die Wahrheit von Sätzen bezeichnet. Der Unterschied zwischen beiden ist der, daß im zweiten Sinn seiend alles das genannt werden kann, worüber eine bejahende Aussage möglich ist, auch wenn dadurch nichts an sich Bestehendes (nihil in re) gesetzt wird: in diesem Sinn werden auch Mängel (privatio) und Verneinungen (negatio) seiend genannt; denn wir sagen, die Bejahung sei der Verneinung entgegengesetzt und die Blindheit sei im Auge. Aber im ersten Sinn kann nur etwas seiend genannt werden, womit etwas an sich Bestehendes gesetzt wird. In diesem ersten Sinn also ist Blindheit u. dgl. nichts Seiendes.« Thomas erörtert hier das »Seiende«, weil er das »Wesen« (essentia) als das Seiende bestimmen will. Der Sinn von »seiend«, den er ausschließend behandelt, ist aber noch ein doppelter. Er ist einmal das Sein, das in der sogenannten »Kopula«, im »ist« des Urteils ausgesprochen wird. Das wird hier als »Wahrheit von Sätzen« bezeichnet. »Die Rose ist rot« – »Die Rose ist nicht gelb«: das sind beides wahre Sätze. Beide geben einem erkannten Sachverhalt Ausdruck, und das »ist« ist die sprachliche Form, in die sich die Behauptung dieses Sachverhaltes kleidet. Das Bestehen des Sachverhaltes, das in dem »ist« des Urteils behauptet wird, ist wiederum ein eigentümliches Sein – eben jenes Sein, das den Sachverhalten zukommt. »Sachverhalte« sind Gebilde von eigentümlich gegliedertem Bau: sie haben »Gegenstände« in dem früher schon angedeuteten engeren Sinn des Wortes zur Voraussetzung; sie sind das, was (in einem bestimmten, eingeschränkten Sinn des Wortes »Erkennen«) erkannt, was im Urteil behauptet und (mit dem Urteil) im Satz ausgedrückt wird. Die eigentümliche Gliederung der Sachverhalte beruht darauf, daß in ihnen auseinandergefaltet wird, was in den zu Grunde liegenden Gegenständen beschlossen ist: Wesen und Sein zeigen sich hier in ihrer Getrenntheit und Zusammengehörigkeit zugleich, das Wesen entfaltet sich in seine Wesenszüge, es offenbart das aus ihm Folgende usw. Die Sachverhalte haben ihr Gegenspiel in einem Geist, dessen Erkennen sich in abgesetzten Denkschritten vollzieht, sie sind aber nicht als vom Geist »gebildet« anzusehen. »Gebildet« wird das Urteil, das sich dem Sachverhalt anmißt. Das Urteilen – wie alles Denken – ist in einem gewissen Sinne »frei«: es steht bei mir, ob ich urteilen will oder nicht. Aber ich darf dabei nicht willkürlich vorgehen, wenn ich »richtig« urteilen will. Der Aufbau der gegenständlichen Welt schreibt den Sachverhalten ihre Gliederung und dem schrittweise vorgehenden Denken seinen Weg vor. Demnach ist das Sein der Sachverhalte kein »bloßes Gedachtsein«, es hat ein »fundamentum in re«; aber weil es einer »Grundlage« bedarf, ist es ein abgeleitetes Sein. Die Sachverhalte sind darum nicht das Seiende, von dem unmittelbar ein Zugang zur »essentia« führt.
Читать дальше