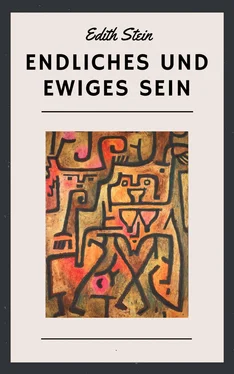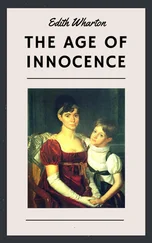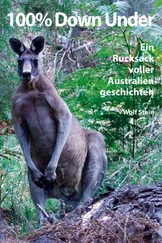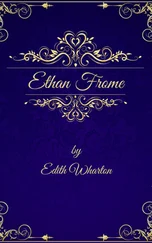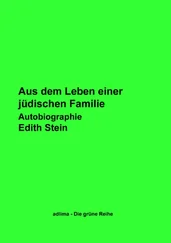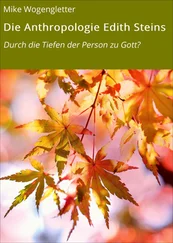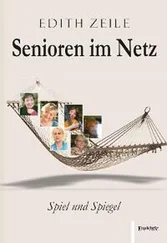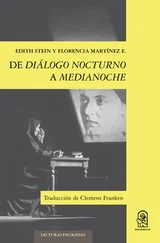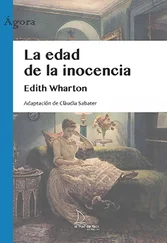So ist es jedenfalls klar, daß das wesenhafte Sein vom wirklichen Sein der Dinge unterschieden und unabhängig ist. Die weiteren Fragen sind, in welchem Verhältnis es zu dem wirklichen Sein der Dinge steht und in welchem Verhältnis zu dem ewigen Sein des ersten Seienden. Dafür wird die Frage zu prüfen sein, was das »im göttlichen Geist sein« bedeutet, ob es den Sinn des wesenhaften Seins trifft und ob es ihn erschöpft.
§ 9. Das wesenhafte und das wirkliche Sein der Dinge
Für die Untersuchung des Verhältnisses von wesenhaftem und dinglichwirklichem Sein ist zu beachten, daß das Seiende, dem das wesenhafte Sein eigen ist, ein mannigfaltiges ist: Wesenheiten, Washeiten und noch manches andere, was wir in unseren Darlegungen nur gestreift, nicht eigentlich erörtert haben. Wenn wir »Wesen« und »wesen« in ihrer nahen Zusammengehörigkeit betrachten und »Wesen« für alles Seiende nehmen, dem wesenhaftes Sein eignet, dann ist »Wesen« nicht in dem engeren Sinn gemeint, in dem es früher gegen »Wesenheit« und »Washeit« abgegrenzt wurde, sondern in erweiterter Bedeutung. Um über das Verhältnis von wesenhaftem und wirklichem Sein Klarheit zu gewinnen, werden wir aber wieder unterscheiden müssen. Das Wesenswas »Freude eines Kindes« war seinem wesenhaften Sein nach vor aller Zeit, ehe es die Welt und Menschenkinder in der Welt und Kinderfreude »gab«. Als zum erstenmal ein Kind in der Welt Freude empfand, da war auch zum erstenmal das Wesen und Was »Freude eines Kindes« wirklich. Wenn das Kind »vor Freude« aufjauchzte und aufhüpfte, so war es die Freude kraft ihres Wesens, die so wirkte und sich offenbarte. Die Freude ist durch ihr Wesen wirklich und wirksam – das Wesen ist in der Freude wirklich und wirksam, in der Freude dieses Kindes, als ein Einmaliges. Das Wesenswas »Freude eines Kindes«, seinem wesenhaften Sein nach betrachtet, ist eins, so oft es auch verwirklicht sein mag. Entsprechende wirkliche Wesen und Washeiten gibt es so viele, wie es sich freuende Kinder gibt. Und das Verhältnis des einen »wesenhaften« Was und der vielen wirklichen Wesen und Washeiten ist angemessen ausgedrückt, wenn wir sagen: Dasselbe ist hier und dort und überall wirklich, wo Kinderfreude lebendig ist. Daß etwas zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten zugleich sein kann, macht nur für den Schwierigkeiten, der nicht davon loskommt, das räumlich und zeitlich gebundene Seiende als das Seiende schlechthin zu betrachten. So gut ich mich jetzt »im Geist« an einen andern Ort versetzen kann und dann meinem geistigen Sein nach hier und dort zugleich bin (obwohl ich mit meinem wirklichen Leib nur hier bin), so gut kann dasselbe »wesenhafte Was« hier und dort zugleich verwirklicht sein. Es gehört dazu allerdings ein Etwas hier und ein anderes Etwas dort, worin es verwirklicht wird.
Wenn das Was und das Wesen in den Einzeldingen wirklich und wirksam wird und das ist, wodurch sie wirklich und wirksam sind – ist ihm dann wohl auch das Wirklichwerden in den Einzeldingen zuzuschreiben, d. h. der Übergang vom wesenhaften zum wirklichen Sein? Damit käme dem wesenhaften Sein eine Wirksamkeit zu, und es wäre in vollem Sinne wirkliches Sein. Denn unter wirklichem (= aktuellem) Sein verstanden wir »vollendetes Sein, das sich in Wirksamkeit auswirkt und offenbart«. Seinsvollendung haben wir den Wesenheiten und Washeiten zugesprochen im Sinn des Ruhens in sich selbst. Würde sich nun ergeben, daß die Washeit von sich aus zum Sein in den Einzeldingen überginge, so hätte das wesenhafte Sein den Vollsinn von »wirklichem Sein« erreicht. Ja, die Wirklichkeit der Washeiten wäre eine höhere als die der Einzeldinge, weil sie ihnen vorausgingen als wahre Ur-Sachen, die die Wirklichkeit der Einzeldinge hervorbrächten: sie wären im Verhältnis zu den Einzeldingen nicht nur πρώται οὐσίαι, sondern wahrhaft »creatrices essentiae«. Wenn wir aber die Washeiten so nehmen, wie wir sie gefunden haben – als das reine Was der wirklichen Wesen –, so können wir eine solche höhere Wirklichkeit und eigenkräftige Wirksamkeit in ihnen nicht finden. Sie erscheinen vielmehr im Vergleich zu den wirklichen Dingen und ihren wirklichen Wesen als eigentümlich blasse und kraftlose Gebilde, sodaß wir eher geneigt sind, sie als un-wirkliche denn als ur-wirkliche Gegenstände zu bezeichnen.
Das, was wir »Washeit«, »Wesenswas« oder »wesenhaftes Was« genannt haben, ist jedenfalls in dem befaßt, was die Scholastik unter universale versteht. Der ursprünglichen Wortbedeutung nach ist es »unum versus alia seu unum respiciens alia«: eins gegenüber anderem oder im Hinblick auf anderes. Und da eins auf anderes in verschiedener Weise bezogen sein kann: als es bezeichnend oder darstellend oder verursachend oder im Sein, so wird ein vierfacher Sinn des »Allgemeinen« unterschieden: allgemeine Worte, allgemeine Begriffe, allgemeine Ursache (Gott), allgemeine Naturen. Der Streit um die rechte Deutung der Universalien ist fast so alt wie die Philosophie. Seit den Tagen der Vorsokratiker hat es zu allen Zeiten Nominalisten gegeben, die nur eine Allgemeinheit der Namen zugeben wollten und als das damit Gemeinte die Einzeldinge betrachteten; Konzeptualisten, die wohl eine Allgemeinheit der Begriffe anerkannten, aber in den Begriffen Gebilde des Geistes sahen, denen in Wirklichkeit nichts entspreche; schließlich Realisten, die überzeugt waren, daß es in Wirklichkeit eine Natur gebe, die dem allgemeinen Namen und Begriff entspreche. Der Realismus spaltet sich aber noch in verschiedene Richtungen. Die thomistische Schule bezeichnet als »übertriebenen Realismus« die Auffassung, daß das Allgemeine als Allgemeines auf seiten der Dinge existiere. Dahin gehört der Platonismus (in der Deutung, die ihm die Scholastik mit Berufung auf Aristoteles gibt), der dem Allgemeinen ein Dasein außerhalb des Geistes und außerhalb der Einzeldinge zuschreibt. Dagegen lehrt Duns Scotus ein Sein des Allgemeinen in den Dingen. Ihren eigenen Standpunkt, der sich vor allem auf das Ansehen des Aristoteles, Boëthius, hl. Anselmus und hl. Thomas stützt, bezeichnen die Thomisten als gemäßigten Realismus. Diese Richtung unterscheidet zwischen der Materie oder dem, was in dem allgemeinen Begriff enthalten ist, d. i. die Natur, und der Form, der Allgemeinheit: der Materie schreiben sie ein Sein im Einzelding zu, der Form aber nur ein Sein im Geist.
Versuchen wir, ob wir in irgend einer dieser Auffassungen eine Klärung dessen finden können, was wir als »wesenhaftes Was« bezeichnet haben, und seines wesenhaften Seins. Es leuchtet ohne weiteres ein, daß wir dabei nicht einen bloßen Namen im Auge hatten, sondern etwas Sachliches. Eher könnte man auf den Gedanken kommen, das vom wirklichen unterschiedene »wesenhafte Was« als »Begriff« zu deuten. Der Begriff ist ja als etwas Gedankliches etwas Unwirkliches, man kann in gewissem Sinn auch von ihm sagen, daß er hier und dort »verwirklicht« sei, sofern demselben Begriff eine ganze Reihe von Einzeldingen entsprechen kann. Er besitzt schließlich eine gewisse Unabhängigkeit gegenüber dem Denken, in dem er gedacht wird: Derselbe Begriff kann von vielen Menschen gedacht werden. Und es eignet ihm jene Blässe und Unlebendigkeit im Vergleich zum wirklichen Sein, von der auch beim wesenhaften Sein gesprochen wurde. Will man ihn losgelöst von dem Wort, das ihn ausdrückt, und von dem Gegenstand, der durch ihn begriffen wird, fassen, so entschwindet er leicht dem Blick. Trotzdem ist es unmöglich, das nicht verwirklichte Was und Wesen oder das Was und Wesen abgesehen von seiner Verwirklichung als Begriff anzusehen. Denn Begriffe werden gebildet, sie sind »Erzeugnisse des Denkens« und lassen einer gewissen Willkür Spielraum. Die Wesen und Washeiten aber werden – ebenso, wie es früher von den Wesenheiten festgestellt wurde – vorgefunden und sind unserer Willkür entzogen. Pfänder sagt, es mache den Inhalt eines Gegenstandbegriffs aus, daß er einen bestimmten Gegenstand meine. »Nicht also die gemeinten Gegenstände selbst noch irgend etwas an diesen Gegenständen bilden den Inhalt des Begriffs.« Mit dem »Wesen« und »Was« meinen wir aber etwas, was wir in den Gegenständen vorfinden, auch wenn wir von ihrem Wirklichsein in den Gegenständen absehen. Allerdings werden wir den eben angeführten Satz Pfänders über den Begriffsinhalt nicht ganz uneingeschränkt unterschreiben können. Darüber bald etwas mehr.
Читать дальше