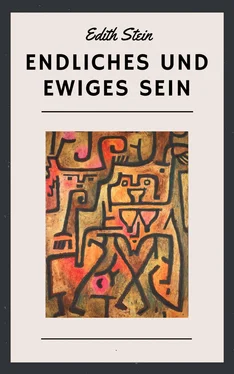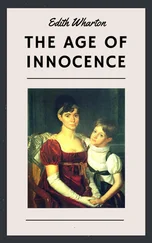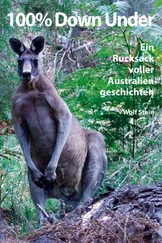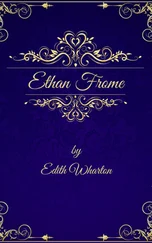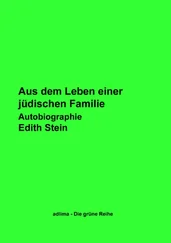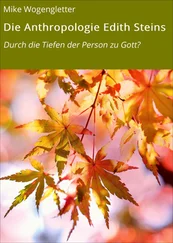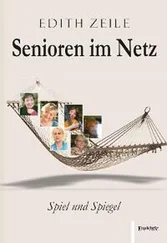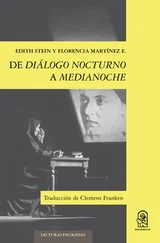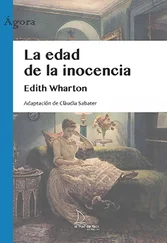Wir halten fest: Das wesenhafte »Was« ist weder bloßer Name noch bloßer Begriff. Es ist etwas Sachliches (aliquid a parte rei). Fügt es sich nun in die Auffassung des »gemäßigten Realismus« ein? Die Scheidung in »Materie« und »Form« können wir mitvollziehen. Die »Materie« ist das Was des Wesens, ungeachtet seines wirklichen oder wesenhaften Seins. Wir stimmen mit dem gemäßigten Realismus darin überein, daß ihm ein Sein in den Einzeldingen zukommt. Wie steht es nun mit der »Form« der Allgemeinheit, der nur ein »Sein im Geiste« zukommen soll? Was mit diesem Sein im Geist gemeint ist, müssen wir noch etwas näher zu ergründen suchen. Der hl. Thomas sagt darüber: »Das Allgemeine (universale) kann in doppeltem Sinn aufgefaßt werden: einmal auf die Natur selbst bezogen, welcher der Verstand die Bedeutung der Allgemeinheit (intentionem universalitatis) zuweist … Ferner kann das Allgemeine verstanden werden, sofern es allgemein ist und sofern die genannte Natur die Bedeutung der Allgemeinheit trägt, d. h. sofern »Lebewesen« oder »Mensch« als Eines in Vielem betrachtet wird. Und in diesem Sinn haben die Platoniker behauptet, »Lebewesen« und »Mensch« in ihrer Allgemeinheit seien Substanzen. Das zu widerlegen ist Aristoteles in diesem Kapitel bemüht: er zeigt, daß das »Lebewesen im allgemeinen« oder der »Mensch im allgemeinen« (animal commune, homo communis) keine Substanz in der wirklichen Welt (in rerum natura) sei. Sondern diese Allgemeinheit (communitas) hat die Form des Lebewesens oder des Menschen, sofern sie im Geiste ist, der eine Form als vielen Gegenständen gemeinsam aufnimmt, indem er sie loslöst von allem, was die Vereinzelung bedingt (ab omnibus individuantibus) …« »Denn der Verstand erkennt zwar die Dinge, sofern er ihnen ähnlich ist im Hinblick auf die species intelligibilis …, die species braucht aber nicht auf dieselbe Weise im Geist zu sein wie in der erkannten Sache; denn alles, was in einem Gegenstand ist, ist darin in der Weise dessen, in dem es ist. Und so folgt notwendig aus der Natur des Verstandes, die eine andere ist als die Natur der erkannten Sache, daß die Erkenntnisweise, in der der Verstand erkennt, etwas anderes ist als die Seinsweise, in der das Ding existiert. Es muß zwar dasselbe im Ding sein, was der Verstand erkennt, jedoch nicht auf dieselbe Weise.«
Besonders der letzte Satz ist für uns wichtig. Thomas spricht von »demselben«, das im Ding ist und das vom Verstand erkannt ist. Das »Erkanntsein« deckt sich für ihn mit dem »im Geist sein« (im Verstand – »intellectus« – sein). Das, was das Ding ist, ist ein »intelligibile«, d. i. etwas, was in den Verstand eingehen kann; wenn es erkannt wird, dann wird es actu intelligibile (wirklicher Erkenntnisgegenstand). Dasselbe ist einer doppelten hinzukommenden Seinsweise fähig: des Seins im Dinge (des wirklichen Seins, wenn das Ding ein wirkliches ist) und des Seins im Geist. Eben dieses, was auf verschiedene Weise sein kann und was man unter Absehen von seinen verschiedenen Seinsweisen fassen kann, scheint mir das zu sein, was wir bisher »wesenhaftes Was« genannt haben. Wenn es »im Geist« oder »in wirklicher Erkenntnis« ist, so heißt das nicht, daß es ein Bestandstück des erkennenden Geistes oder des wirklichen Erkennens als einer Erlebniseinheit sei. Insofern ist der bei Thomas so häufig wiederkehrende Grundsatz: das Erkannte ist im Erkennenden in der Weise des Erkennenden, etwas mißverständlich. Der erkennende Geist ist ein einzelnes Wirkliches. Das wird das Erkannte als solches durch sein Erkanntwerden niemals. Es wird nur ein vom Geist Umfaßtes, ihm Zugehöriges. Der Geist umfaßt es und besitzt es, aber immer als ein ihm Jenseitiges. Das Erkannte ist in einem ganz anderen Sinne »mein« als das Erkennen. Mein Erkennen ist einzig und allein meines: es kann nicht zugleich eines andern Menschen Erkennen sein. Aber das, was ich erkenne, und zwar nicht nur der Gegenstand der Erkenntnis, sondern auch das Erkannte, wie es erkannt wird, etwa in bestimmter begrifflicher Fassung, kann auch von andern erkannt werden. Ich entziehe es niemandem, indem ich es erkenne. Das »im Geist sein« oder »vom Geist umfaßt sein« kommt zu dem, was in der Erkenntnis umfaßt wird, ebenso hinzu, wie das Wirklichsein zu dem, was wirklich wird. »Wirklichsein« und »Erkanntsein« sind verschiedene Seinsweisen dessen, was, »in rerum natura« verwirklicht, »in intellectu« ein »actu intelligibile« wird, desselben »Wesenswas«. In der Tat ist das, was der Geist umfaßt, dasselbe, was er im wirklichen Wesen als sein Was vorfindet. Es wahrt seiner »Verwirklichung« wie seiner »Vergeistigung« gegenüber eine eigentümliche Unversehrtheit und Unberührtheit. Es ist, was es ist, ob es verwirklicht ist oder nicht und ob es erkannt ist oder nicht. Und eben dieses gegen »Verwirklichung« und »Vergeistigung« gleichgültige Sein ist es, was wir sein eigenes, sein wesenhaftes Sein nennen. Es muß dabei wohl beachtet werden, daß zur »Vergeistigung« noch etwas anderes gehört als das »Umfassen mit dem Geist«, das Denken »meint« den Gegenstand durch einen Begriff hindurch, mit dem es sein Was zu fassen sucht. Der ideal vollendete Begriff wäre mit dem Wesenswas vollkommen in Deckung, ohne mit ihm zusammenzufallen. Der Begriff, den der einzelne Mensch sich bildet, zielt auf diesen Idealbegriff ab (wenn es dabei auf seinen Wesensbegriff abgesehen ist, nicht auf eine beliebige »eindeutige Bestimmung«), bleibt aber mehr oder weniger hinter ihm zurück: durch Unvollständigkeit, vielleicht auch durch Falschheit. Jeder Mensch hat seine »begriffliche Welt«, die nicht nur mit der wirklichen, sondern auch mit der »Welt der idealen Begriffe« und mit den Begriffswelten anderer mehr oder minder in Deckung sein kann.
Weil das erkannte Wesenswas dasselbe ist, daß wir in einer Vielheit von Vereinzelungen vorfinden, darum können wir ihm die »Bedeutung der Allgemeinheit« geben; darum ist das Absehen von den Bedingungen seiner Vereinzelung möglich, das zu dieser Bedeutung gehört und das man Abstraktion nennt. An sich ist es weder »allgemein« noch »individuell«. Es hat im Bereich des wesenhaften Seins nicht seinesgleichen – das hat es mit dem Individuum gemeinsam. Aber es ist »mitteilbar« und läßt Vereinzelungen zu – das scheidet es vom Individuum im Vollsinn des Wortes und gibt die Möglichkeit, ihm »Allgemeinheit« zuzuschreiben.
Die letzten Bemerkungen machen deutlich, daß die hier entwickelte Auffassung wohl etwas über den »gemäßigten Realismus« hinausgeht, aber nicht als »platonischer Realismus« (nach der herkömmlichen Deutung des Platonismus) anzusprechen ist. Wir schreiben dem »wesenhaften Was« kein Sein nach Art der wirklichen Dinge zu, wir betrachten sie nicht als Individuen oder »Substanzen« (in einem später zu erläuternden Sinn dieses Wortes, das wir bisher sorgfältig vermieden haben). Am ehesten dürfte unsere Auffassung der des Duns Scotus nahekommen.
Im Bereich dessen, was wir als »wesenhaftes Sein« gegenüber dem wirklichen Sein auf der einen Seite, dem »im Geist sein« (in den verschiedenen möglichen Formen des Erkanntseins, Gedachtseins usw.) auf der andern Seite herauszustellen suchten, sind die Wesenheiten die Elemente, aus denen sich die Washeiten als zusammengesetzte Gebilde aufbauen; diese selbst gehen wiederum als ein Kernbestand in das volle Was der Dinge ein. Die Wesenheiten treten nur durch die Washeiten und Wesen zur wirklichen Welt in Beziehung. Die Washeiten und die Wesen werden in den Dingen als ihr fester Bestand wirklich, das volle Was als ihr fließender Bestand. Nähern wir uns diesem ganzen Gebiet von der »natürlichen Einstellung« her, die der Welt der wirklichen Dinge zugewandt ist, so gewinnen wir sie – durch »Ausschaltung« des wirklichen Seins – als das Was der Dinge oder als ihren sachlichen Sinn. Gehen wir in einer rückgewandten Betrachtung von dem aus, was der Geist als auffassender, denkender, erkennender, verstehender umfaßt, so treffen wir auf dasselbe als auf den Gehalt unseres gegenständlich gerichteten »Bewußtseins« oder auf den geistigen Sinn. Beginnen wir mit der Zergliederung des sprachlichen Ausdrucks, so finden wir dasselbe als sprachlichen Sinn.
Читать дальше