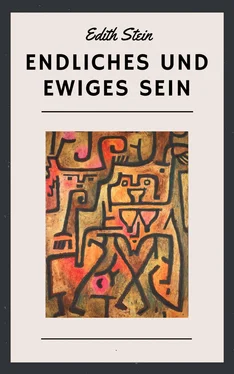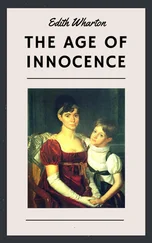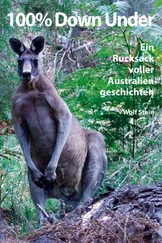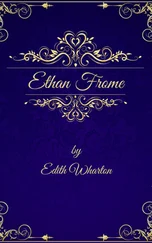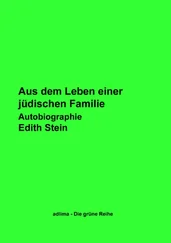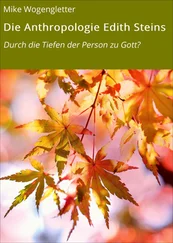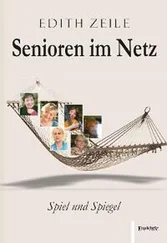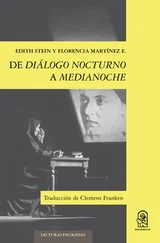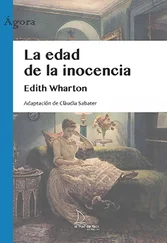»Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ ΛόγοϚ« – so antwortet die Ewige Weisheit auf die Rätselfrage des Philosophen. Die Theologen übersetzen: »Im Anfang war das Wort« (Joh 1, 1), und verstehen darunter das Ewige Wort, die zweite Person in der Dreifaltigen Gottheit. Wir tun aber den Worten des hl. Johannes keine Gewalt an, wenn wir, im Zusammenhang der Überlegungen, die uns hierher geführt haben, mit Faust zu sagen versuchen: »Im Anfang war der Sinn«. Man pflegt ja das Ewige Wort dem »inneren Wort« der menschlichen Rede zu vergleichen und erst das menschgewordene Wort dem »äußeren«, gesprochenen Wort. Wir fügen noch hinzu, was die Ewige Weisheit durch den Mund des Apostels Paulus spricht: »… αὐτόϚ ἐστιν πρὸ πάντων, καὶ τὰ πάντα ἐν αὐτῷ συνέστηκεν – Er ist vor allen Dingen, und alle Dinge haben in Ihm ihren festen Bestand und Zusammenhang.«
Offenbar tragen diese beiden Schriftworte uns weit über das hinaus, was uns der forschende Verstand erschlossen hat. Aber vielleicht kann uns der philosophische Sinn des Logos, zu dem wir vorgedrungen sind, den theologischen Sinn des Logos verstehen helfen, und andrerseits die offenbarte Wahrheit in den philosophischen Schwierigkeiten weiterhelfen. Wir versuchen zunächst, uns den Sinn der beiden Schriftstellen klar zu machen. Mit Sinn bezeichnet das Johannesevangelium eine göttliche Person, also nicht etwas Unwirkliches, sondern das Wirklichste, was es gibt. Er fügt auch sogleich hinzu: »πάντα δι' αὐτοῦ ἐγένετο – Durch Ihn sind alle Dinge geworden.« Und daran schließt sich sinngemäß die angeführte Paulusstelle, die den Dingen »im Logos« »Bestand und Zusammenhang« zuschreibt. So haben wir unter dem göttlichen ΛόγοϚ ein wirkliches Wesen zu verstehen: nach der Trinitätslehre das göttliche Wesen. Daß es Sinn genannt wird, versteht sich daraus, daß es das göttliche Wesen als verstandenes ist, als Gehalt der göttlichen Erkenntnis, als ihr »geistiger Sinn«. Es kann auch Wort genannt werden, weil es der Inhalt dessen ist, was Gott spricht, der Gehalt der Offenbarung, also sprachlicher Sinn; noch ursprünglicher: weil der Vater sich darin ausspricht und es durch sein Sprechen hervorbringt. Dieser Sinn aber ist wirklich, und es ist nicht möglich, sein wesenhaftes von seinem wirklichen Sein zu trennen, weil das ewige Sein wesenhaft wirklich ist und als das erste Sein Urheber alles Seins. Daß sein wesenhaftes Sein nicht angefangen haben kann, das liegt schon im wesenhaften Sein und im Sinn als solchen. Es ist aber auch vom göttlichen Geist her zu verstehen. Das wirkliche (= aktuelle) Sein des Geistes ist Leben und ist lebendiges Verstehen. Gott als »reiner Akt« ist wandellose Lebendigkeit. Geistiges Leben, Verstehen ist aber nicht möglich ohne einen Gehalt, ohne »geistigen Sinn«. Und dieser Sinn muß gleich ewig und gleich wandellos sein wie der göttliche Geist selbst. Ist es überhaupt möglich, auch nur gedanklich das wesenhafte Sein des ΛόγοϚ von seinem wirklichen Sein zu trennen, wie es bei dem endlichen Wesen möglich ist? Die Dreifaltigkeit als solche scheint eine derartige Trennung zu bedeuten. Der Sohn wird als gleich-ewig (coaeternus) mit dem Vater bezeichnet, aber als »vom Vater erzeugt«, und das besagt, daß er sein ewiges Sein vom Vater empfängt. Das göttliche Wesen ist eines, kann also nicht als erzeugt bezeichnet werden. Was erzeugt wird, ist die zweite Person, und das Sein, das sie damit empfängt, kann nicht das wesenhafte Sein des göttlichen Wesens sein, sondern nur sein Wirklichsein in einer zweiten Person. Weil die Person des Sohnes und ihr Wirklichsein etwas »Neues« ist gegenüber der Person des Vaters, darum kann man von ihr auch sagen, daß sie das Wesen empfängt. Aber das Wesen empfängt nicht sein wesenhaftes Sein. Selbst das ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ ΛόγοϚ läßt eine solche Deutung zu, wenn wir an die Bedeutung denken, die ἀρχή in der griechischen Philosophie hat. Es ist ja nicht »Anfang« als »Beginn der Zeit«, sondern das »erste Seiende«, das Ur-Seiende. So bekommt der geheimnisvolle Satz den Sinn: Im ersten Seienden war der Logos (der »Sinn« oder »das göttliche Wesen«) – im Vater der Sohn –, der Sinn vom Ur-Wirklichen umschlossen. Die »Zeugung« bedeutet die Setzung des Wesens in die neue Person-Wirklichkeit des Sohnes, die allerdings keine Hinaus-Setzung aus der Ur-Wirklichkeit des Vaters ist.
Die bildlichen Redewendungen, die zur Herausstellung des Verhältnisses zwischen den göttlichen Personen gebraucht werden, klingen fast so, als sollte man nicht nur eine gedankliche, sondern sogar eine wirkliche Trennbarkeit von wesenhaftem und wirklichem Sein annehmen. (Tatsächlich kann das nicht in Frage kommen, weil es sich ja bei beiden um ewiges Sein handelt.) Andererseits scheint die Auflassung des ersten Seienden als des Seienden, dessen Wesen das Sein ist, nicht einmal eine gedankliche Trennung zuzulassen. Die Untrennbarkeit des Wesens vom wirklichen Sein war es, durch die der hl. Thomas das erste Seiende von jedem anderen schied. Alles Endliche empfängt sein Sein (wir müssen nach unserer Auffassung sagen sein wirkliches Sein) als etwas zu seinem Wesen Hinzukommendes. Damit ist eine wirkliche Trennbarkeit von Wesen und wirklichem Sein ausgesprochen. Das wesenhafte Sein schien uns vom Wesenswas nicht wirklich, aber wohl gedanklich trennbar. Wenn aber das erste Seiende das Sein zum Wesen hat, dann ist es unmöglich, es auch nur ohne das Sein zu denken. Es bliebe nichts übrig, wenn man das Sein wegdächte – kein Was, als das man das Nicht-Seiende denken könnte. Was, Wesen und Sein sind hier nicht zu unterscheiden. Wenn man diesen Gedanken in aller Klarheit zu fassen vermöchte, so hätten wir darin die Grundlage für einen »ontologischen Gottesbeweis«, die noch tiefer läge und noch einleuchtender wäre als der Gedanke des ens »quo nihil majus cogitari possit«, des denkbar vollkommensten Wesens, von dem der hl. Anselmus ausgeht. Man könnte es freilich nicht eigentlich einen »Beweis« nennen. Wenn man sagt: Gottes Sein ist sein Wesen; Gott ist nicht ohne das Sein denkbar; Gott ist notwendig, so liegt nicht eine eigentliche Folgerung, sondern nur eine Umformung des ursprünglichen Gedankens vor. Die Richtigkeit dieser Umformung wird auch von dem hl. Thomas, der den ontologischen Beweis Anselmus' bekanntlich abgelehnt hat, nicht bestritten. Er gibt zu, daß der Satz »Es gibt einen Gott« an sich unmittelbar einleuchtend sei, weil Gott sein Sein ist. »Weil wir aber nicht wissen, was Gott ist, so ist der Satz vom Dasein Gottes für uns nicht unmittelbar einleuchtend (oder selbst-verständlich), muß vielmehr bewiesen werden aus den Wirkungen Gottes, die zwar der Ordnung der Natur nach später als die Ursache, also weniger selbst-verständlich, unserm Erkennen aber früher gegeben als die Ursache, also leichter zugänglich sind.« Ohne Zweifel ist es uns nicht selbstverständlich, Gott als »den Seienden« oder gar als »den, dessen Wesen das Sein ist«, zu denken. Es ist der Weg der Gottesbeweise von den Wirkungen her, auf dem Thomas zu diesem Gedanken emporführt. Wenn man diesen Gedanken gefaßt hat, so ergibt sich die Notwendigkeit des göttlichen Seins unausweichlich. Aber können wir diesen Gedanken wirklich fassen? »Si comprehendis, non est Deus«, sagt Augustinus. (Wenn du begreifst, so ist es nicht Gott.) Und »… mit welcher Kraft der Einsicht faßt der Mensch Gott, da er diese Kraft der Einsicht selber, mit der er Ihn fassen will, noch nicht faßt?« Wenn wir sagen: Gottes Sein ist sein Wesen, so können wir damit wohl einen gewissen Sinn verbinden. Aber wir gelangen zu keiner »erfüllenden Anschauung« dessen, was wir meinen. Ein Wesen, das nichts anderes ist als Sein, können wir nicht fassen. Wir rühren gerade noch daran, weil unser Geist über alles Endliche hinauszielt – und durch das Endliche selbst dahin geführt wird, darüber hinauszuzielen – auf etwas, was alles Endliche in sich begreift, ohne sich darin zu erschöpfen. Kein Endliches vermag ihn zu erfüllen, auch alles Endliche zusammengenommen nicht. Aber das, was ihn zu erfüllen vermöchte, vermag er selbst nicht zu fassen. Es entzieht sich seiner Anschauung. Der Glaube verheißt uns, daß wir es im Glorienlichte schauen werden. So oft wir uns hier seiner zu bemächtigen suchen, bekommen wir immer nur ein endliches Gleichnis zu fassen – ein Endliches, in dem Was, Wesen und wirkliches Sein auseinanderfallen.
Читать дальше