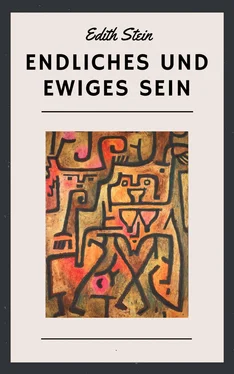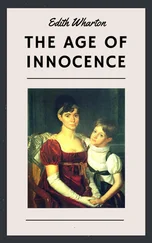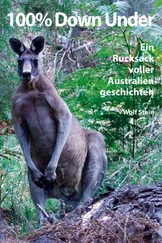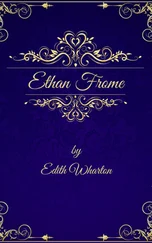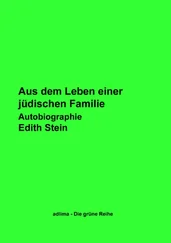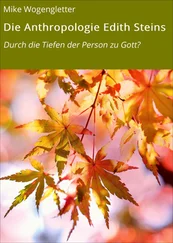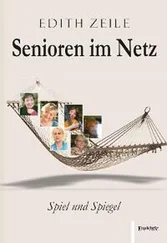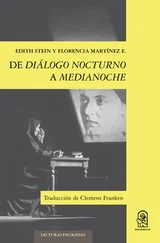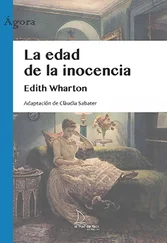In dieser dem Menschengeist eigenen Paradoxie, seinem Ausgespanntsein zwischen Endlichkeit und Unendlichkeit, scheint mir das eigentümliche Schicksal des ontologischen Gottesbeweises begründet: daß sich immer wieder neue Verteidiger und immer wieder neue Gegner für ihn finden. Wer bis zu dem Gedanken des göttlichen Seins – des Ersten, Ewigen, Unendlichen, des »reinen Aktes« – vorgedrungen ist, der kann sich der Seinsnotwendigkeit, die darin eingeschlossen ist, nicht entziehen. Sucht er es aber zu fassen, wie man erkenntnismäßig etwas zu fassen pflegt, so weicht es vor ihm zurück und erscheint nicht mehr als ausreichende Grundlage, um darauf das Gebäude eines Beweises zu errichten. Dem Gläubigen, der im Glauben seines Gottes gewiß ist, erscheint es so unmöglich, Gott als nichtseiend zu denken, daß er es zuversichtlich unternimmt, selbst den »insipiens« vom Dasein Gottes zu überzeugen. Der Denker, der den Maßstab der natürlichen Erkenntnis anlegt, schrickt immer wieder vor dem Sprung über den Abgrund zurück. Aber ergeht es den Gottesbeweisen a posteriori, den Schlüssen von den geschaffenen Wirkungen auf eine ungeschaffene Ursache, viel besser? Wieviel Ungläubige sind denn schon durch die thomistischen Gottesbeweise gläubig geworden? Auch sie sind ein Sprung über den Abgrund: der Gläubige schwingt sich leicht hinüber, der Ungläubige macht davor halt.
Um wieder auf unsere Fragen zurückzukommen: Zweifellos ist in der Gleichsetzung des göttlichen Seins und des göttlichen Wesens die gedankliche Untrennbarkeit beider und damit zugleich die Untrennbarkeit von wesenhaftem und wirklichem Sein in Gott ausgesprochen: Gottes wesenhaftes Sein ist das wirkliche, ja das allerwirklichste Sein: der reine Akt. Aber weil Gott für uns weder als Sein noch als Wesen faßbar ist, weil wir uns Ihm immer nur mit Hilfe endlicher »Abbilder« nähern, in denen Sein und Wesen getrennt ist, so geschieht diese Annäherung bald von der Seite des Wesens, bald von der Seite des Seins her, und darum sprechen wir wie von etwas Getrenntem von dem, was an sich nicht trennbar ist.
Wie ist aber diese Untrennbarkeit vereinbar mit der Trennbarkeit, die uns durch die Trinitätstheologie nahegelegt schien? Kann ich die Personen und ihr unterschiedenes Personsein vom göttlichen Wesen trennen, wenn Wesen und Sein untrennbar ist? Ich sehe keine andere Lösung, als daß das Sein in drei Personen selbst als wesenhaft zu betrachten ist. Damit wird freilich auch die Trennbarkeit von Wesen und Sein, wesenhaftem und wirklichem Sein beim Logos zu einer bloßen Gleichnisrede. Aber wie könnten wir anders als in Gleichnissen von dem größten aller Glaubensgeheimnisse sprechen?
Diese Gleichnisreden führen uns nun auch zum Verhältnis des göttlichen Logos zum »Sinn« der endlichen Wesen. Wir fanden den Namen »Logos« für die zweite göttliche Person darin begründet, daß er das göttliche Wesen als erkanntes, als das vom göttlichen Geist umfaßte, zum Ausdruck bringt. Das sind Gleichnisreden, die vom menschlichen Erkennen und Benennen endlicher Dinge hergenommen sind. Wir weisen dem Logos in der Gottheit die Stelle zu, die dem »Sinn« als dem sachlichen Gehalt der Dinge und zugleich als dem Gehalt unserer Erkenntnis und Sprache im Bereich des uns Faßbaren entspricht. Das ist die analogia, die Übereinstimmung-Nichtübereinstimmung, zwischen ΛόγοϚ und λόγοϚ, Ewigem Wort und Menschenwort. Es wird aber in den Schriftstellen, die wir heranzogen, nicht nur eine Gleichnisbeziehung behauptet, die es uns ermöglicht, »das unsichtbare Wesen Gottes … durch das, was geschaffen ist, verstehend zu erschauen, sondern es wird ausgesprochen, daß das Geschaffene durch den Logos geschaffen sei und in Ihm Zusammenhang und Bestand habe. Was gemeint ist, wird auch noch erläutert durch die Lesart von Joh. 1, 3–4, die im Mittelalter üblich war. Wir lesen heute: »… sine ipso factum est nihil, quod factum est.« – »… ohne Ihn (den Logos) ist nichts gemacht worden, was gemacht ist.« Damals verband man: »Quod factum est, in ipso vita erat.« – »Was gemacht worden ist, war in Ihm Leben.« Damit scheint ausgesprochen, daß die geschaffenen Dinge im göttlichen Logos ihr Sein – und zwar ihr wirkliches Sein – haben. In der so gedeuteten Schriftstelle ist offenbar die »augustinische« Auffassung der Ideen als »schöpferischer Wesenheiten im göttlichen Geist« vorgebildet.
Wie wir das Sein der Dinge im Logos nicht zu verstehen haben, das ist in einer kirchlichen Lehrentscheidung ausgesprochen: Die geschaffenen Dinge sind nicht in Gott wie die Teile im Ganzen, und das wirkliche Sein der Dinge ist nicht das göttliche Sein, sondern ihr eigenes, vom göttlichen unterschiedenes. Was kann dann ihr »Bestand und Zusammenhang« im Logos bedeuten? Versuchen wir zunächst das con-stare, das Zusammen der Dinge im Logos zu verstehen. Es besagt offenbar die Einheit alles Seienden. Unsere Erfahrung zeigt uns die Dinge als in sich geschlossene und voneinander getrennte Einheiten, allerdings in wechselseitigen Abhängigkeitsbeziehungen, die uns zu dem Gedanken eines allgemeinen ursächlichen Zusammenhanges aller wirklichen Dinge hinführen. Aber der ursächliche Zusammenhang erscheint wie etwas Äußeres. Wenn wir den Aufbau der dinglichen Welt zu erforschen suchen, so stoßen wir wohl darauf, daß es im Wesen der Dinge begründet ist, in welche ursächlichen Zusammenhänge sie eintreten können; andererseits sind es die ursächlichen Zusammenhänge, die uns etwas vom Wesen enthüllen. Beides zeigt aber, daß das Wesen etwas Tieferliegendes ist als die ursächlichen Zusammenhänge. So bedeutet der allgemeine ursächliche Zusammenhang noch keinen allgemeinen Sinnzusammenhang aller Dinge. Dazu kommt noch, daß die Gesamtheit aller wirklichen Dinge noch nicht alles endliche Seiende überhaupt umschließt. Zur Gesamtheit alles Seienden gehört auch vieles »Unwirkliche«: Zahlen, geometrische Gebilde, Begriffe u. a. m. Sie alle werden von der Einheit des Logos umschlossen. Der Zusammenhang, in dem »alles« im Logos steht, ist als die Einheit eines Sinn-Ganzen zu denken.
Der Zusammenhang unseres eigenen Lebens ist vielleicht am besten geeignet, um zu veranschaulichen, was gemeint ist. Man unterscheidet in der gewöhnlichen Redeweise »Planvolles« – und das gilt zugleich als »sinnvoll« und »verständlich« – und »Zufälliges«, was in sich sinnlos und unverständlich erscheint. Ich habe ein bestimmtes Studium vor und suche mir dafür eine Universität aus, die mir besondere Förderung in meinem Fach verspricht. Das ist ein sinnvoller und verständlicher Zusammenhang. Daß ich in jener Stadt einen Menschen kennen lerne, der »zufällig« auch dort studiert, und eines Tages »zufällig« mit ihm auf weltanschauliche Fragen zu sprechen komme, erscheint mir zunächst nicht durchaus als verständlicher Zusammenhang. Aber wenn ich nach Jahren mein Leben überdenke, dann wird mir klar, daß jenes Gespräch von entscheidendem Einfluß auf mich war, vielleicht »wesentlicher« als mein ganzes Studium, und es kommt mir der Gedanke, daß ich vielleicht »eigens darum« in jene Stadt »gehen mußte«. Was nicht in meinem Plan lag, das hat in Gottes Plan gelegen. Und je öfter mir so etwas begegnet, desto lebendiger wird in mir die Glaubensüberzeugung, daß es – von Gott her gesehen – keinen »Zufall« gibt, daß mein ganzes Leben bis in alle Einzelheiten im Plan der göttlichen Vorsehung vorgezeichnet und vor Gottes allsehendem Auge ein vollendeter Sinnzusammenhang ist. Dann beginne ich mich auf das Licht der Glorie zu freuen, in dem auch mir dieser Sinnzusammenhang entschleiert werden soll. Das gilt aber nicht nur für das einzelne Menschenleben, sondern auch für das Leben der ganzen Menschheit und darüber hinaus für die Gesamtheit alles Seienden. Ihr »Zusammenhang« im Logos ist der eines Sinn-Ganzen, eines vollendeten Kunstwerkes, in dem jeder einzelne Zug sich an seiner Stelle nach reinster und strengster Gesetzmäßigkeit in den Einklang des gesamten Gebildes fügt. Was wir vom »Sinn der Dinge« erfassen, was »in unseren Verstand eingeht«, das verhält sich zu jenem Sinnganzen wie einzelne verlorene Töne, die mir der Wind von einer in weiter Ferne erklingenden Symphonie zuträgt. In der Sprache der Theologen heißt der Sinnzusammenhang alles Seienden im Logos der »göttliche Schöpfungsplan« (ars divina). Das Weltgeschehen von Anbeginn ist seine Verwirklichung. Hinter diesem »Plan« aber, hinter dem »künstlerischen Entwurf« der Schöpfung, steht (ohne davon seinsmäßig getrennt zu sein) die ewige Fülle des göttlichen Seins und Lebens.
Читать дальше