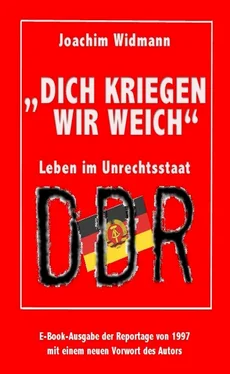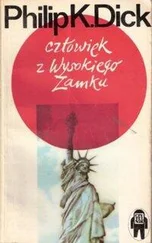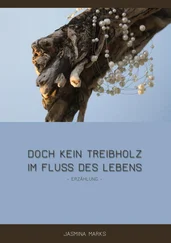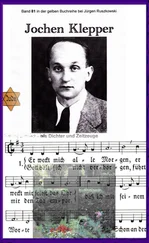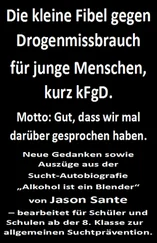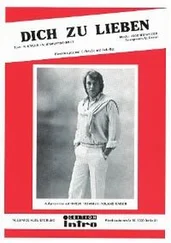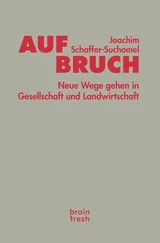Joachim Widmann - Dich kriegen wir weich
Здесь есть возможность читать онлайн «Joachim Widmann - Dich kriegen wir weich» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Dich kriegen wir weich
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Dich kriegen wir weich: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Dich kriegen wir weich»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Neuausgabe des Originals von 1997 zum 25. Jahrestag der deutschen Einheit. Mit neuem Vorwort des Autors zur Debatte über die Bezeichnung «Unrechtsstaat» für die DDR.
Dich kriegen wir weich — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Dich kriegen wir weich», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Sie wurde abgeführt. Acht Jahre lang sollte sie das Haus ihrer Eltern nicht wieder betreten.
Erst 1949 erfuhr ihre Familie, daß Anneliese Fricke zumindest bis Frühjahr 1948 nicht in die Sowjetunion deportiert worden war. Eine Haftentlassene überbrachte die Nachricht. Eine erste, zensierte Postkarte als Lebenszeichen konnte Anneliese Fricke erst Ende 1949 nach Hause schicken. Und am 30. Oktober 1950, nach drei Jahren, durfte ihr Vater sie zum ersten Mal im Zuchthaus Hoheneck besuchen. Allein, denn nur ein Familienmitglied war erlaubt.
Martha Rex erhielt sieben Jahre nach der Internierung von Gottlieb Leichnitz, 1953, gemeinsam mit ihrer Mutter Besuchserlaubnis im Zuchthaus Waldheim. Marthas drei Brüder und ihre Schwester mußten zu Hause in Alt-Zeschdorf bleiben. So wurden sie nicht Zeugen der düsteren Szene: „Wir durften einander nur mit den Fingerspitzen berühren. Posten standen dabei. Wir fragten: ,Wann kommst Du nach Hause? Wir brauchen Dich doch!‘“ Doch die Posten sorgten dafür, daß Leichnitz nicht mit seiner Familie sprach. Einige Minuten lang sah man sich trostlos über eine Barriere hinweg an, dann mußten die Besucher gehen.
Als der Eisenbahner Erhard Hemmerling im Oktober 1951 verschwand, blieb seine 23jährige Frau Vera mit zwei kleinen Kindern zurück. Erst nach Tagen brachte ihr jemand einen Zettel, auf den ihr Mann geschrieben hatte: „Ich bin bei der Stasi in der Halben Stadt in Frankfurt“.
Er hatte sich in den Finger geritzt und den Kassiber mit Blut geschrieben, um ihn dann aus dem Fenster des Kellers, in dem er festgehalten wurde, auf den Gehweg zu werfen. Eine offizielle Nachricht erhielt Vera Hemmerling nie.
Die junge Frau ging zur Staatsanwaltschaft, zur Polizei und schließlich zur Staatssicherheit. Da hätte man ihr sagen können, daß ihr Mann sich mittlerweile in den Händen der Sowjets befand. Statt dessen bekam sie zu hören: „Ihr Mann ist abgehauen. Sie sollten sich scheiden lassen.“ Vera Hemmerling: „Das war die größte Zumutung. Ich wußte schließlich besser, wie wir zusammenleben, daß mein Mann seine Familie nie im Stich gelassen hätte. Nach fünf Jahren, die wir glücklich verheiratet waren, glaubte ich nicht, daß er abgehauen war.“
Aus der schönen Bahnhofsvorsteher-Dienstwohnung, die die Familie in Rehfelde bewohnt hatte, mußte Vera Hemmerling mit den Kindern bald ausziehen. Sie ging zu ihrer Mutter nach Frankfurt (Oder), arbeitete bei der Bahn.
Alles war, als hätte es Erhard Hemmerling nie gegeben.
Zu Fuß wurde Anneliese Fricke zur „Gelben Presse“ gebracht. „Da bin ich in den Keller gekommen. Da waren noch andere, alles junge Leute.“
Die Gefangenen mußten nach einigen Stunden auf Lkw steigen.
„Ich dachte sofort, es geht über die Oder. Es war mir völlig klar, daß es nach Osten geht.“ Sie hatten viel von Deportationen in die Sowjetunion reden hören: Das Schicksal vieler Internierter.
Doch die Fahrt ging landeinwärts. Nach einiger Zeit eine Stadt: Die Lkw stoppten. Ein Tor schloß sich hinter den Lastern. Die Frankfurter wurden „grob und laut“ von den Ladeflächen getrieben.
„Wir wurden gefilzt. Schnürsenkel und Gürtel wurden uns abgenommen. Ein Mann bettelte vergebens um seine Brille.“ Dann ging es ins Zellenhaus.
„Ich dachte: Wie im Kino. Wie ich da in die Zelle gesperrt wurde...“
Sie war allein. Die Zelle war leer bis auf eine eiserne Pritsche. Für die Notdurft gab es „eine Art Kochtopf“.
Anneliese Fricke war im „Lindenhotel“, der berüchtigten NKWD/MWD-Zentrale in der Potsdamer Lindenstraße.
Nachtruhe war von 22 bis 5 Uhr. Erst nach Tagen erhielt Anneliese Fricke einen Strohsack für die Pritsche. Sie empfand das als eine Gnade, eine besondere Vergünstigung: „Ich war völlig fertig.“
Tagsüber durfte sie sich nur stehen oder auf der Pritsche sitzen. Keinesfalls schlafen.
„Die Verhöre fanden grundsätzlich nachts statt. Die Verhörmethoden waren wirklich schlimm.“
Dazu möchte sie mehr nicht sagen.
Einer der 45 anderen Frankfurter, die im Herbst 1947 verhaftet worden waren, Jochen Stern, berichtet von Schlägen mit Holzknüppeln oder auch „mit der flachen Hand ins Gesicht“, begleitet von Vorwürfen: „Widerstand gegen Besatzungsmacht ... Verleumdung ... Ehre der Sowjetoffiziere besudeln ... Diesmal trugen sie mich in die Zelle.“
Ein weiteres Druckmittel war der Karzer: Mit nacktem Oberkörper in einer eisigen Zelle, nur jeden dritten Tag eine volle Ration, sonst nur wäßriger Kaffee. „Die Arme dicht am Körper angewinkelt, hockte ich auf dem zementierten Fußboden. In einer Doppelzelle, durch Gitterstäbe geteilt. Gleich einem Käfig.“ Am Tag nach seiner Befreiung aus dem Karzer unterschrieb Stern sein Geständnis: „Lauter Schauergeschichten.“ xvii
***
Stets mißtrauisch gegen den Dolmetscher – „Alles war auf Russisch. Ich war mir nie sicher, ob richtig übersetzt wurde. Ich wußte auch nicht, was ich unterschrieb“ –, legte Anneliese Fricke im Verhör die Dinge dar, wie sie gewesen waren. Ihr Name war mit denen der anderen Verhafteten in einem Notizbuch von Claus N. gefunden worden. Aber sie hatte ja die Zusammenarbeit mit ihm abgelehnt.
Eines Nachts, beim Verhör, stand N. plötzlich in der Tür. „Ein Bild des Grauens, genau wie die KZ-Gestalten in der Nazizeit.“
Der Vernehmer fragte: „Fricke, Anneliese, waren Sie Mitglied der Spionageorganisation von N., Claus?“
„Nein.“
„N., Claus, war Fricke, Anneliese Mitglied Ihrer Spionageorganisation?“
„Ja.“
Da faßte sich die Gefangene ein Herz: „Claus, hatte ich nicht wegen meiner Eltern gebeten, aus dem Spiel zu bleiben?“
Der Mann, abgemagert und offenbar ebenfalls endlosen, qualvollen Verhören ausgesetzt, nickte mühsam. Doch das spielte keine Rolle. Ein Geständnis wurde aufgesetzt, auf Russisch. „Erst wollte ich nicht unterschreiben.“
Man sagte drohend: „Sie wollen doch Ihre Eltern und ihre Geschwister wiedersehen...?“
Sie unterschrieb.
Im Frühjahr 1948 stand Anneliese Fricke im Vorderhaus des „Lindenhotels“ mit 27 anderen, darunter sieben Frauen, vor einem sowjetischen Militärtribunal, umringt von bewaffneten Posten mit Hunden. Viele der Mitangeklagten waren Bekannte: „Unvorstellbar, wie sich Menschen in einem halben oder Dreiviertel Jahr verändern können. Die Männer waren kahlgeschoren, alle sahen verhungert aus. Während der Untersuchungshaft waren schon einige gestorben aus unserem Fall.“
Die Anklagen wurden verlesen. „Ich habe die Klageschrift da zum ersten Mal auf Deutsch gehört.“
Der Prozeß, „eine reine Theaterveranstaltung“, dauerte mehrere Tage lang. Die Anklage konstruierte die Legende einer ungeheuren Spionagekonspiration in Frankfurt (Oder). Basis des Verfahrens war die Aussage, die Claus N. unter der Folter gemacht hatte, außerdem konnte das NKWD aus seinen Aufzeichnungen schöpfen. Denen zufolge hatte Anneliese Fricke einer Gruppierung mit dem Namen „Liberale Organisation“, die N. im Auftrag der Amerikaner angeblich leitete, über das Geschäft ihrer Familie Filme besorgt und selbst auch für N. fotografiert. Für jeden der anderen Angeklagten fanden sich ähnliche Verwicklungen in das angebliche Komplott gegen die sowjetischen Besatzer Ostdeutschlands.
Erhard Hemmerling (Jahrgang 1923) weiß bis heute nicht, was genau ihn in die Mühle der Geheimdienste geraten ließ. Er weiß, daß er kein Spion war. Doch das hatte in seiner Klageschrift gestanden. Genauer: Spionageverdacht. Nach Sowjetrecht war schon der strafbar – auf Basis der Kontrollratsdirektive 38.
Sicher: Er hatte den antistalinistischen Untersuchungsausschuß Freiheitlicher Juristen in West-Berlin um eine Rechtsauskunft ersucht. Sicher, er war nicht in die SED eingetreten, sondern, nach einigem Drängen von Vertretern der Staatspartei bei der Reichsbahn, in die Blockpartei NDPD, „um meine Ruhe zu haben“, wie er sagt.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Dich kriegen wir weich»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Dich kriegen wir weich» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Dich kriegen wir weich» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.