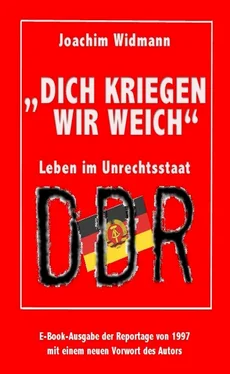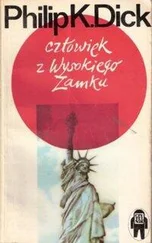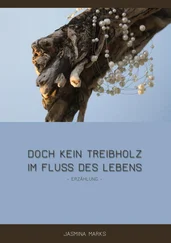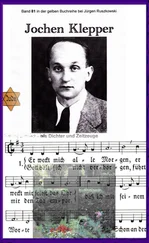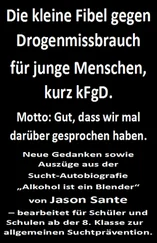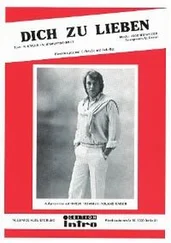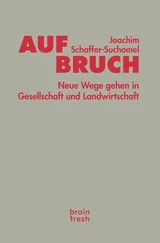Joachim Widmann - Dich kriegen wir weich
Здесь есть возможность читать онлайн «Joachim Widmann - Dich kriegen wir weich» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Dich kriegen wir weich
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Dich kriegen wir weich: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Dich kriegen wir weich»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Neuausgabe des Originals von 1997 zum 25. Jahrestag der deutschen Einheit. Mit neuem Vorwort des Autors zur Debatte über die Bezeichnung «Unrechtsstaat» für die DDR.
Dich kriegen wir weich — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Dich kriegen wir weich», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Nach der Vereinigung von KPD und SPD zur SED kamen Sozialdemokraten hinzu. Wer immer sich der unbedingt sowjettreuen Linie der neuen Einheitspartei widersetzte, mußte befürchten, unter Berufung auf Direktive 38 aus dem öffentlichen Leben entfernt zu werden.
Werner Schöne: „Sogar ehemalige KZ-Häftlinge waren im Internierungslager, Leute, die schon im Dritten Reich als Kommunisten eingesperrt waren.“
Die Hilfspolizisten aus Seelow brachten Schöne zum NKWD nach Frankfurt (Oder). Der Geheimdienst verfügte auch hier über eine Villa, die „Gelbe Presse“. Das Haus in der heutigen Puschkinstraße war im Volksmund nach dem damaligen Straßennamen benannt worden. Von dort aus kam Schöne ins berüchtigte Internierungslager Ketschendorf bei Fürstenwalde/Spree, das sowjetische Speziallager Nr. 5.
Das Internierungslager war die Arbeitersiedlung einer Fabrik, die im Mai 1945 einfach mit Stacheldraht umzäunt worden war. Es war überbevölkert. Die hygienischen Verhältnisse rangierten unter den schlechtesten im Vergleich mit anderen Lagern xiv; die Verpflegung reichte vielen Internierten nicht zum Leben. Die Menschen hausten in Kellerlöchern, kampierten auf Treppenabsätzen, mußten froh sein, überhaupt ein Dach über dem Kopf zu haben.
Die Siedlung, die aus sechs Häusern mit je neun Wohnungen bestand, war im Durchschnitt ständig mit 6 200 Männern und Frauen belegt. Etwa 5 000 Menschen starben in Ketschendorf. Man verscharrte sie in der Nähe der Autobahn Berlin-Frankfurt (Oder) in Massengräbern, die unkenntlich gemacht wurden. Als die heutige Siedlung Fürstenwalde-Süd 1952 erweitert werden sollte, mußten unter der Aufsicht des DDR-Ministeriums für Staatssicherheit 30 Lastwagenladungen Toter auf den Soldatenfriedhof Halbe im benachbarten Kreis Königs Wusterhausen gebracht werden xv.
Werner Schöne gehörte zu der Gefangenengruppe mit der höchsten Sterblichkeit. Von etwa 2 000 Jugendlichen, die in Ketschendorf interniert waren, überlebten nur die Hälfte. Im Februar 1947 wurde das Lager aufgelöst. Schöne, der dort bis Ende 1946, über ein Jahr lang, gefangen war: „Es mußte aufgelöst werden, sonst wäre keiner lebend mehr rausgekommen.“
Schöne wurde nach Neubrandenburg ins Lager Fünfeichen gebracht, in dem die Nazis bis Kriegsende Kriegsgefangene gefangengehalten hatten. Die Sowjets hielten dort bis September 1948 zeitweise bis zu 12 500 Menschen fest xvi.
In Neubrandenburg, dem Speziallager Nr. 9, assistierte Schöne als „Läufer“ der Leiterin des nördlichen Lagerabschnitts. „Ich wurde eingekleidet wie ein General. Mit alter deutscher Fliegeruniform und Schlips.“ Neben den neuen Kleidern brachte ihm diese Arbeit auch bessere Verpflegung ein, und Schöne war in der Stabsbaracke untergebracht. „Ich mußte extra Russisch dafür lernen. Aber wer hätte da schon Nein gesagt.“ Die Behandlung in Neubrandenburg sei „relativ menschlich“ gewesen.
1948 wurde auch dies Lager aufgelöst. Man brachte Schöne ins Speziallager Nr. 2 nach Buchenwald, in das ehemalige Konzentrationslager bei Weimar. Die Leitung war dieselbe wie in Ketschendorf, stellte er entsetzt fest. „Doch mittlerweile war alles viel organisierter.“ In Buchenwald wurden durchschnittlich zwischen 10 000 und 12 000 Menschen festgehalten.
Internierten gegenüber wurde nicht der geringste Anschein von Rechtsstaatlichkeit gewahrt. Es gab nicht nur sehr oft keinen Prozeß, sondern auch keinerlei Information, wie lange die Gefangenschaft dauern sollte. Schöne konnte bis zum 25. Januar 1950, als er zwei Wochen vor der Auflösung des Lagers endlich aus Buchenwald entlassen wurde, keine Nachricht nach Hause schreiben. Seine Familie hatte 1948 von einem entlassenen Mithäftling aus Neubrandenburg erfahren, daß er noch lebte – das war alles.
Als Gottlieb Leichnitz 1946 zur sowjetischen Kommandantur in Booßen bei Frankfurt (Oder) bestellt wurde, ahnte die Familie beim Abschied nicht, daß er achteinhalb Jahre lang von diesem Ausflug nicht zurückkommen würde.
Gleich nach Kriegsende war Leichnitz (1898-1980) aus der Gefangenschaft gekommen und hatte sich, da sich niemand sonst fand, widerwillig als Bürgermeister im ostbrandenburgischen Alt-Zeschdorf aufstellen lassen.
Eines Abends luden die sowjetischen Besatzer des Ortes zum Tanzvergnügen – oder besser: zwangen. Junge Frauen wurden zusammengeholt, Vater Leichnitz hatte am Klavier aufzuspielen, und die Russen sorgten dafür, daß der Alkohol in Strömen floß. „Die haben allen dauernd Schnaps eingegossen“, erzählt Leichnitz’ Tochter, Martha Rex (Jahrgang 1922).
Einer der Soldaten war schließlich so betrunken, daß er jede Hemmung verlor. Er packte Marthas um sieben Jahre jüngere Schwester. „Er wollte sie in den Keller bringen und vergewaltigen.“
Diesem Schicksal waren die Leichnitz-Töchter bis dahin entgangen. Als die Mutter und die Großmutter in den ersten Nachkriegstagen vergewaltigt wurden, hatten sie sich auf dem Dachboden verborgen.
„Mein Vater schlug den Kerl nieder, um ihn davon abzubringen. Der war dann auch friedlich. Aber er sagte zu meinem Vater: ,Du wirst noch an mich denken‘.“
Der Vorfall auf dem Tanzabend kann für die Internierung Leichnitz‘ durch den NKWD nur den letzten Ausschlag gegeben haben. Lokal- und Regionalpolitiker bildeten nach den Kriegsverbrechern – vermeintlichen wie echten – die zweite große Gruppe Internierter. Die NKWD-Befehle von 1945 ordneten die Verhaftung der „Leiter administrativer Organe auf Gebiets-, Stadt- und Kreisebene“ an. Daß nur Nazis in die Lager zu bringen seien, besagten die Befehle nicht. So kamen in den Jahren nach dem Krieg viele ostdeutsche Bürgermeister in Haft, deren einziges Vergehen gewesen war, Bürgermeister und nicht Kommunist zu sein.
Martha Rex: „Wir Kinder sind am Tag nach seinem Verschwinden zu Fuß losgegangen, um da die Wache zu fragen: ,Wo ist unser Vater?‘ ,Hier nix Vater‘, sagte man. Wir wußten nicht einmal, ob er noch lebte.“
„Für Eltern und Geschwister war die Ungewißheit fast schlimmer als für die Betroffenen selbst“, sagt Anneliese Abraham.
Sie war vor der Festnahme gewarnt worden: „Ich war mit Freunden im Sommer 1947 an der Ostsee gewesen, und auf der Rückfahrt im Zug kam jemand auf mich zu und flüsterte: Fahr’ nicht nach Hause, in Frankfurt gibt es eine Verhaftungswelle.“ Doch sie kehrte arglos zu ihren Eltern und ihren Geschwistern nach Frankfurt (Oder) zurück, wo die Familie seit Jahrzehnten ein Fotogeschäft betrieb und die damals 20jährige ihre Fotografenlehre absolviert hatte.
„In Frankfurt herrschte große Aufregung. Viele meiner Bekannten waren bei Nacht und Nebel abgeholt worden.“ Doch sie war nicht beunruhigt. „Ich hatte mir nichts vorzuwerfen.“
Viele junge Frankfurter setzten sich nach dieser ersten Verhaftungswelle nach West-Berlin ab. Nicht so die junge Fotografin, die damals noch ihren Mädchennamen, Fricke, trug. Frankfurt war Heimat, schon wegen der Familie.
„Ich wußte wohl, daß Claus N., ein Bekannter, irgendwie für die Amerikaner arbeitete. Er hatte mir das gesagt und mich gebeten, Fotokopien für ihn zu machen.“
Ihr sei damals „kindisch“ vorgekommen, daß N. Autonummern aufschrieb und weitergab, woraus die Amerikaner wohl auf Truppenbewegungen hätten schließen können. „Ich lehnte ab, um nicht meiner Familie Ärger einzuhandeln. So hatte ich später natürlich ein ganz ruhiges Gewissen. Auch noch, als der N. schon abgeholt war.“
Monate vergingen. Die Lage schien sich zu beruhigen. Von denen, die im August verschwunden waren, gab es keine Nachricht.
„Am 14. Oktober 1947 wurde ich früh um 5 Uhr von meinen Eltern geweckt. Zwei sowjetische Offiziere, ein deutscher Polizist und eine Dolmetscherin waren gekommen, mich abzuholen.“ Während sie im Flur warteten, zog sich Anneliese Fricke rasch an.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Dich kriegen wir weich»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Dich kriegen wir weich» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Dich kriegen wir weich» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.