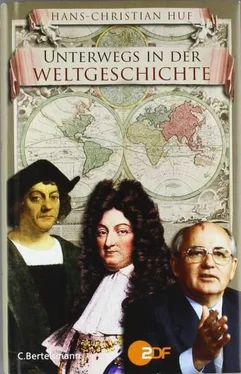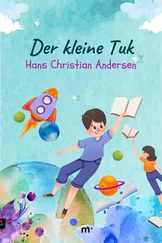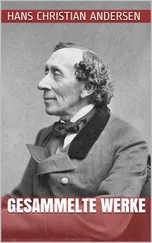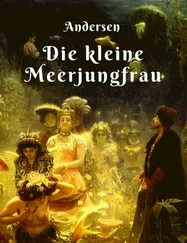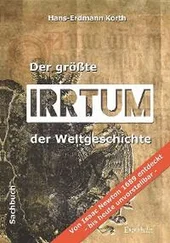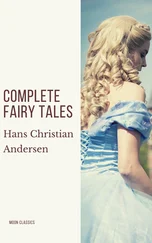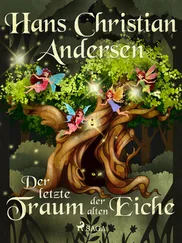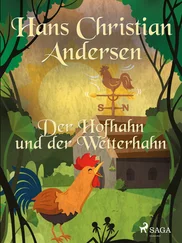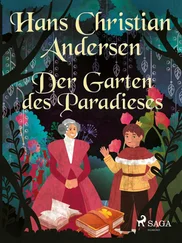Wir leben! Und das trotz jährlich neu angesagter Katastrophen: trotz der Kubakrise 1962, die die Welt an den Rand des atomaren Untergangs brachte. Trotz der düsteren Zukunftsszenarien des Club ofRome in den Siebzigerjahren. Trotz der letzten furchtbaren Kriege im Nahen Osten oder auch der schrecklichen Völkermorde in Afrika und auf dem Balkan. Trotz Klimawandel und Eisschmelze. Trotz Waldsterben, Schweinegrippe, AIDS und Terrorismus. Und immerhin wissen wir: Noch zu keiner Zeit gab es so wenig Kriegsopfer wie in der gegenwärtigen Welt, die wir jetzt von hier oben betrachten. Gewiss, immer noch sterben viel zu viele Menschen durch Gewalt und Kriege. Noch immer gibt es viel zu viel himmelschreiende Armut und ungelindertes Elend. Aber tatsächlich gab es kaum jemals eine friedlichere Zeit als heute.
Seit dem Jahr 2000 gelingen weltweit unglaublich viele Wohlstandsprojekte, vor allem in Asien, Indien und Südamerika, so rechnen uns die Statistiker des Weltwährungsfonds vor. Und auch was in den fünfzig Jahren davor geschah, war wirklich nicht immer zu beklagen: Mit der Bildung der Europäischen Gemeinschaft etwa gelang nach 1950 in nur ein paar Jahrzehnten die Zusammenführung und die Befriedung eines über Jahrhunderte kriegsverwüsteten Europa, wie es noch für unsere Urgroßeltern ganz unvorstellbar war. Auch Asien erholte sich vom japanischen Zusammenbruch. China stieg aus kolonialer Ausbeutung und Knechtschaft zu einer führenden Weltwirtschaftsmacht auf. Mit der Abrüstung in Ost und West geschah etwas geschichtlich Einmaliges: Noch niemals zuvor haben Völker ihre teuersten Waffen einfach unbenutzt verschrottet. Zum ersten Mal gelang es, einen Krieg, der bereits in den Köpfen vorbereitet war, einfach ausfallen zu lassen. Und mit Einrichtung der UNO in New York wurde endlich, nach der tragischen Versagensgeschichte des Völkerbundes in den Dreißigerjahren, ein halbwegs funktionierender Versuch gemacht, die Völker dieser Welt zu einer friedlichen Koexistenz anzuleiten.
Von den enormen überraschenden Technikfortschritten ganz zu schweigen, gerade auch im Bereich von Medizin, Lebenszeitverlängerung und »Care-Providing«, einem Begriff, unter dem in Zukunft alle Instandhaltungsdienstleistungen, auch die am Menschen, gebündelt werden. Die Fachleute nennen die ungewöhnlich vielen technischen Meilensteine, die in den letzten dreißig Jahren die Welt revolutionierten, »disruptive Innovationen«, wie etwa den Supraleiter, den Computerchip, das Internet oder neuerdings auch das iPhone , das die weltweite Kommunikation von Grund auf verändert. Seit Kurzem zählt auch schon die sogenannte »Greenobalisierung« dazu, die rasante Entwicklung weltweiter Umwelt- und Recycling-Technologien, die in den kommenden Jahren einen gewaltigen Boom erleben werden, wie es viele Zukunftsforscher voraussagen. »Die nächste industrielle Revolution wird grün sein!«, so sind sich viele Ökonomen sicher. Und die Welt der Elektroautos und CO2 -freier Energien wird eine schönere werden.
Selbst die Bankenkrise wird inzwischen von vielen als Chance zur positiven und notwendigen Veränderung begriffen. Analytiker sehen diesen Crash vor allem als das Ergebnis einer veralteten, hierarchisch geprägten Finanzwelt, die ihr Risiko-Verhalten nach frühkapitalistisch-männlichen Maßstäben ausrichtet. Aber weltweit seien längst »weibliche« Lösungsstrategien in Politik, Kultur und Wirtschaft auf dem Vormarsch: Intuition, emotionale Intelligenz, Kooperationsbereitschaft, Risikovermeidung.
Der soziodemografische Wandel und die neuen Arbeitsbedingungen einer globalisierten Welt zwingen zu intensiven Beziehungskonzepten. Wirtschaftliche Verflechtungen aber sind der Königsweg zur Förderung des Weltfriedens. Dabei werden in der Arbeitswelt lebenslange Firmenbindung, starre Hierarchien und lineare, frustrierende Arbeitsabläufe abgelöst werden durch Selbstständigkeit, schöpferische Gestaltung und »Multijobbing«. Die Zukunftsfähigkeit von Arbeitsangeboten wird sich bald schon daran bemessen, inwieweit es einem Unternehmen in einer immer stärker automatisierten Welt gelingt, den Arbeitnehmern kreatives, motivierendes Potenzial zur Selbstverwirklichung anzubieten. Derart kreative und lebensnahe Jobs ermöglichen dann auch die freiwillige Fortführung der Arbeit über das 65. Lebensjahr hinaus.
Vor der Auslagerung von Dienstleitungen und Produktionsabläufen in Billiglohnländer wie China, Brasilien oder Indien braucht sich bald niemand mehr zu fürchten, so belegt eine neueste Untersuchung des Wiener »Zukunftsinstituts«: Weil die Löhne in den Schwellenländern bereits kontinuierlich steigen, Transportkosten aber aufgrund von Energie- und Umweltauflagen immer höher ausfallen, wird es zu einer Rücklagerung der Arbeitsplätze kommen. China und Indien werden keineswegs mit dauernden Dumpinglöhnen die Weltwirtschaft dominieren, denn bereits der nächste asiatische oder indische Boom dürfte von einer anspruchsvolleren Mittelschicht betrieben werden und nicht, wie bisher, von verarmten Wanderarbeitern, denen jeder Arbeitsplatz recht ist. Auch in den Schwellenländern steigen die Ansprüche der Arbeitnehmer, zumal da weltweite Medien den Standard des Westens ständig vor Augen führen. Besonders China wird damit beschäftigt sein, viele hausgemachte, in der Eile des Aufschwungs bislang »übersehene« Probleme zu meistern: den vermehrten Umweltverbrauch, die ethnischen Spannungen und vor allem auch die Probleme, die auf eine schnell alternde, relativ geburtenschwache Nation zukommen, die bis jetzt keine Altersversicherung und kein zukunftsträchtiges Gesundheitssystem kennt.
Und noch ein wesentliches gesellschaftliches Verhalten sehen die Zukunftsforscher in positivem Wandel: Hatte man nach dem Zweiten Weltkrieg in allen führenden Industriestaaten auf gigantische Produktionssteigerung, wirtschaftlichen Aufschwung und vermehrten Konsum gesetzt, so scheint mit der Jahrtausendwende eine langfristige Trendumkehr eingeläutet: Der Jagdtrieb der Konsumenten im Sinne einer »Geiz-ist-geil«-Mentalität erschlafft. Der moderne Mensch wird es allmählich leid, nur noch und ausschließlich als Konsument verstanden zu werden, zu dem ihn die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts gemacht hat. Von der Rückkehr zu geistig-kulturellen Werten, einer »Back-to-Basic«-Strategie, versprechen sich nicht nur satte Wohlstandsbürger eine Reduktion ihres Alltagsstresses, sondern ganz messbar wächst weltweit der Sinn für die altbekannte Tatsache, dass der Mensch eben nicht vom Brot allein lebt.
Noch etwas ist gerade dabei, die Welt zum Guten zu revolutionieren: Die Speicherung und Weitergabe von Informationen wird durch die neuen technischen Möglichkeiten radikal entgrenzt und demokratisiert. In Zukunft wird es für Politiker und sonstige Machthaber kaum mehr möglich sein, Dinge zu tun, die unentdeckt bleiben oder bei denen sie auf dauernde Verschleierung hoffen dürfen. Sogar die unvergleichlichen Gräueltaten eines Adolf Hitlers wären wahrscheinlich anders verlaufen, wenn vor siebzig Jahren die enorm wachsende mediale Transparenz für ihn und seine Spießgesellen schon absehbar gewesen wäre. Denn liest man in den historischen Dokumenten, was Hitler am 22. August 1939 unmittelbar vor Kriegsbeginn seinen fünfzig Generälen aller Waffengattungen auf dem Obersalzberg unverblümt diktierte, muss man daraus schließen, dass Hitler tatsächlich davon ausging, sein furchtbarer Völkermord würde im Bewusstsein der Menschen schnell verblassen und letztlich ungesühnt bleiben. Schon damals benannte er seine bereits in »Mein Kampf« klar definierte Absicht der »Schaffung neuen Lebensraums im Osten für die arische Rasse« als eigentliches Kriegsziel, für das es notwendig sei, »einstweilen nur im Osten Mann, Weib und Kind polnischer Abstammung und Sprache in den Tod zu schicken«. Und er fügte hinzu: »Wer redet heute noch über die Vernichtung der Armenier?!«, also den Völkermord, den das Os-manische Reich in den Jahren 1915 bis 1917 an bis zu 1,5 Millionen Armeniern begangen hatte. Nebst der Tatsache, dass die Führung der Deutschen Wehrmacht Hitlers verbrecherische Pläne von Anfang an gekannt hat, machen diese Worte deutlich: Hitler rechnete offenbar mit der Möglichkeit eines ungestraften Genozids - eine Hoffnung, die sich zuletzt sogar noch in Politiker- und Generalsköpfen in den Kriegen Ex-Jugoslawiens halten konnte, die aber angesichts der neuen medialen Möglichkeiten glücklicherweise keiner Realität mehr entspricht.
Читать дальше