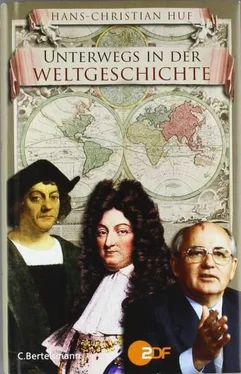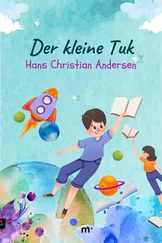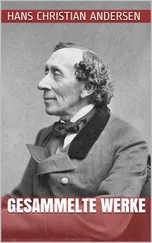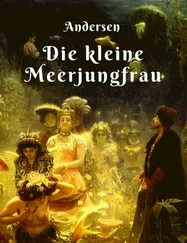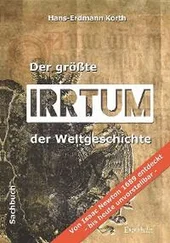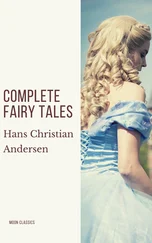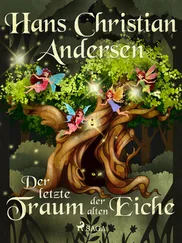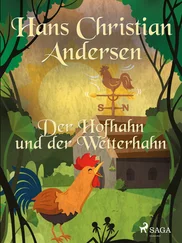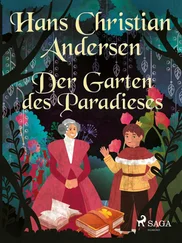Die Welt wurde damals verteilt unter den »Starken«. Kaum hundert Jahre ist das jetzt her. Und die Tatsache, dass damals kaum ein Mensch Anstoß daran nahm, lässt erahnen, wie anders doch die Welt war vor den großen Katastrophen des 20. Jahrhunderts. Und wie schnell sich Zeiten und Verhältnisse ändern.
Das Land, das sich heute zur neuen führenden Weltmacht aufschwingt, war vor hundert Jahren noch das am meisten geschundene: China. Kaum eine imperialistische Nation, die sich nicht auf dieses appetitliche Filetstück stürzte. Von Norden fielen die Russen ein, vom Osten stürmte Japan heran, an den Küsten landeten englische, französische und schließlich auch deutsche Kriegs- und Handelsschiffe. Dass das Reich der Mitte eine uralte Nation war und bereits im 2. Jahrtausend v. Chr. ein funktionierendes Staatswesen besaß, imponierte den europäischen Newcomern und selbsternannten »Herrenvölkern« nicht im Geringsten.
Bereits Anfang des 19. Jahrhunderts hatte England China als idealen Absatzmarkt für Opium entdeckt, im Austausch für wertvolle Waren wie Seide und Tee, die es in großen Mengen von hier bezog, aber nicht mit kostbaren Silberdevisen bezahlen wollte. Viel lieber tauschte man gewinnbringend, wenn schon nicht gegen Glasperlen, so doch gegen Opium, das man aus Indien billigst bezog. Als die Chinesen die ruinöse Wirkung des Rauschgifts erkannten und ihre Handelsgrenze schließen wollten, erzwang England im Opiumkrieg 1840 -1842 die weitere Geschäftsbeziehung und heimste bei der Gelegenheit auch noch Hongkong ein. Das Geschäftsmodell machte halb China süchtig, aber die Dealer aus London wurden keineswegs von Skrupeln gequält.
Jeder Widerstand der »unzivilisierten Rassen« wurde rücksichtslos gebrochen. Als um 1900 ein Aufstand der traditionellen chinesischen Faustkämpfer losbricht, der als »Boxeraufstand« in die Geschichte eingegangen ist, sendet Kaiser Wilhelm II. eine internationale Strafexpedition nach China, der er martialische Worte mit auf den Weg gibt: »Pardon wird nicht gegeben, Gefangene werden nicht gemacht! ... Und so möge der Name Deutscher in China auf tausend Jahre durch euch in einer Weise betätigt werden, dass niemals wieder ein Chinese es wagt, einen Deutschen auch nur scheel anzusehen.«
Geht man heute am Westwall durch die musealen Reste, die an die erste große industriell geführte Völkerschlacht, den Ersten Weltkrieg, erinnern, dann ist man versucht, in sich selbst nachzuforschen, inwieweit nationales Pathos den eigenen Kopf verdrehen könnte. Aber kann man überhaupt, wenn man vom Ausgang des Ersten und Zweiten Weltkriegs weiß, der Spur dieses nationalen Taumels noch fühlend nachgehen und wirklich gerecht urteilen? »Jeder Schuss ein Russ, jeder Tritt ein Brit, jeder Stoß ein Franzos, jeder Klaps ein Japs«, so hatten sie es in geradezu kindlicher Unbe-darftheit gleich zu Kriegsbeginn auf Postkarten und Truppentransporter gekritzelt. Sie wussten nichts und hatten alles noch vor sich. Der Krieg bot ihnen in Zeiten gesellschaftlicher Desorientierung vermutlich eine wohltuende Option auf Klarheit und Durchblick. Wie schön war es doch, genau zu wissen, wo der Feind steht. Wie wärmend ist Gewissheit. Wie unerträglich Ziellosigkeit. Die große Erleichterung darüber, endlich ein gemeinsames gesellschaftliches Band knüpfen zu können, ist auch den Worten Kaiser Wilhelms vor dem Reichstag klar abzulauschen: »Ich kenne keine Parteien mehr. Ich kenne nur noch Deutsche!«
Ist es da Zufall, dass ausgerechnet in dieser Epoche die Darmstädter Firma Merck eine Droge auf den Markt bringt, die jedes Gefühl intensiv verstärkt und den Allmachtstaumel der Menschen rauschhaft befeuert: Kokain. Selbst ein so nüchterner Wissenschaftler wie Sigmund Freud schickt seiner Verlobten eine ganze Menge dieser »Trips«, um ihre Stimmung aufzuheitern, wie er sagt.
Es ist eine Zeit, in der man nach technischen Katapulten sucht, die in eine neue Welt schleudern sollen.
Ob unsere Köpfe und Herzen heute anders denken und fühlen? Das Bedürfnis nach Gemeinschaft und nationaler Zugehörigkeit scheint zur Grundausstattung aller Menschen zu gehören. Sich als Gruppe zu definieren heißt zumeist Gegensätze gegenüber anderen zu konstruieren. Es ist für Menschen schwer, ohne Krieg zu leben.
Es war ja damals keineswegs so, dass es nur verblendete Politiker waren, die nach den Schüssen von Sarajewo, welche den österreichischen Thronfolger töteten und damit an einem schönen Sommertag Ende Juli 1914 die Kettenreaktion des Untergangs auslösten, die allgemeine Kriegsbegeisterung entfachten. Der Erste Weltkrieg begann in fast allen europäischen Ländern als Volksbewegung. Als Volksfest. Man muss sich ins Gedächtnis rufen, dass selbst ein so feinsinniger Lyriker wie Rainer Maria Rilke am Tag der Mobilmachung über den Münchner Odeonsplatz rannte, laut rufend: »Endlich wieder ein neuer Gott!« Damit meinte er den Krieg, den neuen Krieg, den industriellen Krieg, den selbst die Sozialdemokraten begrüßten, ohne ihn zu kennen. Grobe Fahrlässigkeit oder kollektiver Wahn?
Nationales Gefühl in Überdosis wird zur gefährlichen Droge. Das ist die Erkenntnis, die von dieser Epoche ausgeht. Und es ist wohl nicht falsch, wenn man behauptet, dass damals jeder Politiker, der sich dem nationalen Sturm entgegengestemmt hätte, von der entfesselten Begeisterung des Volkes hinweggefegt worden wäre, ob in Deutschland, England oder in Frankreich. Die industrielle Gewalt dieses Krieges hat dann aber gleichwohl alle überrascht und geschockt. In den Materialschlachten bei Verdun wurde mehrmals an nur einem einzigen Tag so viel Munition verschossen, wie man im gesamten Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71 verbrauchte.
Am Ende liegen 17 Millionen Tote auf den Schlachtfeldern. Und Deutschland, dem nach Siegermanier die Alleinschuld an diesem europäischen Fiasko zugeschrieben wird, wird mit den Versailler Verträgen eine Reparationslast aufgebürdet, die alle Möglichkeiten des verwundeten Landes übersteigt. Zu Recht haben die Historiker in Hinblick auf den Ersten Weltkrieg von der »Ur-Katastrophe des 20. Jahrhunderts« gesprochen. Denn alles, was folgte, ist Konsequenz dieser Völkerschlacht, die das Ergebnis eines fahrlässigen nationalen Säbelrasselns war: die Oktoberrevolution in Russland, der sowjetische Kommunismus, die Inflation, die Weltwirtschaftskrise, der Aufstieg des Nationalsozialismus, der Faschismus, die strategische Blockbildung von Ost und West nach dem Zweiten Weltkrieg.

36. Der große Knall und die Kraniche
Diese herzzerreißende Geschichte kennt in Japan jedes Kind: Als die zehnjährige Sadako Sasaki im Jahre 1955 an Leukämie starb, hatte sie über 1600 Papier-Kraniche nach der japanischen Origami-Tradition gefaltet. Ihre beste Freundin hatte ihr zuvor davon erzählt, dass die Götter demjenigen seinen sehnlichsten Wunsch erfüllen würden, der es schaffe, mindestens tausend Kraniche zu basteln. Aber Sadakos Wunsch, einfach weiterleben zu dürfen, wurde ihr dennoch nicht erfüllt. Sie starb 1955 an den schrecklichen Spätfolgen eines Knopfdrucks, der nicht nur ihr Leben und das hunderttausend anderer vernichtete, sondern die Welt im Ganzen völlig veränderte.
Es war der Knopfdruck des amerikanischen Piloten Oberst Paul Tibbets, der am 6. August 1945 um 8 Uhr 15 an einem schwülheißen Sommertag in 9450 Metern Höhe über den Dächern Hiroshimas eine drei Meter lange Atombombe ausklinkte. Nach 45-sekündigem freiem Fall explodierte der 4000 Kilogramm schwere Stahlzylinder in 580 Metern Höhe. Ein Feuerball von über einer Million Grad Celsius ließ die Menschen und die traditionellen Holzhäuser im Umkreis eines Kilometers gleichsam verdampfen. Die nachfolgende Druckwelle machte innerhalb von einer Minute achtzig Prozent der Stadtfläche Hiroshimas dem Erdboden gleich. Noch in zehn Kilometern Entfernung vom Detonationszentrum setzten Temperaturen von 6000 Grad Celsius ganze Wälder in Brand. 92 000 Menschen starben sofort. Am Jahresende zählte man 130 000 Tote, zumeist Zivilisten, darunter zehn Prozent koreanische und chinesische Zwangsarbeiter. Aberzehntausende wurden wie Sadako Sasaki noch Jahrzehnte später Opfer des radioaktiven Fallouts, der sich zwanzig Minuten nach der Explosion als staubiges Leichentuch über Stadt und Umland legte.
Читать дальше