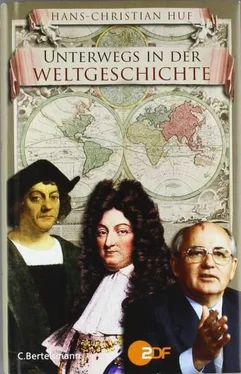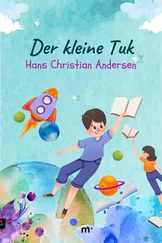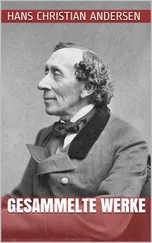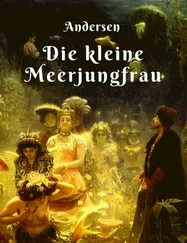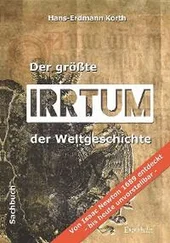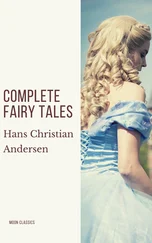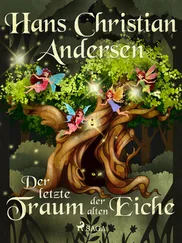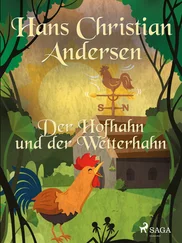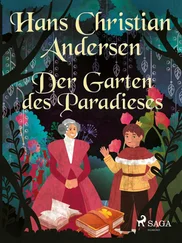Diese Bilder sind nicht nur geschichtliche Zeugnisse, sondern sie ragen direkt in unsere Gegenwart hinein. Sie sind nicht bloß Geschichte. Sie sind Aufgabe und Auftrag. Wegweiser für unsere Zukunft. Hinweis auf das, was zu tun ist.
Viel Unversöhnlichkeit, viel Hass, viel Fanatismus und bodenlose Brutalität haben das 20. Jahrhundert geprägt. Aber auch zahllose Ansätze und Impulse gibt es, die unsere Welt schöner, erträglicher, freundlicher machen könnten. Das 20. Jahrhundert ist zweischneidig: Große technische, zivilisatorische und humanitäre Fortschritte gibt es da; gleich daneben aber die gewaltigen Störfeuer schrecklicher Kriege, die in diesem Jahrhundert die unvorstellbare Zahl von mindestens 185 Millionen Gewaltopfern gekostet haben, wie es der ehemalige US-Präsident Jimmy Carter einmal hat hochrechnen lassen.
Wie enttäuschend müsste trotz aller Fortschritte das 20. Jahrhundert auf die frühen Aufklärer wirken, wenn sie heute, nach über 200 Jahren, zurück auf die Erde kämen. Auf den Philosophen Immanuel Kant etwa, der noch optimistisch erfüllt war von der Vision, dass die Menschheit mit der Entdeckung der Vernunft endlich allen Aberglauben und allen dummen Fanatismus abschütteln könnte. Dass Hexenwahn, Religionskriege und politischer Wahnsinn nach Jahrtausenden menschlicher Verirrung nun ihr Ende fänden und endlich der Verstand die Welt regieren würde. Wie absurd müsste es ihm erscheinen, dass ausgerechnet mit der vernunftgesteuerten Revision einer von schwersten Irrtümern geplagten Geschichte das blutigste Jahrhundert der gesamten Historie anbrechen sollte. Dass die Menschenverachtung vielerorts zum gesellschaftlichen Programm heranreifen würde. Und dass der religiöse Glaubensfanatismus in manchen Teilen der Welt so sehr erstarken würde wie im tiefsten Mittelalter. Wie konnte es dahin kommen? Wer sind wir, und warum sind wir so, wie wir sind? Das ist die Schlüsselfrage, die uns Menschen am Anfang des 21. Jahrhunderts vielleicht am nachhaltigsten beschäftigt und beschäftigen muss.
Man kann auch anders fragen: Wie viel Veränderung erträgt der Mensch? Vermag die Menschheit überhaupt mit der rasanten Entwicklung der letzten hundert Jahre Schritt zu halten, ohne dass es zu heftigen Verwerfungen kommt? Denn was uns Menschen im letzten Jahrhundert an revolutionären Erkenntnissen und Veränderungen geradezu überrollt hat, das spottet im Vergleich zu den vergangenen Epochen jeder Beschreibung.
Gesellschaftswissenschaftler haben einmal grob ausgerechnet, dass die Zahl der menschlichen Erfindungen in den vergangenen hundert Jahren den Gesamtbestand solcher Innovationen in den davor liegenden 40 000 Jahren übersteigt. Einen auch nur annähernd vergleichbaren Entwicklungsschub innerhalb von zwei, drei Generationen hat es niemals zuvor in der Menschheitsgeschichte gegeben. Und ganz gewiss müssen wir erst lernen, mit der tagtäglichen Neuerung, mit dem schnellen Ablegen überkommener Vorstellungen und Gewohnheiten und der Akzeptanz neuer Denkmodelle umzugehen. Wie schnell können wir uns verändern und anpassen, ohne dass es zur individuellen und gesellschaftlichen Havarie kommt?
»Bereitschaft zum Paradigmenwechsel« nennen die Wissenschaftler diese neue, von der Moderne geforderte Überlebensformel, die die alten festen Gewissheiten oft beunruhigend erschüttert und ein neues hohes Maß an Toleranz und Flexibilität verlangt - auch in Hinblick auf die neue Zumutung, dass selbst die größten Wahrheiten offenbar ein Verfallsdatum haben. Unsere Welt ist geistig, moralisch, ethisch unsicherer geworden. Was gestern unmöglich erschien, ist heute bereits große Mode. Alle Gewissheiten müssen in unserer globalisierten Welt tagtäglich neu ausgehandelt werden. In dem Rucksack, den der moderne Mensch auf seinen Schultern trägt, wiegt nicht allein die Geschichte schwer oder die Gegenwart mit ihren täglichen Problemen, sondern vor allem die Ungewissheit über ein Morgen, das vielleicht so ganz anders wird, als es das Heute ist.
Konstruktiv ertragen lässt sich diese neue existenzielle Unsicherheit nur auf dem Fundament solider Information, Bildung und halbwegs ausgeglichener Wirtschaftsstrukturen. Aber weltweit gelten immer noch nahezu eine Milliarde Menschen als Analphabeten. Und nach Zahlen der Welternährungsorganisation FAO leiden derzeit 925 Millionen täglich an Hunger und Unterernährung. Die Ohren dieser Menschen sind besonders offen für die Einflüsterungen fanatischer Hassprediger. Die Hauptaufgabe der Zukunft muss es sein, Armut zu beseitigen und Bildung zu schaffen. Demokratie gedeiht nur auf dem Fundament einer aufgeklärten Aufklärung.
Vor allem eines gehört ganz an die Spitze der To-do-Liste unserer Zukunft: Wir müssen uns selbst neu denken. Uns selbst müssen wir nachhaltig verändern, weniger die Welt, bei der es uns eher um Bewahrung gehen muss.
Einer radikalen Veränderung des Lebens geht meistens eine tief greifende Kränkung voraus. So hat es schon Sigmund Freud gewusst, der diesen Beichtstuhl der Moderne, seine »Couch«, auf der wir immer noch liegen, erfand, um ins Unbewusste vorzudringen und in das Dunkel unseres Seins zu leuchten.
Freud erkennt - fast bedauernd - an, dass die Neuzeit uns Menschen eine schwere, kaum zu bewältigende Last auf die Schultern gelegt hat: die tiefgreifende »Kränkung des Menschengeschlechts«. Der moderne Mensch, der selbst ernannte Chef-Erdenbürger gewissermaßen, müsse sich, so Freud, bereits seit Galileo Galilei damit abfinden, dass er und sein Erdkreis nicht mehr im Mittelpunkt des Universums stünden. Das sei eine fundamental neue Erfahrung, die mit der beruhigenden Welt- und Gottesgewissheit unserer Vorfahren schmerzlich aufräumt. Damit aber nicht genug: Seit Darwin müssen wir außerdem zur Kenntnis nehmen, dass wir vom Affen abstammen. Wermutstropfen auf Wermutstropfen, Enttäuschung auf Enttäuschung. Eine noch tiefere Kränkung aber sei es endlich, dass »der Mensch noch nicht einmal Herr in seinem eigenen Hause« sei, sondern dass unter der Oberfläche seiner Vernunft und Kultur unbeherrschbar das Unbewusste brodelt, wie die Psychoanalyse zeige.
Freud demontierte mit seiner Analyse das stolze Selbstbild seiner Zeitgenossen und provozierte damit heftigen Widerspruch. Die furchtbaren Weltkriege des 20. Jahrhunderts mit ihren barbarischen, kulturspottenden Exzessen aber lieferten prompt den Praxisbeweis für den freudschen Skeptizismus, sein »Unbehagen an der Kultur«. Spätestens jetzt musste die Menschheit sich endgültig von der alten, lieb gewordenen Vorstellung verabschieden, sie sei die Krone der Schöpfung, habe ihre Triebe und Emotionen im Griff und stünde intelligent und souverän im Zentrum des Kosmos.
Hat Freud schon geahnt, wie sehr die allerneueste wissenschaftliche Forschung seinen Ansatz vertiefen und sogar noch radikalisier-en würde? Etwa durch die Erkenntnisse der modernen Biogenetik? Da wird die Frage, wer wir eigentlich sind, zu einer immer schwerer lösbaren Rätselaufgabe.
Nur ein Beispiel: Die Molekularbiologen rechnen uns heute vor, dass unser Körper aus etwa 10 13- also 10 Billionen - Körperzellen besteht. Ist nun damit unsere Identität medizinisch ausreichend beschrieben? Ist dieser Zellbestand unser materiell definierbarer Besitz? Sind wir das?
Nicht nur, sagt die moderne Biologie. Und uns wird dann erklärt, dass in und auf unserem Körper etwa zehnmal so viele Bakterienzellen, also 100 Billionen körperfremde Lebewesen, siedeln. Zwar sind sie viel kleiner und mit einem Gesamtgewicht von etwa einem Kilo pro Mensch auch viel leichtgewichtiger als unsere Körperzellen -aber doch zahlenmäßig deutlich in der zehnfachen Überlegenheit.
Ist diese »fremde« Mehrheit, die im Übrigen ja auch eine viel größere Anzahl an Genen beinhaltet, als es unser eigenes Erbgut tut, nun Bestandteil unserer Identität? Sind wir diese Fremden? Die Biologen würden sagen: Ja! Denn ohne die Bakterien würden wir nicht überleben können. Sie übernehmen wichtige Arbeiten in und an uns, die unser genetisches Programm gar nicht leisten kann. Etwa in der Darmflora die Zerlegung der aufgenommenen Nahrung in Eiweiß-, Zucker- und Fettmoleküle, die Voraussetzung für unseren Stoffwechsel. So ist jeder Einzelne von uns genetisch gesehen eine Ansammlung von vielen. Bedenkt man weiter, dass etwa neunzig Prozent unserer gesamten Körperzellen innerhalb eines Jahres absterben und immer wieder erneuert werden, wir uns also in einem steten Prozess der Verwandlung befinden, dann wird die Frage, wer wir sind, aus biologischer Sicht jede Minute neu zu stellen sein.
Читать дальше