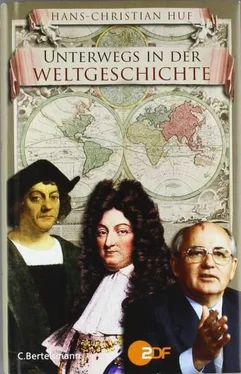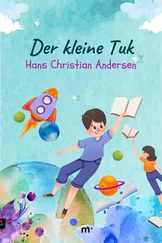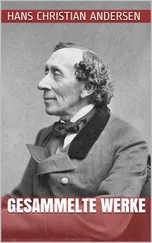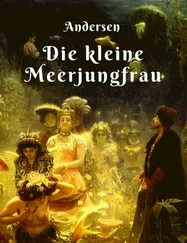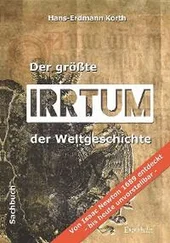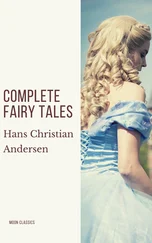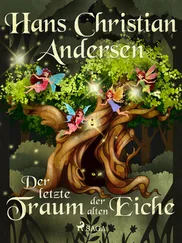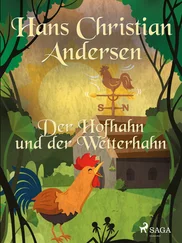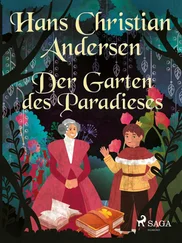Abraham Lincoln, der später von sich selbst sagte, er habe als Kind nicht einmal ein Jahr lang die Schule besucht, war ein Farmersohn aus Kentucky. An der Siedlungsgrenze zur Wildnis aufgewachsen, hatte er die Härte des Pionierlebens schon mit der Muttermilch aufgesogen. Die Liebe zu Amerika entdeckte er bei seinen Reisen als Flößer auf dem Ohio und Mississippi. Später bildete er sich autodidaktisch zum Anwalt aus und entwickelte eine um Ausgleich und Gerechtigkeit bemühte Grundhaltung. Seine Ablehnung des Sklavenwesens setzte sich am Ende wohl deswegen allgemein durch, weil er seine Position höchst listig und kompromissbereit vertrat. Niemals vor Ausbruch des Bürgerkriegs bestritt er das Recht der Bundesstaaten, über die Sklavenfrage frei entscheiden zu dürfen; zum anderen entsprach seine liberale Haltung letztlich dem Gründungsgedanken der USA: Ein Land, das sich auf Demokratie gründe, müsse die individuelle Freiheit auch konsequent umsetzen, so formulierte er in seiner berühmtesten Rede, der Gettysburg Address von 1863. Und: Eine Demokratie könne nur überleben, wenn nicht eine Minderheit mit Gewalt eine Mehrheit unterdrücke.
Diese letzte Wahrheit war schließlich auch der Grund, warum Lincoln einer äußerst gewagten und eigentlich widersprüchlichen Maßnahme nicht auswich: Ausgerechnet ein Krieg sollte das richtige Mittel werden, um Nord- und Südstaaten zu versöhnen. Als bald nach der Wahl Lincolns zum US-Präsidenten Anfang des Jahres 1861 sieben Südstaaten aus der amerikanischen Union austraten und die »Konföderierten Staaten von Amerika« gründeten, war es immer noch nicht die Sklavenfrage, die Lincoln zum Thema machte. Vielmehr sei es, so argumentierte er unangreifbar, sein Amtseid, der ihn verpflichte, die Sezession, also die Spaltung des Landes, zu verhindern.
Als die Konföderierten dann verärgert den ersten Schuss abgeben, beginnt ein vier Jahre langes, verlustreiches Gemetzel. Nicht viel hätte gefehlt, und die inzwischen elf abtrünnigen Konföderierten hätten gewonnen. Zahlenmäßig unterlegen, aber wirtschaftlich potent, erzielten sie zahlreiche militärische Erfolge, die Lincolns Position gefährlich ins Wanken brachten, so dass er selbst an seiner Wiederwahl als Präsident zweifeln musste. Letztlich war es, wie so oft in der Geschichte, dann eine einzige Schlacht, die die Entscheidung brachte und damit verhindert hat, dass wir die USA heute »KSA« nennen müssten, eine Konföderation der Staaten von Amerika. Die Schlacht bei der Kleinstadt Gettysburg im Bundesstaat Pennsylvania dauerte im Juli 1863 drei furchtbare Tage. Aber es war einer der letzten, vergeblichen Versuche der Südarmee unter General Lee, auf das Gebiet der Union vorzudringen.
Gewiss, andere Szenarien wären damals denkbar gewesen. Unsere europäischen Vorfahren etwa hätten zugunsten der Konföderierten eingreifen können. Mit gutem Grund sogar, denn durch die Seeblockade der Nordstaaten kam die Ausfuhr von Baumwolle nach Europa vollständig zum Erliegen, was eine schwere Krise in der englischen Tuchindustrie zur Folge hatte. Aber auch für unsere Ururur-großväter ging die Zeit der Leibeigenschaft endgültig zu Ende. Waffenbrüderschaft mit einem Regime, das für die Sklaverei kämpfte, war einfach nicht mehr zeitgemäß und hätte in Europa eigene innenpolitische Krisen heraufbeschworen.
So kam es, dass der isolierte Süden am Ende des Bürgerkrieges wirtschaftlich ruiniert war, die Sklaven ihre Freiheit errungen hatten und sogar das Wahlrecht erhielten, aber noch bis heute die gewaltsam unterdrückten konservativen Vorstellungen der Südstaatler in einigen wenigen Köpfen der amerikanischen Gesellschaft herumspuken und sich gelegentlich sogar in obskuren Geheimbünden wie dem Ku-Klux-Klan Luft machen. Die geforderte und erkämpfte Gleichheit von Schwarz und Weiß ist in USA auch nach 150 Jahren immer noch ein gesellschaftlicher Dauerbrenner.
Dass die Wiedereingliederung der Südstaaten gleichwohl überraschend problemlos gelang, ist nicht nur der sanften Versöhnungspolitik Lincolns zuzurechnen (»Groll gegen niemanden!«), der übrigens das endgültige Ende des Krieges gar nicht mehr miterlebte, weil ihn ein Attentäter bei einem Theaterbesuch erschoss. Sondern es war wieder mal eine glückliche Fügung des Schicksals, die Amerika bald über Nacht zur wohlhabendsten Nation der Welt machte.
Sie wissen: Wohlstand ist immer ein großer Versöhner. Und gewaltige Bodenschätze wurden gleich nach dem Ende des Bürgerkriegs gefunden, darunter auch wieder große Mengen Goldes. In Titusville/Pennsylvania sprudelte ab 1859 die erste Ölquelle; und auch wenn dieser neue Rohstoff zunächst nur dazu geeignet erschien, das herkömmliche Walöl in den Lampen der Wohnstuben durch das moderne Petroleum zu ersetzen, so entdeckten die Menschen doch schon bald weitere, sensationelle Verwendungsmöglichkeiten für das »schwarze Gold«. Auch die Fertigstellung der Pazifikbahn 1869 erfolgte zur rechten Zeit: Das Innere der USA wurde ab sofort in Dampflok-Tempo erschlossen. 1867 gelang dann noch einer der cleversten Grundstückskäufe der Geschichte: Für 7,2 Millionen Dollar verschenkte der russische Zar das rohstoffreiche und riesige Alaska, mit 0,0004 Cent pro Quadratmeter der wohl billigste Landkauf aller Zeiten. Ihre Vorfahren hätten mitbieten sollen.
Amerika im Glück. Kein Wunder, dass sich in den fünfzig Jahren zwischen 1860 und 1910 die US-Bevölkerung durch Masseneinwanderung verdreifacht hat - auf damals 91 Millionen Einwohner.
Und wenn Sie jetzt aus einem der kleinen Fensterchen in der Krone der Freiheitsstatue schauen, dann werden Sie verstehen, warum die Skyline von New York, die Sie jetzt erblicken, so eine Riesenportion Zukunftsoptimismus ausstrahlt.

35. Nationaler Horrortrip
Ist es nicht ebenso faszinierend wie geheimnisvoll, dass viele Entwicklungen der Weltgeschichte fast gleichzeitig oder ähnlich verlaufen, auch wenn riesige Entfernungen zwischen den Orten der Geschehnisse liegen? So wie es schon vor 5000 Jahren mit der Erfindung der Schrift war, die fast zeitgleich von Ägyptern und Sumerern entwickelt wurde. Oder auch mit den ersten Stadtkulturen im Zweistromland, die der Harappa-Kultur am fernen Indus ähnelten. Oder mit den Pyramidenbauten, die in Costa Rica und Mexiko ebenso in den Himmel wuchsen wie zuvor am anderen Ende der Welt, am Nil.
Angesichts solch altehrwürdiger Kulturzeugnisse sollten wir uns eigentlich darüber freuen, dass dieses Phänomen der Parallelität, der globalen Gleichzeitigkeit sich in der jüngeren Geschichte wieder zurückmeldet. Wenn es sich nur nicht diesmal um das genaue Gegenteil kultureller Leistungen handeln würde, nämlich um ein gemeinsames Krankheitssymptom mit fatalen Folgen: das Herrschaftsgebaren, den Expansionsdrang und die Eroberungspolitik der Großmächte zu Anfang des vergangenen Jahrhunderts.
Wenn Sie im Theater aufstehen, können Sie besser sehen. Wenn im Theater aber alle aufstehen, kann niemand mehr sehen. Und dann kommt es schnell zum Streit. Ganz ähnlich geht es auch am Beginn des 20. Jahrhunderts zu im großen europäischen Welttheater: Bei allen Völkern Europas hat sich jetzt der Nationalstaatsgedanke durchgesetzt. Das Streben nach Macht und Bedeutung auf der politischen Bühne wird zur Selbstverständlichkeit. War es zuvor vor allem England gewesen, das als British Empire seine Flügel weltweit und ungemein erfolgreich ausspannte, so beginnen nun auch alle anderen Nationen hemmungslos ihr übersteigertes Nationalgefühl über den gesamten Globus zu stülpen. In der Maske weltmissionarischer Beglückung kommt diese Politik daher, bedeutet aber in Wirklichkeit die brutale Ausbeutung der kolonialis-ierten Völker. Da werden vollmundige Sätze gesprochen, die Mord und Raffgier als Gutmensch-Tat verbrämen. Eine kleine Auswahl zum Erschrecken:
Читать дальше