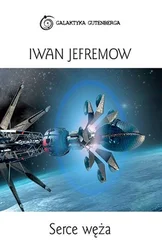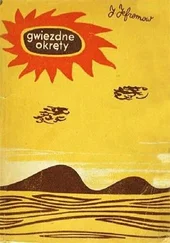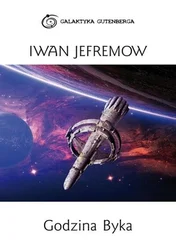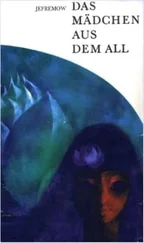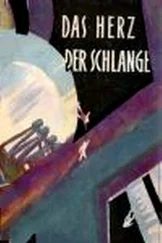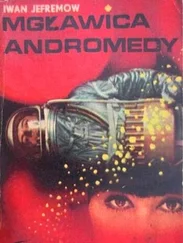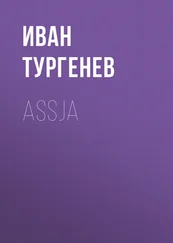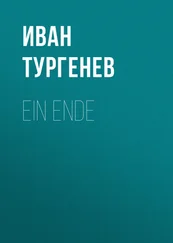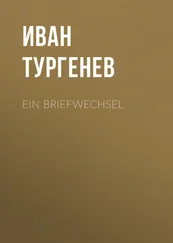Die Idee vom Menschen, der in den Kosmos fliegt, in andere Galaxien, hat mich schon lange beschäftigt, lange bevor der erste sowjetischen Sputnik seine Umlaufbahn erreichte und der Weltöffentlichkeit die Wahrhaftigkeit der ältesten Menschheitsträume vom Reisen in andere Welten und zu anderen Planeten vorführte. Wirklich konkrete Formen nahm diese Idee jedoch erst vor etwa zehn Jahren an. Ich hatte damals fünfzehn oder zwanzig SF-Romane hintereinander weg gelesen, Romane von zeitgenössischen westlichen, hauptsächlich amerikanischen Autoren. Anschließend verspürte ich den heftigen und anhaltenden Wunsch, meine eigene Version der Zukunft zu entwerfen, genauer gesagt, einen künstlerischen Gegenentwurf zu diesen Büchern vorzulegen, die philosophisch und soziologisch nicht fundiert waren.
In gewisser Weise drängten mich also rein polemische Überlegungen dazu, diese lang gehegte Idee zu realisieren: Ich wollte diesen Zukunftsvisionen eine grundsätzlich andere entgegensetzen. Waren die westlichen Romane durchdrungen von dem Motiv des Untergangs der Menschheit infolge verheerender Kriege zwischen den Welten oder auch von Ideen zum Schutz und der Verbreitung des Kapitalismus, der irgendwann auf Jahrtausende die ganze Galaxie erfassen würde, entwarf ich die Idee vom freundschaftlichen Kontakt zwischen verschiedenen kosmischen Zivilisationen. So entstand und reifte das Thema vom „Großen Ring“ (wie ich „Andromedanebel“ ursprünglich nennen wollte). Aber im Verlauf des Schreibens kristallisierte sich etwas anderes als Hauptgegenstand meiner Fantasie heraus, nämlich der Mensch der Zukunft. Ich spürte, dass ich nicht in der Lage sein würde, eine Brücke zu anderen Galaxien zu bauen, solange ich nicht selbst verstanden hatte, wie der irdische Mensch von morgen aussehen würde, wie er denken, wonach er sich sehnen und wonach er streben würde. Vermutlich rückte der ursprüngliche, allzu enge Titel deshalb immer mehr in den Hintergrund, und an seine Stelle schob sich ein neuer, der besser passte: „Andromedanebel“. Auch er symbolisierte den intergalaktischen Austausch und Kontakt — jene Idee, die mir so wichtig war —, gleichzeitig ließ er mir aber mehr Raum und legte mich nicht so stark fest.
Ich muss gestehen, dass ich mich in diesem Roman zum ersten Mal auf den Menschen konzentrierte, auf den Charakter meiner Helden. In den Erzählungen hatten mich vor allem die hypothetischen wissenschaftlichen Hintergründe beschäftigt, außerdem der Spannungsbogen, die Handlung, das Abenteuer. Als Kind hatte ich mich schon für Abenteuerromane interessiert, und als ich selbst zu schreiben begann, glaubte ich, dass Handlung, Dramaturgie und Schauplatz beim Schreiben von Belletristik wichtiger als alles andere wären. Letzterer sollte möglichst exotisch sein, am besten eine ungewöhnliche und überraschende Kombination von Naturphänomenen unserer Umwelt (dank vieler wissenschaftlicher Exkursionen konnte ich aus einem reichen Erfahrungsschatz schöpfen). In meinen frühen Erzählungen legte ich den Schwerpunkt auf alles Ungewöhnliche in der Natur, der Mensch an sich kam mir damals absolut gewöhnlich vor. Einzige Ausnahmen: die beiden Erzählungen „Cutty Sark“ und „Auf den Spuren alter Berggeister“ [2] Beide entstanden 1944. — Anm. d. Übers.
, wo es um besondere menschliche Fähigkeiten geht. Dieses Motiv fand seine Weiterentwicklung im Roman „Das Land aus dem Meeresschaum“, in dem ich mich zum ersten Mal mit der komplexen Figur des hellenistischen Künstlers auseinandersetzte, und später im Roman „Sternenschiffe“ [3] Beide 1946. — Anm. d. Übers.
, der sich mit der Frage der schöpferischen Arbeit eines Wissenschaftlers befasste. Bei der Arbeit an diesen Romanen war ich auf einmal gezwungen, mich ernsthaft mit der psychischen Verfassung, dem Innenleben meiner Helden zu beschäftigen.
Bei der Lektüre von übersetzter SF-Literatur nahm ich regelmäßig wie in einem Zerrspiegel meine eigenen Fehler wahr und konnte mich anhand dieses Anschauungsmaterials davon überzeugen, wie wichtig für einen Schriftsteller die Darstellung seiner Charaktere ist und wie gefährlich eine Reduktion auf den Stoff. Denn wenn Letzteres eintritt, verkommt Science-Fiction zur reinen Unterhaltung. Ich kam zu dem Schluss, dass dem Menschen in meinem nächsten Roman die Hauptrolle gebühren sollte und die Zukunftswelt lediglich den Hintergrund liefern würde für soziale und philosophische Problemstellungen. Und schon sah ich mich mit einer Reihe von Fragen konfrontiert, auf die ich Antworten würde finden müssen, ehe ich mich ans Schreiben machte…
Noch während ich ausschließlich wissenschaftlich arbeitete, hatte ich mir angewöhnt, alle Probleme und Hypothesen, die mich beschäftigten, niederzuschreiben. Ich hatte dafür extra Notizbücher angelegt, die ich spaßhaft „Weise Hefte“ nannte. Dort hielt ich allerlei Skizzen und Ideen fest, um sie nicht wieder zu vergessen. Natürlich vergrößerte sich das Feld meiner Ideen und Fragen wie von selbst, als ich zu schreiben anfing, was sich auch auf meine Notizen auswirkte. Sie wurden detaillierter. Wenn mir so ein „Weises Heft“ früher mehrere Jahre gereicht hatte, füllte ich jetzt zwei bis drei davon pro Jahr. Ich notierte meine literarischen Einfälle darin, aber nicht nur die nackte Idee, sondern auch ergänzende Tatsachen, Einzelheiten und Informationen rund um eine Grundidee.
Als ich „Das Land aus dem Meeresschaum“ entwarf, notierte ich eine Vielzahl von Informationen über das alte Griechenland, interessante Einzelheiten, Fakten über Afrika und die ägyptische Kultur. Hatte ich irgendwo gelesen, dass das Rote Meer bei Sonnenuntergang eine bestimmte Farbe annahm, trug ich das in mein Heft ein. Stieß ich in einem Buch auf ein interessantes Detail — beispielsweise, dass der Fluch „Geh zu den Krähen“ in etwa unserem heutigen „Geh zum Teufel“ entspricht —, notierte ich das. Ich versuchte, speziellen Nachschlagewerken besondere Informationen zu entnehmen. Aber ich verwendete sie in meinen Werken auf andere Weise als beispielsweise der Schriftsteller Jules Vernes. Wenn Vernes Helden an einem gigantischen Baobab vorbeikamen, nahm der Autor das zum Anlass, um dessen Größe, Umfang etc. zu beschreiben. Mir dagegen schien es wichtiger, an diesem Baum ein besonderes Detail hervorzuheben, das für die Umwelt, die gesamte Situation rund um den Helden als charakteristisch gelten konnte. Meine Aufgabe bestand vor allem darin, eine reale Welt erstehen zu lassen, in anschaulichen Einzelheiten und ohne dabei allzu stark zu vereinfachen oder in plumpe Deskription zu verfallen. Eine andere Frage ist, ob ich dieser Aufgabe immer gerecht geworden bin.
Besonders viele Notizen machte ich mir, während ich „Andromedanebel“ ersann. Mich interessierten damals vor allem Probleme der zukunftsorientierten Wissenschaften, in denen ich mich nicht gut auskannte: Physik, Chemie, Medizin. Einige Jahre lang verfolgte ich aufmerksam die wissenschaftlichen Fortschritte in diesen Bereichen; ich wollte wissen, mit welchen Fragen sich die Biologen, Chemiker, Astronomen und Physiker der modernen Welt herumschlugen…
Nachdem die erste Phase, „Sammlung von Rohmaterial“, abgeschlossen war, begann die zweite: Es galt, die abwegigsten und gleichzeitig vielversprechendsten wissenschaftlichen Probleme auszuwählen und sie im Buch bereits als gelöst zu präsentieren. Ganz automatisch stellte sich mir die Frage, wie die Menschen aussehen würden, die über einen so gewaltigen Verstand und solches Wissen verfügten.
Meine Überlegungen bezüglich des menschlichen Charakters der Zukunft vollzogen sich auf zwei Ebenen: Ich musste mir das äußere und das innere Aussehen eines solchen Menschen vorstellen. Ersteres war deutlich einfacher. Ich ging gedanklich vom modernen Menschen aus, stellte mir unseren nördlichen Küstenbewohner vor, Sibirer oder Skandinavier — Menschen, an die ihre Lebensbedingungen besondere Anforderungen stellen, die davon geschmiedet und gestählt werden, denen dadurch Stärke, Mut und Entschlossenheit anerzogen werden. Ich glaubte, dass der Mensch der fernen Zukunft, der sich mit intensiven, der Gesellschaft nützlichen Aufgaben beschäftigen würde, ohne sich dabei zu erschöpfen oder verschleißen zu müssen, dass dieser Mensch noch stärker und schöner sein würde.
Читать дальше