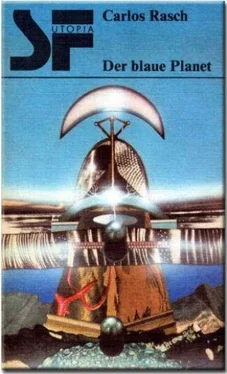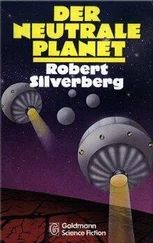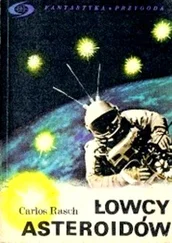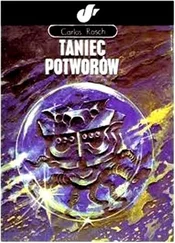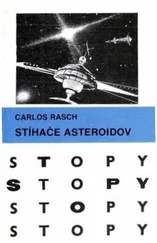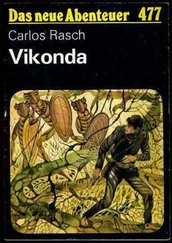Leise und zögernd, so, als sei er sich noch nicht gewiß und als gälten die Worte auch gar nicht dem Kinde, kam seine Antwort: „Es sind keine Götter, es sind nicht die Söhne der I- na-nua — es sind Himmelssöhne, es sind Sternenwanderer! Sie können uns kein anderes Leben geben. — Der Lu-gul braucht uns nicht mehr. Wir werden fliehen müssen.“
Unbemerkt war Azul an sie herangetreten. „Der Jüngling ist erwacht“, sagte er.
Das Mädchen sprang auf und lief den Hang hinab.
Azul sah ihr nach. „Warum hat der Jüngling das Gift gegessen und du nicht?“
„Er glaubte mir nicht, als ich ihn warnte. Die Priester achteten bei den jungen und kräftigsten von uns darauf, daß sie das Gift schon zu sich nahmen, wenn sie in die Gruft hineingingen. — Das Mädchen und ich konnten sie täuschen.“
Sie schwiegen eine Zeitlang.
„Du bist ein Sternenwanderer?“ fragte dann der Mensch zögernd. Am Klang seiner Stimme vermeinte Azul zu erkennen, wie schwer es ihm war, das zu begreifen. „Ist euer Weg die Milchstraße?“ hörte er wieder des Menschen Stimme.
Dabei deutete er auf das schmale, unregelmäßige Lichtband der Sternenwolken, das sich quer über den dunklen Himmel zog.
Azul verstand: Der Mensch ahnte nur, was ›Sternenwanderer‹ waren. Wie konnte er ihm helfen, es zu verstehen? Würde der kleine Myonendolmetscher im Skaphander seine Erklärung in der Sprache der Menschen richtig und einfach wiedergeben können?
„Ja“, sagte er endlich. „Die Sternenstraße dort oben, die du Milchstraße nennst, ist unser Weg und ist auch unsere Heimat.
Bei einem der Sterne wohnen wir. In unserer Heimat gibt es keine Götter und keine Lu-guls. Tausend Sonnen leuchteten uns auf unserer Wanderung von dort bis hier her. Bald müssen wir uns von eurer Erde erheben und weiterziehen.“
Als der Flammenschein des nur wenige Kilometer von den Mauern entfernt landenden Weißen Pfeils grell über die Stadt fiel und gespenstische Schatten in den Gassen und Plätzen warf, als das brausende Rauschen des Triebwerkes mit röhrendem Grollen durch die dünnen Lehmwände der Häuserzeilen sprang und auch die dicken Mauern der Tempel und des Herrscherpalastes durchbrach, glaubten die Menschen E-rechs, der Zorn der Götter ergieße sich über sie und versenge sie.
Die Tempelwächter vor den Monumentalbauten, die wachenden Soldaten auf den Mauern und Stadttoren und der Hohepriester, der einsam hoch oben auf der letzten Stufe der Ziggurat die Konstellation der Sterne zu deuten versuchte, preßten vor dem blendenden Licht die Köpfe schützend in den vorgehaltenen Arm.
Viele Menschen liefen schreiend auf die Straße hinaus.
Doch plötzlich, schon nach wenigen Sekunden, lastete unheimlich wieder Dunkelheit und Stille auf der Stadt und dem Land. Die Angst der aus dem Schlaf geschreckten Menschen stieg noch mehr und verschloß ihnen den Mund.
Nur der Klageruf einer Frau stand dünn und grell in der Luft.
Kinder weinten.
Hunde winselten.
Tausend Ohren lauschten furchtsam.
Doch nichts geschah.
In den Häusern der Lu-guls rief man nach dem Öllicht. Die nackten Sohlen der Sklaven tappten.
Auf der Straße klang hart ein eiliger Schritt auf. Ia-du-lin hastete zum Tempelbezirk, im Arm den kleinen Obelisk der Meßsonde.
Was wollten die Himmelssöhne? Warum sprang ihr weißer Feuervogel so nahe der Stadt zu Boden? Seitdem Azul verschwunden war, kannten sie keinen ruhigen Augenblick mehr. Rastlos suchten sie den ganzen Tag über das Land ab.
Zuerst hatten sie gehofft, die Priester könnten ihnen sagen, wohin Azul gegangen war. Überall hatte Sil gefragt. Aber niemand hatte den zweiten Sohn der I-na-nua gesehen. Dann war Sil davongeflogen. Bald kam er mit einem riesigen Felsklotz zurück, der, als er ihn zu Boden ließ, rasselnd mit breiten, kralligen Tatzen die Wege und Gräben entlangkroch.
Niemand wagte sich mehr aus der Stadt. Die Soldaten schlossen sogar die Tore. Nur A-kim, der Wasserträger, folgte mit seinem Esel dem Ungeheuer, nachdem er gesehen hatte, daß der kriechende Felsklotz den Himmelssöhnen wie ein artiges Hündchen gehorchte.
Ia-du-lin erreichte den Tempelplatz, überquerte ihn und ging um den Tempel des Mondgottes herum zum dahinterliegenden Hof. Sil würde sagen können, was der brüllende Schrei des Feuervogels zu bedeuten hatte. Ia-du-lin achtete nicht der dunklen Gruppen der Priester, die sich, Gebete murmelnd, überall niedergelassen hatten. Die Bewohner der umliegenden Straßen kamen in Scharen auf den Tempelplatz und ließen sich, ebenfalls betend, vor der Ziggurat zu Boden gleiten. Es hieß, der Hohepriester sei auf dem Turm und bitte die Götter um ihr Wohlwollen.
Der Tamkare stieß die niedrige Pforte in der Mauer zum Tempelhof auf und schlüpfte hindurch. Der Hof war leer. Ia- du-lin blieb stehen und zog unmutig die Stirn kraus. Wohin mochte Sil geflogen sein?
Ein Schatten löste sich von der Rückfront des Nan-nar- Tempels und eilte auf ihn zu. Es war ein Bote des Hohenpriesters, der wohl geahnt hatte, daß Ia-du-lin hierher kommen würde. „Der Sohn der I-na-nua hat sich mit dem fliegenden Ring in Richtung der Hügel mit den Grabkammern erhoben, kurz bevor der brüllende Flammenschein über die Stadt fiel“, sagte der Bote.
Ia-du-lin kehrte stracks um und hastete zurück. Diesmal war eines der Stadttore sein Ziel. In den Straßen wuchs der lautlose Zug der Leute zum Tempelplatz. Sogar Soldaten gingen mit der Menge. Der Tamkare rief einige an und forderte sie auf mitzukommen. Nur widerwillig gehorchten sie.
„Der kriechende Felsklotz der Himmelssöhne“, berichtete der Offizier der Wachmannschaft am Tor, „hatte sich um Mitternacht nahe der Mauer zur Nachtruhe niedergelassen. Als die erste Wache abgelöst wurde, raste er plötzlich in Richtung der Gräberfelder davon. Er riß alles nieder, was ihm im Wege stand. Wir hörten es noch weithin krachen und splittern. Dann ertönte die feurige Himmelsposaune.“
Der Tamkare stand lange mit den Soldaten auf der Stadtmauer. Sie starrten in Richtung des Hügellandes und lauschten angestrengt in die Dunkelheit. Fern zwischen den Hügeln mahlte es, kaum hörbar.
Bald zeigte sich gen Morgen der schwache Schein des neuen Tages. Da taumelten zwei Gestalten durch das Morgengrau, sich gegenseitig stützend. Vor dem schweren Bohlentor stürzten sie nieder. Ia-du-lin kletterte von der Stadt mauer herab und ließ das Tor öffnen. Die beiden keuchten. Sie mochten wohl weite Strecken schnell gelaufen sein. Es waren zwei der Priester, die Totenwache im Hügelland zu halten hatten.
„Die Toten kommen“, stieß der eine hervor, als er die Augen aufschlug und das Gesicht eines Soldaten über sich erblickte.
„Sie leben noch alle. Die Grabhöhlen sprangen auf, als die Himmelssöhne auf ihrem Feuer herabfuhren.“ Der Priester schöpfte Atem und blickte sich ängstlich um. Mit schwacher Handbewegung zeigte er auf den anderen Priester. „Führt ihn“, sagte er matt, „das Feuer hat ihn geblendet. Ich fand ihn unterwegs. Er…“ Der Priester schrie auf und duckte sich. Der fliegende Ring schwirrte niedrig und langsam über sie stadteinwärts hinweg.
Die Soldaten sahen sich scheu an.
Da mahlte es wieder in der Ferne. Das Geräusch kam diesmal rasch näher. Der kriechende Felsklotz der Himmelssöhne schien auf der breiten Prozessionsstraße daherzukommen, die das Höhlengebiet mit der Stadt verband und geradewegs auf das Halbrund des Tempelplatzes führte. Die Soldaten zogen sich furchtsam hinter die Mauer zurück. Gern hätten sie auch das schwere Bohlentor geschlossen. Doch Ia-du-lin verbot es ihnen.
Aus den grauen Nebelschwaden, die wie jeden Morgen dicht über dem Boden hin und her wogten, tauchte plötzlich ein seltsamer Zug auf: halbnackte, ausgemergelte Gestalten.
Sklaven dreier vor wenigen Tagen gestorbener Lu-guls.
Читать дальше