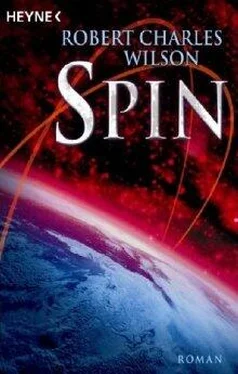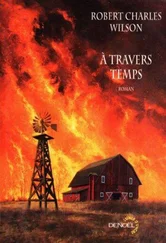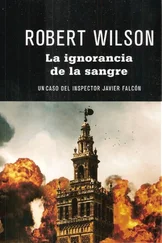Er zuckte mit den Achseln. »Glauben Sie nicht alles, was Sie hören.«
Bis zum Mittag waren etliche der übrigen Passagiere aufs Deck gekommen. Neben den Minangkabau-Dörflern war eine bunte Mischung aus Achinesen, Malaien und Thai an Bord, insgesamt waren wir etwa hundert Leute, zu viele für die vorhandenen Kabinen, doch im Laderaum waren drei Aluminiumcontainer als Schlafquartiere präpariert worden. Natürlich mit ausreichender Belüftung — dies war nicht der grauenhafte Menschenschmuggel, der einst Flüchtlinge nach Europa und Nordamerika gebracht hatte. Viele von denen, die den Bogen Tag für Tag querten, waren gewissermaßen Überlauf aus den von der UNO initiierten Umsiedlungsprogrammen und oft durchaus zahlungskräftig. Wir wurden mit Respekt behandelt von einer Mannschaft, die zum Teil schon Monate in Port Magellan zugebracht hatte und die Reize und Fallgruben des Ortes aus eigener Anschauung kannte.
Einer der Matrosen hatte einen Teil des Hauptdecks mit Netzen abgeteilt, damit eine Gruppe von Kindern Fußball spielen konnte. Hin und wieder flog der Ball über die Netze hinweg, oft genau in Jalas Schoß, was ihn jedes Mal verärgerte. Er war ein bisschen reizbar heute.
Ich fragte ihn, wann das Schiff den Transit beginnen würde.
»Bei dieser Geschwindigkeit, in ungefähr zwölf Stunden.«
»Unser letzter Tag auf Erden.«
»Machen Sie keine Witze.«
»Wörtlich gesprochen.«
»Und reden Sie nicht so laut — Seeleute sind abergläubisch.«
»Was werden Sie in Port Magellan machen?«
Er hob die Augenbrauen. »Was werde ich machen? Schöne Frauen vögeln. Und vielleicht auch ein paar hässliche. Was sonst?«
Der Fußball flog einmal mehr übers Netz. Diesmal hob ihn Jala auf und hielt ihn fest. »Verdammt noch mal, ich habe euch gewarnt. Das Spiel ist vorbei!«
Sofort drängte ein Dutzend Kinder gegen das Netz und erhob kreischend Protest. En war es schließlich, der den Mut aufbrachte, zu uns zu kommen und Jala direkt gegenüberzutreten. »Gib ihn bitte zurück«, sagte er.
»Du willst ihn wiederhaben?« Jala stand auf, herrisch und auf schwer nachvollziehbare Weise wütend. »Du willst ihn haben? Dann hol ihn dir.« Er kickte den Ball aus der Hand hoch in die Luft, ein weiter Torwartabschlag, der ihn über die Reling hinweg in die blaugrüne Unendlichkeit des Indischen Ozeans beförderte.
Erst war En verblüfft, dann machte sich Zorn auf seinem Gesicht breit. Er sagte etwas Leises, verbittert Klingendes auf Minang.
Jala lief rot an und schlug den Jungen mit der flachen Hand ins Gesicht, so heftig, dass Ens schwere Brille über das Deck polterte. »Entschuldige dich, Rotzbengel.«
En ließ sich auf ein Knie nieder, die Augen zusammengepresst. Schluchzend holte er einige Male Luft. Dann stand er wieder auf und sammelte seine Brille ein. Etwas zitternd setzte er sie auf und kam zu uns zurück mit einer, wie ich fand, erstaunlichen Würde. Er blieb genau vor Jala stehen. »Nein«, sagte er leise. » Du musst dich entschuldigen.«
Jala schnappte nach Luft, fluchte und hob erneut die Hand.
Ich packte sein Handgelenk mitten im Schwung.
Er sah mich verdutzt an. »Was soll das? Lassen Sie los.«
Er versuchte mir die Hand zu entreißen, doch ich hielt sie fest. »Schlagen Sie ihn nicht noch mal.«
»Ich mache, was ich will!«
»Natürlich. Aber schlagen Sie ihn nicht noch mal.«
»Sie — nach allem, was ich für Sie getan habe…!« Er blickte mir ins Gesicht. Und stockte.
Ich weiß nicht, was er in meinen Augen sah. Ich weiß nicht mal genau, was ich in diesem Augenblick empfand. Was immer es war, es schien ihn zu verwirren. Sein Arm erschlaffte. »Verrückter Scheißamerikaner«, sagte er kleinlaut. »Ich gehe in die Kantine.« Und an die kleine Ansammlung von Kindern und Matrosen, die uns mittlerweile umringte, gewandt, fügte er hinzu: »Wo ich hoffentlich ein bisschen Ruhe und Respekt finde!« Er stakste davon.
En starrte mich mit offenem Mund an.
»Tut mir Leid, das alles«, sagte ich.
Er nickte.
»Den Ball kann ich euch allerdings nicht wiederholen.«
Er berührte seine Wange an der Stelle, wo Jala ihn erwischt hatte. »Nicht so schlimm.«
Später beim Essen, wenige Stunden vor der Querung, erzählte ich Diane von dem Vorfall. »Ich habe völlig ohne Überlegung gehandelt. Es schien einfach… naheliegend. Wie ein Reflex. Hat das etwas mit dem Viertentum zu tun?«
»Mag sein. Der Impuls, ein Opfer zu beschützen, zumal wenn es ein Kind ist, und es spontan, ohne Nachdenken zu tun — diesen Drang hab ich auch schon verspürt. Ich vermute, das ist etwas, das die Marsianer in unsere neurale Neukonstruktion eingeschrieben haben — vorausgesetzt, dass sie wirklich in der Lage sind, Gefühle derart fein zu steuern. Ich wünschte, wir hätten Wun Ngo Wen hier, damit er es uns erklärt. Oder Jason. Fühlte es sich erzwungen an?«
»Nein.«
»Oder falsch, unangemessen?«
»Nein. Ich glaube, es war genau das Richtige.«
»Aber vor der Behandlung hättest du so etwas nicht getan?«
»Vielleicht schon. Oder ich hätte es gewollt. Hätte aber wahrscheinlich so lange überlegt, bis es zu spät gewesen wäre.«
»Also bist du froh darüber.«
Nein. Einfach nur überrascht. Es sei gleichermaßen Ich wie marsianische Biotechnologie im Spiel gewesen, sagte Diane, und ich war geneigt, ihr zuzustimmen. Wie bei jedem anderen Übergang — von Kindheit zu Jugend, von Jugend zu Erwachsensein — bekam man es mit neuen Verpflichtungen zu tun, neuen Möglichkeiten, neuen Zweifeln.
Zum ersten Mal seit vielen Jahren war ich mir selbst wieder fremd.
Ich war fast fertig mit Packen, als Carol, ein wenig betrunken, die Treppe herunterkam, einen Schuhkarton im Arm. Der Karton trug die Aufschrift ANDENKEN (AUSBILDUNG). »Das solltest du an dich nehmen«, sagte sie. »Es gehörte deiner Mutter.«
»Wenn es Ihnen etwas bedeutet, behalten Sie’s ruhig.« »Danke, aber was ich daraus haben wollte, habe ich mir bereits genommen.«
Ich öffnete den Deckel und warf einen Blick auf den Inhalt. »Die Briefe.« Die anonymen Briefe, adressiert an Belinda Sutton, wie meine Mutter mit Mädchennamen hieß.
»Ja. Dann hast du sie also gesehen. Hast du sie mal gelesen?«
»Nein, nicht richtig. Gerade mal genug, um zu sehen, dass es Liebesbriefe waren.«
»O Gott, das klingt so süßlich. Ich würde sie eher als Huldigungen ansehen. Sie sind eigentlich ziemlich keusch, wenn man genau liest. Nicht unterschrieben. Deine Mutter hat sie bekommen, als wir noch auf der Universität waren. Sie ging damals mit deinem Vater aus, und dem konnte sie sie schwerlich zeigen — er hat ihr ja selbst Briefe geschrieben. Also hat sie sie mir gezeigt.«
»Sie hat nie herausgefunden, von wem sie kamen?«
»Nein, nie.«
»Sie muss doch neugierig gewesen sein.«
»Natürlich. Aber sie war inzwischen mit Marcus verlobt. Sie hatte ihn kennen gelernt, als er und E. D. ihr erstes Unternehmen gründeten — die Entwicklung und Fertigung von Höhenballons —, damals, als die Aerostaten noch ›Blauer Himmel‹-Technologie waren, wie Marcus es nannte, ein bisschen verrückt, ein bisschen idealistisch. Belinda nannte die beiden die Zeppelin-Brüder. Also waren wir wohl die Zeppelin-Schwestern, Belinda und ich. Denn zu der Zeit begann ich mit E. D. zu flirten. Weißt du, in gewisser Weise war meine ganze Ehe nichts anderes als der Versuch, mit deiner Mutter befreundet zu bleiben.«
»Die Briefe…«
»Interessant, nicht wahr, dass sie sie all die Jahre aufbewahrt hat. Irgendwann habe ich sie gefragt, warum. Warum sie nicht einfach wegwerfen? Sie erwiderte: ›Weil sie aufrichtig sind.‹ Das war ihre Art, die Person zu ehren, die sie geschrieben hatte. Der letzte Brief traf eine Woche vor ihrer Hochzeit ein. Danach keine mehr. Und ein Jahr später habe ich E. D. geheiratet. Auch als Paare waren wir unzertrennlich, hat sie dir das je erzählt? Wir sind zusammen in Urlaub gefahren, zusammen ins Kino gegangen. Belinda kam zu mir ins Krankenhaus, als die Zwillinge geboren wurden, und ich habe ihr die Tür aufgemacht, als sie dich zum ersten Mal nach Haus brachte. Aber das alles ging zu Ende nach Marcus’ Unfall. Dein Vater war ein wundervoller Mensch, Tyler, sehr direkt, sehr witzig, der Einzige, der E. D. zum Lachen bringen konnte. Doch leider auch sehr leichtsinnig. Belinda war am Boden zerstört, als er starb. Und nicht nur seelisch. Marcus hatte den Großteil ihrer Ersparnisse durchgebracht, und von dem, was noch übrig war, musste sie die Hypothek tilgen, die auf ihrem Haus in Pasadena lag. Als also E. D. nach Osten ging und wir dieses Grundstück kauften, da lag es irgendwie nahe, ihr anzubieten, das Gästehaus zu beziehen.«
Читать дальше