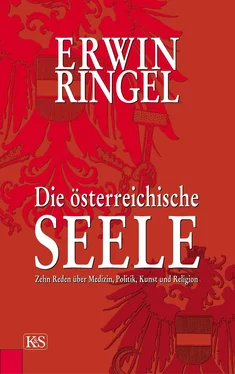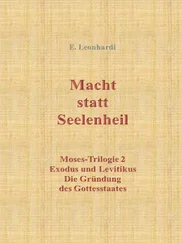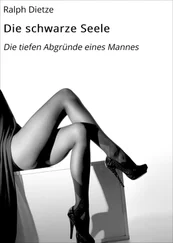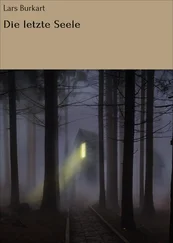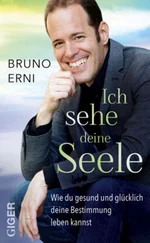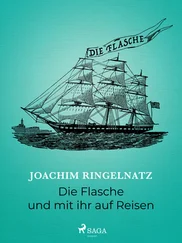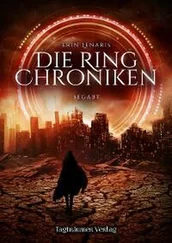Von wannen kam er und von welcher Art?
Blieb nichts ihm, nur das Wesen selbst, erspart?
War die Figur er oder nur das Bild?
War er so grausam wie er altersmild?
Zählt’ er Gefallne wie erlegtes Wild?
Hat er’s erwogen oder frisch gewagt?
Hat er auch sich, nicht nur die Welt geplagt?
Wollt’ er die Handlung oder bloß den Akt?
Wollt’ er den Krieg? Wollt’ eigentlich er nur
Soldaten, und von diesen die Montur,
von der den Knopf nur? Hatt’ er eine Spur
von Tod und Liebe und von Menschenleid?
Nie prägte mächtiger in ihre Zeit
jemals ihr Bild die U n p e r s ö n l i c h k e i t.
Vielleicht wäre es nicht nötig, einen Exkurs über Franz Joseph zu halten, wenn nicht mit Schrecken zu bemerken wäre, dass immer mehr Menschen eine merkwürdige nostalgische Sehnsucht nach eben diesem Franz Joseph entwickeln, ganze „Wallfahrten“ nach Ischl und anderen Gedenkstätten stattfinden. Da muss sich gerade der Tiefenpsychologe fragen: Ist das die Sehnsucht nach der verlorenen Vaterfigur? Sind die Regierenden den Österreichern vielleicht noch zu wenig neurotisch, dass sie den Franz Joseph wollen? – Oder wollen sie gar wieder einen Totengräber an der Spitze? Denn es ist doch überhaupt kein Zweifel, dass dieser Mann vor allen anderen der Totengräber Österreichs war! Wenn er am Schluss seines Lebens aussprechen musste: „Mir bleibt auch nichts erspart!“, war das die logische Konsequenz einer lebenslangen neurotischen Selbstvernichtung auf allen Gebieten. Diesem Mann musste alles, was er anrührte, misslingen! – Und nach ihm eine Sehnsucht?
Ich weiß, dass ich damit ein fatal heißes Eisen angerührt habe, und weil ich nun schon dabei bin, will ich an einem zweiten nicht vorbeigehen, über das endlich einmal ehrlich zu sprechen es mich schon lange drängt. Es hat ja nicht nur Totengräber Österreichs gegeben, sondern auch eine ganze Reihe von Baumeistern – übrigens gehört Wildgans mit seinem Bekenntnis zum österreichischen Menschen in eben dieser Rede, die für den heutigen Vortrag zum Paten wurde, zweifellos zu ihnen. Ich aber will jetzt über einen anderen sprechen, der für die einen Baumeister, für die anderen aber Totengräber ist: Engelbert Dollfuß. Und damit bin ich vielleicht beim größten Wagnis des heutigen Abends. Als am 25. Juli 1934 dieser Mann unter den Kugeln feiger Mörder am Ballhausplatz verblutete, da habe ich als 13-Jähriger – warum soll ich es leugnen? – geweint, so geweint, wie ich es selten später in meinem Leben getan habe. Ich war damals nicht der Einzige, viele weinten mit mir, nicht der Geringste unter ihnen war Friedrich Heer, der an anderer Stelle einmal bekannte, er habe in seinem Leben einen einzigen politischen Personen-Glauben gekannt, den an Engelbert Dollfuß. Aber ich muss mich natürlich heute fragen: Hast du damals zu Recht geweint? Denn, das muss mit aller Deutlichkeit und auch Schärfe gesagt werden, das Bild dieses Mannes ist verbunden mit mehr als tragischen Ereignissen: Er hat die Demokratie in Österreich zerstört, hat mit Kanonen auf Arbeiterhäuser schießen lassen, ist zum Arbeitermörder geworden. Und wenn man für beides auch bestimmte Umstände heranziehen kann, nämlich dass er gefürchtet hat, die Nationalsozialisten könnten in das Parlament, wie in Deutschland, mit größerer Mehrheit einziehen; dass er unter Druck Italiens stand, welches immer stürmischer verlangte, die Sozialdemokratie auszuschalten, und Italien damals der einzige Garant der Unabhängigkeit Österreichs war – dass wir nicht 1934 kassiert worden sind, sondern erst 1938, das haben wir nur Mussolini zu verdanken und nicht England und Frankreich, die uns schon damals völlig im Stich gelassen haben, so wie sie später auch die Musterdemokratie Tschechoslowakei im Stich ließen (das muss ausgesprochen werden!) –, so können sie niemals eine Entschuldigung, ja nicht einmal „mildernde Umstände“ darstellen, besonders der Februar 1934 bleibt eine ganz und gar unverzeihliche, unmenschliche Tat. Mit Ehrfurcht müssen wir verstehen lernen, dass ein Sozialdemokrat es heute noch nicht erträgt, den Namen Dollfuß in positiver Weise genannt zu hören. Und doch sollten wir im Sinne Friedrich Heers das „Gespräch der Feinde“ lernen, müssen auf der einen Seite unmissverständlich und verurteilend bis zum letzten Augenblick klarstellen, dass dieser Mensch falsche Wege gegangen ist, dürfen dann aber vielleicht auf der anderen Seite auch darauf hinweisen, dass derselbe Mann ein gutes Ziel gehabt hat, nämlich die Rettung Österreichs vor der braunen Flut. Diesem Dollfuß, der, wie Heer sagt, die Uniform nie ausgezogen hat, der ein Kämpfer war, wäre das nicht passiert, was seinem Epigonen geschehen musste: ein sang- und klangloser Untergang. Dieser Mensch hat als Erster den Spruch revitalisiert: „Österreich über alles, wenn es nur will“, er hat versucht, das Selbstvertrauen Österreichs zu wecken, hat sein Leben dafür eingesetzt, dass dieses Land nicht von der Landkarte verschwindet, hat mit seinem Blute seine Treue besiegelt und wohl auch seine Schuld bezahlt und gesühnt. Die Feinde von einst müssten folgenden (vorläufig noch utopischen) Dialog lernen: die einen, über seinen Qualitäten nicht die unbestreitbaren schweren Vergehen zu übersehen, die anderen, in ihrem „Todfeind“ doch auch den Mann zu erkennen, der für Österreich gekämpft hat. Dann mag vielleicht in ferner Zukunft der Weg dafür sich öffnen, auch Dollfuß als Baumeister Österreichs anzuerkennen, freilich als einen, der mit unrechten Mitteln gebaut hat, wo also Selbsterhaltung mit Selbstzerstörung gekoppelt war, vielleicht die tragischste und österreichischste Art des Bauens.
Ich wäre nicht Schüler Alfred Adlers, wenn ich bei der Diagnose stehen bliebe und nicht mit Aspekten der Hoffnung für die Zukunft schließen würde. Zwar heißt es bei Polgar: „Wien bleibt Wien, und das ist das Schlimmste, was man über diese Stadt sagen kann“, und sicher könnte es auch Gründe geben, diese Sentenz auf das ganze Land auszudehnen. Dennoch bin ich hoffnungsvoll und erlaube mir, dies mit den folgenden Argumenten zu belegen.
1. Es beginnt sich ein neues Selbstbewusstsein dieses Staates zu entwickeln. Das Land war ab 1867, ab dem so genannten Ausgleich mit Ungarn, unrettbar dem Untergang geweiht. Es war der ungarische Außenminister, der um 1912 gesagt hat: „Wir müssen uns selbst umbringen, bevor das die anderen tun.“ Und im Jahre 1918 begann die Verfassung des übrig gebliebenen Restes mit den Worten: „Deutsch-Österreich ist eine Republik, sie ist Bestandteil des Deutschen Reiches.“ Mit anderen Worten, das war ein Staat, der mit dem ersten Satz, den er aussprach, zugleich schon Selbstmord begangen hat. „Wann habt ihr dessentgleichen je gesehen?“, könnte man, Grillparzer variierend, sagen. Da war schon in der Wurzel „der Staat, den keiner wollte“, enthalten und damit der neuerliche Tod besiegelt.
Aber heute, glaube ich, seit 1945, ist die Situation eine andere. Hitler musste offenbar kommen und das von vielen ersehnte Ziel, den „Anschluss“, verwirklichen, um dem Österreicher ein für alle Mal begreiflich zu machen, was er an diesem Lande hat (das ist wieder eine so typisch österreichische Verhaltensweise selbstschädigender Art: erst zu wissen, was man besaß, wenn man es verloren hat – so verhält sich ja auch der Mann in diesem Lande, er vernachlässigt seine Frau und wacht erst auf, wenn er sie an einen anderen zu verlieren droht). Langsam, aber sicher wächst ein Bekenntnis zu diesem Österreich, ja darüber hinaus zu so etwas, was man die „österreichische Nation“ nennen könnte. Man sollte vielleicht nicht allzu viel darüber sprechen, um das Wachstum nicht zu stören. Auch wenn wir jetzt einen Justizminister haben, der sich nostalgisch als Deutschösterreicher bezeichnet (wofür diejenigen mit die Verantwortung tragen, die ihn diese Position erreichen ließen), wird das diesen Prozess nicht aufhalten. Stattdessen möchte ich nur Friedrich Torberg zitieren: „In einem Punkt allerdings sind diese Jungen besser dran als ihre Vorfahren: Wenn sie Österreich sagen, so wissen sie, was sie meinen, und wenn sie sich zu diesem Österreich bekennen, so wissen sie warum.“ Ich aber finde mit dieser Sentenz den Übergang zu meinem nächsten Punkt.
Читать дальше