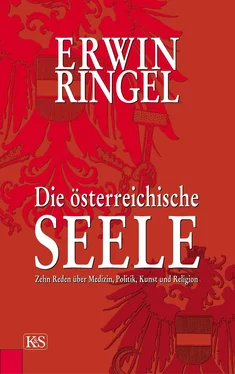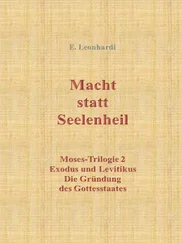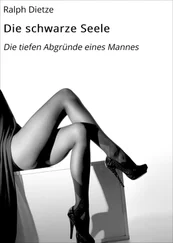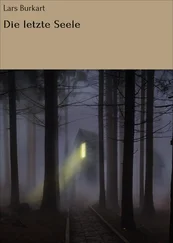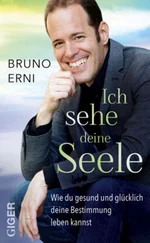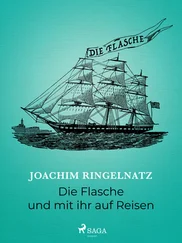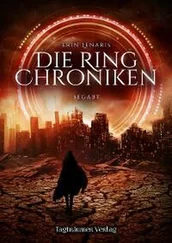Ich verdanke Wendelin Schmidt-Dengler den Hinweis auf zwei ähnliche Stellen in der österreichischen Literatur.
In Grillparzers „Der arme Spielmann“ (1848) beschreibt der Erzähler den Raum des unglücklichen Geigers, den dieser mit einem Handwerker teilen muss: „Der arme Spielmann hat seinen Teil von dem des Mitbewohners durch einen Kreidestrich getrennt, wodurch auf seiner Seite Ordnung, ja Pedanterie, auf der anderen Seite Unordnung und Chaos sichtbar werden.“ Die Hauptfigur in Wolfgrubers Roman „Verlust eines Sommers“ (1981), Martin Lenau, erinnert sich an seine Kindheit: „Den ordentlich verwalteten Teil seines Zimmers hat er von dem Durcheinander seines Bruders durch einen Kreidestrich getrennt.“ In beiden Fällen der „Äquator einer Welt im kleinen“ (Grillparzer).
Schmidt-Dengler meint, dass damit Ordnung und Anarchie einander gegenübergestellt seien – ich finde damit jedenfalls das Bild Beurdens bestätigt, das mich fasziniert und von dem ich überzeugt bin, dass es die Ambivalenz ebenso ausdrückt wie den Gegensatz zwischen bewusst und unbewusst. Da ist auf der einen Seite die Höflichkeit, diese Freundlichkeit, die zur Scheinfreundlichkeit oder, wenn ich dieses Wort verwenden darf, zur Scheißfreundlichkeit wird, ein „Entgegenkommen“, das sich als ungedeckter Wechsel entpuppt. Hier wird dir alles versprochen, du betrittst das (erste) Zimmer, Hoffnungen werden genährt, aber wenn du weg bist, bist du nicht mehr vorhanden, denkt der Mensch nicht daran, auch nur den kleinen Finger für dich zu rühren. „Groß ist das Wort und klein ist der Sinn“, sagt mein Freund Georg Kreisler, auch ein Vertriebener, nicht gewünscht in Österreich, weil er die Menschen ihr eigenes Bild im Spiegel sehen ließ, ein schweres Vergehen; heute will er hier nicht mehr auftreten. Und Peter Handke, der in „Wunschloses Unglück“ den tragischen Weg seiner Mutter in den Selbstmord beschreibt, kommentiert: „Es brauchte nur jemand mit dem kleinen Finger zu winken, und sie wäre auf den richtigen Gedanken gekommen.“ Und fügte resignierend hinzu: „hätte, wäre, würde“.
Ich glaube, dass für die hohe Suizidrate des Österreichers dieses Wechselbad, dieses (wenn man ahnungslos ist) Glauben und Vertrauen und Alles-Erwarten und dann dieses Fallen in einen umso schrecklicheren, tieferen Abgrund, in dieses finstere Loch der Enttäuschung und des Im-Stich-gelassen-Werdens, wenn Sie so wollen, in das zweite Zimmer, wesentlich mitverantwortlich ist. Und auch die Sprache des Österreichers kennt diese zwei Zimmer. Wenn es im österreichischen Lied von Wildgans heißt: „… einfach und echt von Wort, wohnen die Menschen dort“, so bekommt das heute für mich einen ganz anderen Sinn. „Echt von Wort“ heißt: „Es ist uns echt nicht zu trauen.“ Nicht zufällig bekommt hier der Satz „Ich werde dir schon helfen“ eine zweite Bedeutung – nämlich eine drohende. Und „einfach wohnen die Menschen dort“ erinnert eben an „die Zweizimmerwohnung, die wir haben“. In den unterdrückten, frustrierten Menschen, in denen diese Verzweiflung in der Kindheit erzeugt wurde, da lauert natürlich ein Hass. Er wird lange Zeit im zweiten Zimmer sorgfältig eingeschlossen und versteckt, aber er kann bei irgendeinem Anlass verhängnisvoll ausbrechen. Wie oft erschrecken dann Menschen über sich selber und sagen: „Ich habe gar nicht geahnt, dass solche böse Dinge in mir drinnen sind.“ Da tritt zum Beispiel dieser Neid hervor, wenn dem anderen irgendetwas gelingt: „… da ist der allerärmste Mann dem andern viel zu reich.“ Wenn einer irgendeine Entdeckung macht, ist der erste Gedanke: „Wieso ist das nicht mir eingefallen?“, und: „Wenn’s einem anderen gelungen ist, dann darf das einfach nichts wert sein.“ Die erste Herzoperation wird in Österreich erfolgreich durchgeführt – da steht schon am Tag vorher in der Zeitung, dass sie unüberlegt, viel zu früh aufs Programm gesetzt wurde, die Neidgenossenschaft tritt voll in Aktion.
Im „zweiten Zimmer“ finden sich aber nicht nur Neid und Hass, sondern auch Unsicherheit und Angst. Es ist ganz unfassbar – selbst der Psychiater, der an vieles gewöhnt ist, vermag es kaum zu glauben –, welche Ängste hier weit verbreitet sind. Jeder fürchtet jeden, hält ihn für einen Konkurrenten, einen potenziellen Feind, man beobachtet einander misstrauisch, stellt gleichsam schon weit draußen, im Vorfeld der Begegnung, Horchposten auf, jedes Gerücht über angeblich böse Absichten des anderen, und sei es auch noch so abstrus, wird geglaubt. Im Grunde sind das alles Folgen der missglückten Eltern-Kind-Beziehung: Eine Welt bricht zusammen, wenn das Vertrauen zu den Eltern verloren geht. Und weil ich bei der Angst bin, so möchte ich daran erinnern, wie leicht diese Angst wiederum zum Hass wird, z. B. zum Hass gegen alles Fremde. – Ja, die Österreicher verlangen in Südtirol zweisprachige Ortstafeln und Gleichberechtigung für die Minderheit. Aber was tun denn wir mit unseren Minderheiten? Dort stürmen und zerstören wir zuerst einmal die zweisprachigen Ortsbezeichnungen. Nun stehen sie zwar, aber verlangen Sie in Südkärnten auf slowenisch eine Fahrkarte, dann bekommen Sie keine und stattdessen die Antwort: „Kannst das net deutsch sagen?!“ – eine demütigend-sadistische Szene, die an faschistische Zeiten erinnert. Als mir die Auszeichnung zuteil wurde, für die Slowenen psychohygienische Vorträge halten zu dürfen, wurde mir folgende Geschichte erzählt: Slowenische Eltern hatten alles getan, um ihre Tochter deutschsprachig zu erziehen. Als sie einen Slowenen heiratete und damit für sich und ihre Kinder die slowenische Sprache an die erste Stelle setzte, klagten die Eltern: „Wir haben versucht, aus dir einen Staatsbürger erster Klasse zu machen, und nun zerstörst du mit einem Schlage unsere Bemühungen und machst dich wieder zu einem Menschen zweiter Klasse.“ Das heißt also: In Österreich muss man dem Slowenentum abschwören (ich glaube, die Situation der Kroaten im Burgenland ist besser), um ein „ordentlicher“ Staatsbürger zu werden. So gehen wir mit den Anderssprachigen um, die wir bis zum heutigen Tage mit dem Odium der „Verräter“ umgeben, obwohl wir nachweisbar die Volksabstimmung nach dem Ersten Weltkrieg ohne die slowenischen Stimmen niemals hätten gewinnen können! Nein, unter diesen Umständen hat der österreichische Unterrichtsminister Zilk vollkommen Recht, wenn er sagt: „Hört auf von Südtirol zu sprechen, bevor ihr nicht begonnen habt, in Österreich einwandfreie Verhältnisse zu schaffen.“
Und jetzt bin ich bei Wildgans, bei seinem Satz aus der „Rede über Österreich“: „Psychologie ist Pflicht im Zusammenleben der Völker!“ – Erfüllen wir diese Pflicht? – Ich muss es leider bestreiten. – Wir haben sehr lange eine einmalige Chance gehabt, im Herzen Europas eine „vorwegnehmende Zukunft“ zu gestalten, wenn wir bereit gewesen wären zur Verständigung und Partnerschaft, zu Gleichberechtigung und Achtung. Es hätte ein Experiment sein können, das den Weg gewiesen hätte zu den „Vereinigten Staaten von Europa“. Wir haben aber diese Chance – und das muss man doch einbekennen, statt larmoyant über den Untergang des „großen Reiches“ zu klagen – nicht wahrgenommen: Wir haben uns als Herrschende aufgespielt und ab 1867 hat es zwei Herrenvölker gegeben, die Österreicher und die Ungarn, die noch bis zum heutigen Tage daran schwer zu tragen haben, dass sie bei dieser Sache mitgemacht haben. Das ist wieder eine Wahrheit, die wir nicht „wahrhaben“ wollen! Sicher, wir waren relativ menschlich. Wenn Sie nach Polen gehen – das unglückliche Land war zwischen Russland, Deutschland und Österreich aufgeteilt –, können sie noch heute hören: Die Österreicher waren die mildesten Herrscher. Sicher – aber eben doch Herrscher. Und so haben wir eigentlich die Psychologie des gegenseitigen Verständnisses, die Wildgans zu Recht als Pflichtgegenstand bezeichnet, haben wir die eben nicht beherrscht! Und darum sind wir als Vielvölkerstaat im Zeitalter des Nationalismus zugrunde gegangen; es wird vielleicht Jahrhunderte dauern, bis diese Chance von damals wiederkommt.
Читать дальше