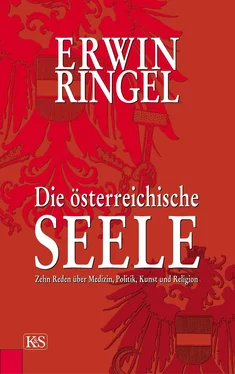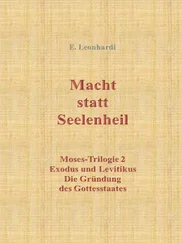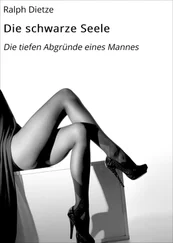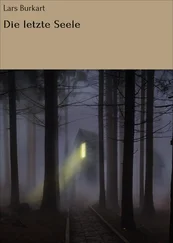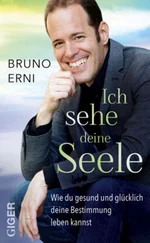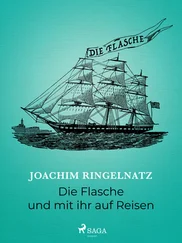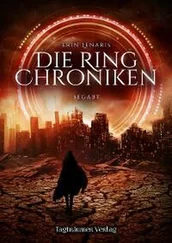Alexander Mitscherlich hat das große Buch „Die Unfähigkeit zu trauern“ geschrieben. Betrifft die Unfähigkeit, die eigene Schuld einzugestehen und sie damit zu verarbeiten (Trauerarbeit), wirklich nur die Bundesrepublik, betrifft sie nicht ganz genau so auch Österreich? Als ich zum 60. Geburtstag von Mitscherlich die Laudatio im Rundfunk halten durfte und törichterweise bereit war, sie schon vorher auf Band aufnehmen zu lassen, musste ich zu meinem Entsetzen feststellen, dass gerade die Passage, wo ich auf die Mitschuld Österreichs hingewiesen hatte, einer Streichung zum Opfer gefallen war. Zufall war dies wohl kaum, vielmehr ein Beweis mehr dafür, wie intensiv der Verdrängungswunsch ist und dass er sich (heute mehr denn je) auch auf Menschen in sehr einflussreicher Position stützen kann, auf die „Verlass“ ist.
Noch eine Bemerkung: Kann man im Begriff der Kollektivschuld untertauchen, der persönlichen Verantwortung damit entkommen? Wenn man bereit ist, sich einem Kollektiv einzuordnen, welches dem Gesetz der Massenpsychologie unterliegt, wo man also andere für sich denken lässt und nur Befehle ausführt, so bleibt man doch verantwortlich dafür, dass man sich zu einem Mitglied einer solchen Pseudogemeinschaft hat machen lassen. Es gibt also keine Kollektivschuld, sondern nur eine Schuld Einzelner, die das Kollektiv bildeten.
Ich sage das alles nicht zum Anklagen, nicht um Gerichte zu konstituieren, Schuldsprüche und Rache zu verlangen, Menschen aufzufordern, als Büßer in Sack und Asche herumzugehen! Das kann niemand wollen, dem an Österreichs Zukunft etwas gelegen ist. Was wir wollen, ist vielmehr echte Versöhnung! Vor einiger Zeit hat ein Politiker der Freiheitlichen Partei Österreichs die Ansicht vertreten, es sei Beweis genug für die Versöhnungsgesinnung dieser Partei, wenn nun eines ihrer prominentesten Mitglieder bereit sei, den Posten eines Dritten Nationalratspräsidenten anzunehmen, das enthalte ja ein Bekenntnis zu Österreich. Dies ist – ich möchte es mit größtem Nachdruck betonen – nicht die Art der Versöhnung, die ich mir vorstelle. Ich sprach von einer Versöhnung, die auf Einsicht beruht, auf einer Erkenntnis, auf dem Bekenntnis: Das habe ich falsch gemacht. Der schon zitierte Mitscherlich hat einmal gesagt: „Identität haben, das heißt die tausend Irrtümer einzugestehen, die man im Verlauf seines Lebens durchgemacht hat, da, dort und dann; denn unser Leben ist eine Kette, eine Aneinanderreihung von Irrtümern, von Fehlern.“ Errare humanum est. Das Menschliche ist das Irren, aber es hat nur dann einen Sinn, wenn wir unsere Irrtümer erkennen, nur so können wir durch Schaden klug werden und nur so kann es uns helfen, unsere Identität zu finden. Und da bin ich bei der Feststellung, dass natürlich unsere Vergangenheitsbewältigung entscheidend ist für die Beziehung der älteren Generation zu der Jugend, um die es mir ganz besonders geht. Wenn auf die schicksalhafte Frage: „Wie war eine solche Unmenschlichkeit möglich?“, die Eltern antworten: „Ja, wir haben das falsch gemacht“, dann würden sie in den Augen der Jugend sicher nicht verlieren, sondern ganz im Gegenteil gewinnen. Vor einigen Tagen wurde im Fernsehen ein Porträt von Hilde Krahl, der berühmten Schauspielerin, gezeigt. Ganz vorsichtig und behutsam hat sich der Reporter vorgetastet: „Gnädige Frau, Sie haben doch Karriere gemacht in diesen sieben Jahren, in dieser schrecklichen Zeit. Sie waren mit so vielen Juden befreundet, haben den Nationalsozialismus sicherlich abgelehnt: Haben Sie da nicht mitunter bei dieser Karriere ein schlechtes Gefühl gehabt?“ Und ohne jedes Zögern antwortete Hilde Krahl mit jener Aufrichtigkeit, die uns allen gut anstünde und die uns weiterbrächte: „Ja, sehen Sie, das war wirklich schrecklich. Ich hab’ nur immer gedacht, mach den nächsten Film und wieder den nächsten, dann bekommst du Geld und kannst mit deinen Angehörigen der sozialen Enge entkommen. Und dafür, dass ich das damals gedacht habe, dass ich nicht das Einzige getan habe, was ich hätte tun müssen, nämlich wegzugehen, dafür schäme ich mich heute noch immer aufs Neue.“ Ich zögere nicht zu bekennen, dass ich da am liebsten aufgesprungen wäre, um diese wunderbare Frau zu umarmen, und möchte, dieses Thema abschließend, noch darauf hinweisen, dass uns nicht mehr viel Zeit bleibt, die notwendige Vergangenheitsbewältigung durchzuführen. Über kurz oder lang wird die betroffene Generation nicht mehr am Leben sein und aus der psychotherapeutischen Erfahrung wissen wir, dass der Tod ein schlechter Löser von Problemen ist.
Ich möchte in diesem Zusammenhang noch etwas über die Sprache des Österreichers sagen: Er hat sie zunehmend in den Dienst der Verdrängung gestellt und insofern ist die Feststellung Helmut Eisendles „Österreich ist seine Sprache“ zutreffend. Der Außenminister Frankreichs, Talleyrand, ein großartiger Diplomat, hat einmal gesagt: „Worte sind dazu da, die Gedanken zu verbergen.“
Was in der Politik sinnvoll sein mag, ist aber für das menschliche Zusammenleben eine Katastrophe. Trotzdem haben wir uns eine Sprache angewöhnt, die aus Phrasen und Formeln besteht und die Perpetuierung des spanischen Hofzeremoniells im Rhetorischen bedeutet (es gibt namhafte Forscher, welche die bis zum heutigen Tage anhaltend hohen Suizidraten in den ehemaligen Teilen der österreichisch-ungarischen Monarchie damit in Zusammenhang bringen – Sprachverarmung ist immer mit erhöhter Selbstmordgefahr verbunden!). Jedenfalls haben wir zu reden gelernt, ohne Gefühle äußern zu dürfen (zu müssen), und damit verlernt, sie ausdrücken zu können, wir verstecken uns also vor den anderen. Sprachnot hat in diesem Sinne Entfremdung und Isolation zur Folge. Nach neuesten Ergebnissen treffen vier von zehn Erwachsenen in Österreich nur ein bis drei Bekannte pro Monat! 1,4 Millionen Österreicher haben in normalen Monaten (außerhalb der Arbeit) praktisch gar keinen Kontakt zu Freunden, Ehepaare sprechen im Durchschnitt sieben Minuten pro Tag (!) miteinander. Vielen Betroffenen bleibt nichts anderes übrig als zu „verstummen“, „alles in sich hineinzufressen“, wie sie sagen, was vor allem psychosomatische Erkrankungen zur Folge hat, manche ersticken im übertragenen Sinn an ihrem unbewältigten, nicht entäußerbaren Gefühl. Es darf in diesem Zusammenhang nicht der fast übermenschliche Versuch von Karl Kraus vergessen werden, der österreichischen Sprache – ich darf diesen Ausdruck gerade im Zeichen dieses großen Verkünders verwenden, der gesagt hat: „Die gleiche Sprache ist es, die den Österreicher von den Deutschen unterscheidet.“ – wieder ihren Wert zurückzugeben und sie zur Grundlage einer aufrichtigen und wahrhaft menschlichen Kommunikation zu machen: Er wurde in der Umgangssprache ebenso zu Fall gebracht, wie sein Schöpfer ein typisches österreichisches „Mahner-Schicksal“ erlitten hat.
Dritte These: Damit sind wir bei einem wichtigen Punkt: Die Verdränger haben vor niemandem so große Angst wie vor denjenigen, die kommen und versuchen, diese Verdrängung aufzuheben. Darum sind die Mahner, die Aufdecker die Wahrheitssucher, die Propheten in diesem Lande nicht erwünscht. Ich komme zurück auf die Rede von Anton Wildgans: Dort zählt er eine Reihe großer Namen auf, die den Ruhm unseres Vaterlandes ausmachen. Man darf aber nicht fragen, unter welchen Bedingungen die meisten von ihnen hier leben mussten, unter welchen Umständen sie gestorben sind. Man wird unwillkürlich an den Mahler’schen Ausspruch erinnert: „Muss man denn hier immer erst tot sein, damit sie einen leben lassen?“ Die gute Nachrede setzt jedenfalls immer erst nach dem Tode ein, zu Lebzeiten erscheint die Größe, nach dem Ausspruch Grillparzers – der es am eigenen Leibe erfuhr –, gefährlich und wird erbittert bekämpft. Es ließe sich ein Schattenzug zusammenstellen tragischer Art, um dies zu beweisen. Ich will nur ein paar Beispiele bringen, die mir so besonders wichtig sind in unseren Tagen. Zuerst einmal Gustav Mahler, den man mit Intrigen aus der Staatsoper verjagt hat, als deren Direktor er durch zehn Jahre Maßstäbe gesetzt hatte, die bis zum heutigen Tage nicht erreicht worden sind – er musste die Flucht in die Fremde antreten. „Leb wohl!“ – die Worte, die er so oft auf die Partitur seiner „Zehnten“ geschrieben hat, in Verzweiflung –, es stellte sich für ihn und für viele andere Bedeutende heraus: Man kann hier nicht wohl leben, wenn man ein Prophet ist. Das „Leb wohl!“ bekommt dann die andere Bedeutung: „Adieu, weg, fort mit dir!“ Und ein Prophet war er; seine Musik erschaute den bevorstehenden Untergang, während die anderen nichts ahnend blind in den Abgrund tanzten.
Читать дальше