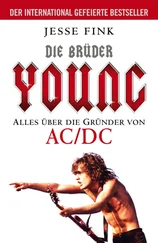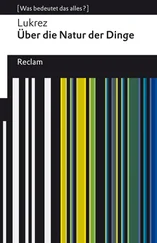Worüber er geschrieben habe, wollte sie wissen.
«Adorno.«
Adorno? Dann spreche er ja Deutsch?
Er nickte. Er liebe die deutsche Philosophie, die deutschsprachige Literatur, erklärte er, indem er aber keineswegs deswegen ins Deutsche wechselte, er liebe: Heine, Kafka, Musil, Brecht, Bernhard. Hesse natürlich nicht, Mann nur bedingt, selbstverständlich die Klassiker, also was Schiller da gemacht habe, sei ja wohl …, aber auch Goethe, aber vor allem auch Hölderlin. Auch das deutsche Theater, sagte er, sei dreimal deswegen in Berlin gewesen, ob sie Berlin kenne. Seine Augen blickten im Taxi umher, als ob es zu klein wäre für diese Namen, für seine Begeisterung. Auch das deutsche Frühstück übrigens,»euer Frühstück«, sagte er, allein deswegen lohne es sich, lohne sich Deutschland, sagte er gestikulierend. Betty musste wirklich lächeln.
Hier dagegen glotze man nur fern. Er sank etwas ein auf seinem Sitz. Die Fernseher sollte man ihnen abnehmen als Erstes, sagte er, den Familien in den dunklen Erdgeschosswohnungen in dunkler schmaler Gasse, wo niemals ein Sonnenstrahl den ganzen Tag, sommers wie winters nicht, hineinfalle, sagte er, indem er sich wieder aufrichtete, aber diese Familien, die mit acht oder zehn Leuten vielleicht in einem Raum lebten, auf 20 Quadratmetern, Wäsche über die Gasse gespannt, wo den ganzen Tag der Fernseher laufe mit seinem armseligen amerikanischen Programm und das letzte Fünkchen Menschengeist vergifte (er hielt beide Hände vor seinem Gesicht so, dass sich die in die Höhe weisenden Fingerkuppen alle berührten), diese Familien wolle man natürlich absichtlich dumm halten und in die Fänge der Camorra treiben, als Drogenkuriere und Mörder die Söhne, während die Mädchen Dummköpfe heirateten aus lauter Not, Camorrabosse; den Fernseher müsse man ihnen als Erstes abnehmen, den oberen wie den unteren.
Sie wusste nicht, warum, aber wieder musste Betty lachen. Auch er lachte aus Sympathie, schien es, mit, obwohl er bitterernst meinte, was er sagte. Dass nämlich, fuhr er fort, genau dies Kommunismus sei! den es bisher übrigens noch nie, in keinem Land der Welt, nicht in der Sowjetunion natürlich, nicht in der DDR, nicht in Kuba und natürlich nicht in China je bisher gegeben habe, weswegen auch natürlich nicht von einem Scheitern eben jenes Kommunismus die Rede sein könne, wenn er das schon höre, dieses Gerede von der großen, aber nach dem Mauerfall leider gescheiterten Utopie, nein und noch mal nein, es habe ihn einfach noch nicht gegeben, diesen Kommunismus, in welchem auch der Gabelstaplerfahrer Petrarca lese und nicht fernglotze, aber es werde ihn geben, denn auf das Scheitern des globalisierten Kapitals folge als historisch logische Konsequenz der Weltkommunismus.
«Und wenn der Gabelstaplerfahrer vor lauter Petrarca-Lesen dann keine Lust mehr hat, Gabelstapler zu fahren?«, fragte Betty.
Er, von dem sie den Namen noch nicht kannte, nur die Geisteshaltung, antwortete, als hätte er nur auf diesen Einwand gewartet:»Er soll aufhören, Gabelstapler zu fahren. «Die Gesellschaft brauche, sagte er, wie er es sicher schon oft gesagt hatte, im Grunde keine Gabelstaplerfahrer mehr, weil die Technisierung den Menschen ja wohl vom Zwang zur Arbeit befreit habe und man nur akzeptieren müsse, dass es Arbeitslosigkeit gar nicht gebe , ein Irrglaube, das längst überkommene Dogma der Lohnarbeit, sagte er. Dies habe der moderne Kommunismus übrigens mit dem Katholizismus gemeinsam, dass er Arbeit als Übel betrachte, welches es zu überwinden gelte, man denke an die mittelalterlichen Darstellungen des Heiligen Isidor, der im Vordergrund des Bildes bete, also eigentlich nichts tue, während im Hintergrund ein Engel sein Feld pflüge, eine Vision, sagte er, die heute Wirklichkeit werden könne, wenn nur die Erträge anders verteilt würden, genug sei ja da. Dies nämlich sei der eigentliche Fortschritt, dass der Gabelstaplerfahrer nicht mehr Gabelstapler fahre, sondern selbst Gedichte schreibe und trotzdem zu essen habe. Er verstummte. Eine Pause entstand, in der er innehielt und ganz zu vergessen schien, was er noch sagen wollte, und sie nur anblickte mit Augen, die plötzlich weich wurden, als sei alles gesagt, bis sie beide sich abwandten und schweigend zu entgegengesetzten Seiten aus dem Taxi sahen.
Als der Wagen am Corso Vittorio Emmanuele angehalten hatte, um Betty aussteigen zu lassen, warf Alfredo Sandri, der sich inzwischen auch namentlich vorgestellt hatte, in einem wortreichen und relativ umständlichen Diskurs die Möglichkeit in den Raum, Betty könne auch einfach sitzen bleiben und mit ihm nach Montesanto fahren, wo er wohne, wo er etwas kochen könne, Wein sei schnell besorgt, schließlich wäre heute fast ein Feiertag geworden, der Tag seiner beinahe bestandenen Disputation, ob sie Muscheln möge oder Tintenfisch, sie könne es sich gemütlich machen, während er nur schnell einkaufen gehe. Sie könne inzwischen Kafka lesen oder Petrarca oder Zeitung oder Asterixhefte. Sie müsse aber auch nicht lesen, sie könne auch einfach aus dem Fenster sehen. Er blinzelte mehrfach, fuhr sich mit der Hand durchs Haar und fügte in plötzlich verändertem Tonfall an, dass er all das vermutlich gar nicht hätte sagen sollen, denn sie, er wisse es ja längst, werde ohnehin ablehnen, und da er, anders als die mittelalterlichen Sänger, keine Ritterrüstung trage, werde er verletzt werden von der Lanze ihrer Ablehnung, aber sie solle ruhig ablehnen, denn natürlich könne er auch allein und verletzt zu Abend essen, aber zu zweit wäre es halt trotzdem schöner, aber es macht nichts.
Der Taxifahrer schüttelte seit Minuten den Kopf im Rückspiegel. Daran baumelte ein Papst Johannes Paul II. aus Plastik. Und Betty musste schon wieder lächeln, weil dieser Alfredo Sandri, auf einmal unsicher, schüchtern fast, mit seinen Fingern lose Fäden um ein kleines Loch am Oberschenkel seiner Jeans zusammendrehte.
«Also gut«, sagte sie.»Muscheln wären eigentlich super. «Der Papst baumelte beim abrupten Anfahren, schlug und klackte gegen den Spiegel.
In Montesanto wohnte er in einer engen Gassenschlucht, deren Pflasterbelag aufgerissen war und sich am Straßenrand türmte, so dass brauner Morast jetzt breiig den Berg hinabströmte und das Taxi wirklich nicht hineinkonnte. Der Fahrer verlangte einen Unwetterpreis, der eine Frechheit war, wogegen aber selbst ein Alfredo mit seinem neapolitanischen Fluchen nichts ausrichten konnte.
Der Regen war schwächer geworden. Sie liefen steil bergan, stiegen dann Treppenstufen, über glitschiges, teils mit Moos bewachsenes Pflaster. Ganz oben, am Ende der Treppe, wo kein Fahrzeug je hinaufkann, aber rätselhafterweise dennoch Vespas geparkt waren, blieb Alfredo stehen, um ein riesiges Tor aufzuschließen. Der Palazzo ragte steil in den Himmel, erbaut in der Renaissance, seien es ursprünglich vier Etagen gewesen, die nachträglich mit weiteren aufgestockt worden seien, erklärte er. Ganz oben, auf der Terrasse, wohne er. Es gebe einen Fahrstuhl, der aber sei seit Jahren defekt.
Eine abgetretene Marmortreppe wand sich hinauf um den quadratischen luftigen Innenhof. Vögel flatterten, Essensgeruch und Stimmen wehten, ein neapolitanischer Popschlager aus einem Radio, und immer wieder eröffnete sich durch rundbogige Fenster ein Blick in den Himmel, über die Stadt. Betty staunte, sah zweifelnd die jeweils nächste Treppenwendung vor sich aus dünnem hellem Marmor, jahrhundertealt, und in den beiden oberen Stockwerken schlängelte man sich durch die Pfeiler einer Stahlgerüstkonstruktion, die das alte Mauerwerk abstützen sollte. Schließlich gebe es ja den Vesuv, es gebe die Erdbeben, kochende Erde, erklärte Alfredo, die vulkanischen Phlegräischen Felder.
Das Appartement, hoch über der Stadt, war winzig, Anfang des 20. Jahrhunderts sei es erst dort hinaufgesetzt worden, weil der Wohnraum knapp gewesen sei. Ohne erst in einen Flur zu gelangen, stand man sofort in einer kleinen Wohnküche voller Bücher, die in Stapeln auf dem Fußboden lagerten, weil die Regale schon voll waren, außerdem gab es ein Bad und ein Schlafzimmer, groß genug für ein Bett. Man könne nur hoffen, so Alfredo, dass Fundament und Mauerwerk noch eine Weile trügen. So aber sei die gesamte Stadt, mehr oder weniger, man stehe hier allerorten auf schwankendem Boden. Er lächelte entschuldigend, die Hände in den Taschen, und hob die Schultern. Ob sie sich umziehen wolle …, fragte er, natürlich müsse sie sich umziehen, sie sei ja komplett durchnässt, sie könne auch duschen selbstverständlich, während er einkaufe. Sie aber hatte die Glastür entdeckt, deutete hinaus.»Die Terrasse«, sagte Alfredo, nicht ohne Stolz, diese sei die eigentliche Wohnung, aber ob sie sich nicht lieber erst umziehen …
Читать дальше