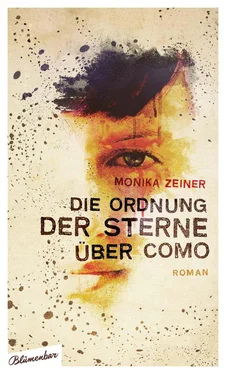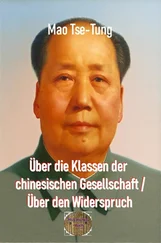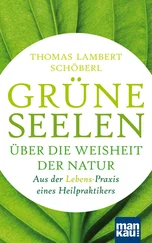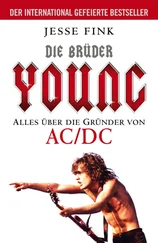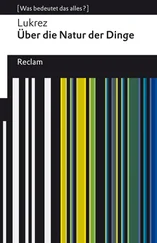Jeden Tag wird fortan ferngesehen. Er sieht alles, was sich anbietet, und es ist viel. Er hat nicht mehr die Kraft, hinaufzusteigen in seine Dachkammer, nur spät nachts, wenn die Luft dünner ist, fließender im Haus, kann er sich so weit bewegen, die Stufen zu überwinden. Seine Mutter aber ist froh, sagt sie, dass er fernsieht. Es bringe ihn auf andere Gedanken, sagt sie, und er nickt dazu, aber es stimmt nicht, er hat nur einen Gedanken, einen einzigen, den er aber nicht fassen, nicht scharf stellen kann, weil er sich irgendwo zwischen seinem Gehirn und dem Universum befindet, erahnt und vertraut, aber unerreichbar wie das kalte Leuchten eines fernen Planeten.
Auch wird von nun an jeden Tag gegessen. Das Nahrungs-Ich wird jeden Tag vorbildlich von ihm mit Nahrung gestopft, geradezu ausgestopft. Je mehr er isst, desto mehr kann er essen. Und immer mehr wird von der Mutter auf den Couchtisch gestellt, außer den Mahlzeiten noch Erdnussflips und Chips und Salzstangen. Immer wieder füllen sich Schälchen, füllen sich Teller, weil seine Mutter, so sagt sie, ja froh ist, dass er isst. Aber sie wirkt nicht froh, seine Mutter. Manchmal weint auch sie, während sie vor dem Fernseher sitzt, auch bei lustigen Sendungen wird manchmal geweint. Seit nicht mehr gestritten wird, wird in diesem Haus geweint. Auch der Vater, Gerhard Holler, vor allem wenn er betrunken ist, neigt zum Weinerlichen. Das Streiten, das sich nicht mehr zu rentieren scheint, ist einer Weinerlichkeit gewichen, die weniger Kraft zu kosten und die mit Hilfe des Alkoholkonsums jederzeit abrufbar zu sein scheint. Was in den Mund des Gerhard Holler hineinfließt, scheint es, tritt leicht durch die Augen wieder nach draußen. Er plant, in die Frühpensionierung zu gehen, wie er sagt, und schrumpft schon jetzt sein Arbeitspensum zusammen, auch das Lebenspensum scheint er schon jetzt zusammenzuschrumpfen, nur das Trinkpensum nicht. Das Trinkpensum, das Fernsehpensum und das Essenspensum, denkt Tom, sind diejenigen Dinge, die im Wachsen begriffen sind in diesem Haus. Der Fernseher, das Essen und das Trinken, denkt Tom, werden noch lange Jahre so weiterleben in diesem Haus, auch dann noch, wenn wir alle längst tot sind.
Als vor den Fenstern des Hauses Blätter wehen, als die Vögel sich ein letztes Mal von ihren Stromleitungen in den Himmel stürzen, der leer ist wie ein trockenes Schwimmbecken, wird Tom von seinem Vater um ein Gespräch gebeten. Es kommt der Tod der Lady Diana im Fernsehen, die sich, aus Versehen oder aus anderen Gründen, zusammen mit ihrem Liebhaber an einem Betonpfeiler in Paris getötet hat. Tom bedauert sie nicht, er beneidet sie. Zum ersten Mal seit Monaten erscheint ihm wieder etwas erstrebenswert. Ob er den Fernseher mal ausstellen kann, fragt ihn der Vater. Er kann doch nicht den ganzen Tag fernsehen, fährt er fort, indem er auf die Fernbedienung drückt und das Gesicht der Lady Diana vom Bildschirm mit einem Zucken verschwinden lässt. Es kommen Rechnungen an aus Berlin, sagt er, schon seit Monaten, die Rechnungen, die sie bisher stillschweigend bezahlt haben. Aber irgendwann, sagt der Vater, muss es auch genug sein. Das Leben gehe weiter, sagt sein Vater. Dann schweigt er, sieht auf seine Knie hinab. Er, Thomas, sei jung, er habe das ganze Leben noch vor sich.»Das Leben«, sagt er, dann bricht er ab. Langsam erhebt er sich, läuft zur Tür, aber als er im Begriff ist, sie zu öffnen, sagt Tom:»Warum habt ihr mich in die Welt gesetzt?«
Der Vater hält inne. Sein Rücken zuckt, als stäche diese Frage in seine Wirbelsäule. Er senkt den Kopf, dreht sich langsam zu seinem Sohn. Er öffnet den Mund und weiß keine Antwort.
Weil endlich etwas geschehen, sich verändern muss, hat sein Vater für Thomas eine Arbeit in einer Möbelfabrik besorgt. Jeden Morgen um zehn vor sieben steht Thomas rauchend vor der Produktionshalle, deren Milchglasscheibenlichter fahl und viereckig in die Dämmerung ragen. Gedämpftes Pumpen und Dröhnen der Maschinen. Er steht etwas abseits, wird für arrogant gehalten, man weiß, dass er Musiker ist, der Sohn vom Schreibmaschinen-Holler, der etwas Besseres sein möchte.
Er ist froh, wenn es sieben ist, wenn die Schicht beginnt, denn dann wird der Tag eingeteilt, organisiert vom Rhythmus seiner Maschine, die verschiedenfarbige Punkte auf Stuhllehnen stanzt. Rot, grün, gelb. Manchmal verwechselt er sie oder spannt die Lehnen verkehrt herum ein, dann lässt er sie heimlich in einem der riesigen Müllcontainer verschwinden. Manchmal fragt er sich, wer auf diesen Stühlen sitzen wird, überlegt, dass es schön wäre, heimlich einen Gruß zu hinterlassen.
In der Frühstückspause, von 9.20 Uhr bis 9.40 Uhr, wird draußen geraucht. Die hohen Aschenbecher stehen auf dem Treppenabsatz vor den Aufenthaltsräumen. Es sind viele Frauen, die rauchen. Manche tragen Gummistiefel, alle Kittel, haben Thermoskannen mit Tee unter die Achseln geklemmt.
Einmal lächelt ihn eine an, eine jüngere. Sie lehnt an der Mauer, ein Wind streicht durch ihr Haar, als sie an ihrer Zigarette zieht.»Scheißjob, oder?«, sagt sie. Tom schweigt, hebt die Schultern. Zum Glück sei schon Mittwoch, sagt sie. Der Wochenanfang, sagt sie, sei immer schwierig, aber ab Mittwoch gehe es dann schnell, sagt sie.»Es ist wie mit dem Morgen, der vergeht auch langsam. Die zwei Stunden bis zur Frühstückspause«, sagt sie,»sind echt der Horror, aber ab Mittag geht’s dann.«
Tom nickt, hat Ähnliches festgestellt. Ob es mit dem Leben genauso ist, fragt er sich. Ob auch das Leben ab Mittwoch schneller vergeht? Und wann ist Mittwoch im Leben, fragt er sich und betrachtet das Schuhgitter am Boden, durch das Gräser wachsen, dazwischen aufgeweichte Zigarettenfilter.
Manchmal nimmt er nicht den Bus, sondern geht zu Fuß zur Arbeit oder nach Hause. Er geht über die Hügel. Es ist kalt. Es ist Herbst. Plötzlich merkt er, dass seine Heimat schön ist. Er hat es nie gesehen, jetzt mit einem Mal sieht er es. Die weite Höhe, der Raureif, der auf den Wiesen liegt wie Licht. Der Feldweg, der das Land durchschneidet, schmaler und schmaler zur Hügelspitze hin sich verengt, ein unendliches Versprechen. Tom läuft den Berg hinauf, zum höchsten Punkt, sein Atem geht rasch, oben bleibt er stehen und schaut hinab ins weite Tal, das sich in sanften Hügeln wie Wellen eines grünen Meeres bis zum Horizont ausdehnt. Dazwischen die dunkleren Inseln der Wälder, Dörfer. Hoch über ihm gehen Wolken, rasch getrieben vom Wind. Und er sieht, dass es schön ist. Ein Schluchzen sprengt seine Brust, er wächst, breitet die Arme aus, um das alles zu umarmen, das alles zu begreifen, die Wiesen, die Täler, die Bäume, die Zeit und die Traktoren, jene, die vor ihm gelebt haben, und jene, die nach ihm kommen, all die Komponisten und Dichter und Fabriken und Tiere, den Herbst und den Winter, den Frühling auch und die liebe Sonne, die ein Teil ist des Ganzen, wie all die Insekten, die Autos, die Musik, seine eigenen Hände vor dem Himmelsblau, und während das alles gleichzeitig in ihn strömt wie in ein plötzlich geöffnetes Vakuum mit einer Gewalt und Fülle, die ihn fast platzen lässt, geht er in die Knie, sinkt auf die schmale Fahrstraße nieder, wühlt seine Hände ins Gras der Böschung, tief in die Grasnarbe, denn da ist kein Unterschied, nirgends: Marc! Er ruft diesen Namen ins Weltall. Immer wieder. Marc! Denn Marc kann nicht weg sein. Er schreit, bis er kaum mehr Luft hat und keine Stimme und er den Kopf auf die Straße sinken lässt, wo die Schottersteine hart in seine Schienbeine drücken, in sein Gesicht. Er weint lange. Dann schämt er sich. In der Ferne, sich nähernd, das Röhren eines Traktors.
Der Winter aber kommt und geht wie ein weißer Atemhauch. Das hat einmal seine Großmutter gesagt, als er ein kleiner Junge war. Das Leben, hatte sie gesagt, sei vom Alter, dem Ende aus besehen, wie ein Atemhauch, wenn man bei Frost das Fenster öffne und hinausblicke, mehr nicht. Oft hatte sich Tom seine Großmutter vergegenwärtigt, wie sie am Fenster steht und ihren weißen Atem einen Wimpernschlag lang in die eisige Luft hineinstellt, wie sie anschließend das Fenster schließt und in die Dunkelheit zurücktritt, aus der sie gekommen ist.
Читать дальше