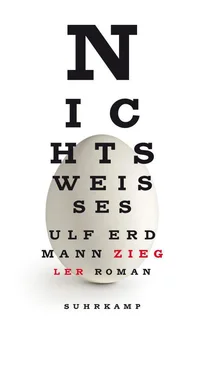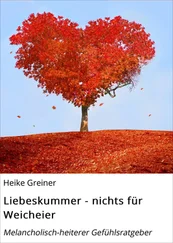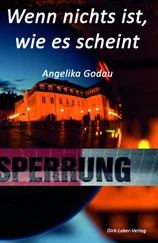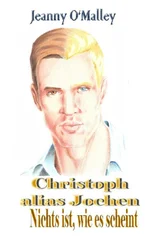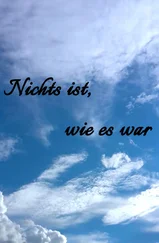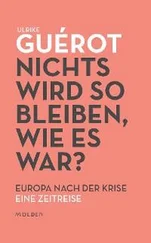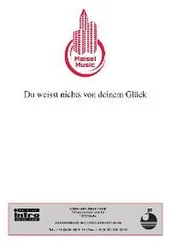Beim Frühstück stellte sich heraus, dass die Wohngemeinschaft dem Haus guttat. Linus, der sich einen» aufgeklärten Konservativen «nannte, wurde gefoppt von Cristinas Lover, der ihm sagte, dass er dann der erste wäre. Valli machte sich lustig über die katholische Kirche. Er sagte, sie betrachte ihn für immer als ihr Kind, er aber leugne die Vaterschaft. Dabei schaute er Marleen auf eine bestimmte Weise an. Der Schatten aus der Waldorfschule, Babs, war behende in der Küche und überhörte alles, was bösartig klang. Sie passte nicht zu Linus. Es geht wieder nur ums Poppen, dachte Marleen. Bei Tageslicht besehen, war sie noch nicht einmal dagegen. Zumal sie niemand mehr in die Kirche nötigte. Mama und Valli gingen zu einem protestantischen Gottesdienst, der schon um vier stattfand, weil es nur mit Kindern richtig voll wurde. Cristina nutzte die Gelegenheit, um sich mit ihrem Verehrer einzuschließen. Marleen lag auf dem uralten Flokati — so ein Drecksding! — vor dem Fernseher und wälzte ihr Unglück. Am zweiten Weihnachtsfeiertag nahm sie die S-Bahn nach Köln und von Köln den Zug nach Paris.
Dort wartete, auf der Kommode im Flur bei den Jaccottets, ein Brief von Franz. Marleens Herz raste, während sie zur Kammer hinauflief. Diese gestochene Schrift. Da stand nicht» Marleen …«, da stand» Liebe Marleen «und» Ganz Dein Franz«. Sie raufte sich die Haare. Sie weinte ein bisschen, bevor sie las, zur Vorbeugung.
«Liebe Marleen,
ich habe beschlossen, in den Dienst der Kirche einzutreten, und ein Gelübde der Keuschheit abgegeben. Schon vor Paris. Du, ich glaube es so sagen zu müssen, hast mich verführt. Das kannst Du. Ich habe mich gefragt (während das geschah), wozu es gut sein soll, weil alles, und sei es im letzten Winkel, sein Gutes hat.
Es ist nicht möglich, zu Dir zurückzukehren. Ganz im Gegenteil, ich werde Dich meiden müssen. Das Kind aber ist der Sache Sinn. Ich werde mich den väterlichen Pflichten, was Geld angeht, nicht entziehen. Mir ist völlig klar, was das alles für Dich bedeutet. Und ich würde Dich bitten, Dich nicht an mir zu rächen; in der naheliegenden Weise, meine ich. Es würde mir das Herz brechen. Ganz Dein Franz«
In der Küche traf sie Ann, die allein war. Marleen, verweint, versuchte nichts zu verbergen. Ann, anders als Pierre, berührte sie nicht. Sie saß ihr gegenüber und hörte zu.
«Ich höre dich«, sagte sie mehrmals, als sprächen sie über Funk miteinander.
Zum Silvestergottesdienst der deutschen lutherischen Kirche waren erschienen: die Jaccottets komplett, Passeraub mit den fast erwachsenen Töchtern, Furrer mit seiner äthiopischen Frau, Fränzi Lüthi mit ihrer Schwester. Die Predigt hielt Pastorin Passeraub. All das war neu für Marleen, die, am Ende ihrer Tränen, nahezu willenlos, zwischen David (mit Bärli) und Furrer (»mein Ex, übrigens«, flüsterte Ann ihr ins Ohr) in der zweiten Reihe saß. Man dankte Gott und pries ihn für seine weisen Entscheidungen. Einmal drehte sich Passeraub in der ersten Reihe um und sah Marleen lange an. Sie wusste, dass sie nie diesen Glauben teilen würde. Aber es war ein offenes Angebot. Sie würden sie nicht fallenlassen. Nicht mit Kind. Das war die Bedingung. Es war der Vorabend ihres dreiundzwanzigsten Geburtstags.
Marleen ging nicht mehr zu Fuß zur Arbeit und sie machte sich auch nicht mehr viel aus Schriften an Wänden. Sie kam sich durchsichtig vor, als könnte man in ihrem Leib den fischstummen Embryo mit den riesigen Augen sehen, so wie auf den schwedischen Fotografien. Sie fühlte sich überhaupt angeschaut, von Passanten, Kollegen, Boten, als stünde ihr das Geheimnis, das Geheimnis der Erwachsenen, auf die Stirn geschrieben. Sie selbst beobachtete nun die anderen Frauen mit den gespannten Bäuchen, was ihr bisweilen ein verschworenes Lächeln einbrachte, das sie, so gut es ging, erwiderte. Aber es wurde dadurch nicht besser. Sie vermisste Franz Tag und Nacht.
Sie wurde von grausamen Träumen heimgesucht, als würde sie einer Inquisition unterzogen.»Du bist doch schwanger«, sagten sie.
«Ja«, erwiderte sie,»ich bin schuldig geworden.«
«Du träumst von einer eigenen Schrift, nicht wahr?«
Sie schwieg.
«Sprich!«
«Aber ich will doch nur …«Jemand verpasste ihr eine Ohrfeige.
«Du willst sein wie Passeraub! Du dummes Luder!«
Schweißnasses Erwachen.
Passeraub hatte lateinische Schriften studiert und sie nachahmend in Stein gehauen. Er hatte sie in Holzblöcke geschnitzt und von Hand gestempelt. Er hatte den Bleisatz erlernt und schnell beherrscht — schneller als das Auge, wie Furrer sagte. Und dann war er, seine ganze kleine Schweizer Handwerkswelt hinter sich lassend, nach Paris gegangen, um mit Terreau & Racine Schriften für den Fotosatz zu entwerfen, schon die Kosmos ein Universum. Der Fotosatz war damals eine große Erfindung gewesen, eine Maschine, die Buchstaben so schnell auf einen Film blitzte, wie man die Tastatur zu bedienen wusste. Eigentlich nur ein Kasten mit Linsen und Prismen; Mikroskop, Kamera, Dunkelkammer, Telex, alles zugleich, aber nicht zu verstehen, weil lichtdicht verschlossen. Die Schriften mochten darin wohl in Trommeln oder auf Rädchen rotieren, eine Art Jukebox der Lettern. Passeraub hatte die Dimension der Erfindung begriffen: dass man in diesen Apparat alles hineinpacken konnte, was man wollte — Schriften aufgehoben in einer stufenlosen Matrix für alle Zwecke. Der Fotosatz wurde unvermeidlich, eingesetzt in allen Zeitungen, Agenturen, Satzbetrieben und Druckereien, vor allem, weil man den Schriftenfilm mit Fotofilm kombinieren konnte. Terreau & Racine, ehemals eine Schriftgießerei, lieferte nicht mehr Lettern, sondern Bilder von Lettern, Negative, miniaturisierte Archive. Da erschienen die ersten Lochkartenmaschinen wie Saurier im Vergleich. Fast dreißig Jahre lang hatte es so ausgesehen, als wäre der Fotosatz unschlagbar effizient.
Die Insolvenz von Terreau & Racine, wenige Jahre vor Marleens Eintritt ins Atelier, hatten Passeraub, Furrer und Stüssi überlebt. Bald war Passeraub — wie ein Phönix aus der Asche, sagte Furrer — bei den International Office Machines unter Vertrag genommen worden. Während Millionen von Sekretärinnen, Setzern, Grafikern und Korrektoren mit den Systemen kämpften, einsam wurden, verlacht, gekündigt, hatte Passeraub sein Handwerk und seine Weisheit hier zusammen- und dort wieder ausgepackt, ein Wanderer, ein Schlitzohr, mit allen Wassern gewaschen.
«Nun starren Sie doch nicht auf das Ding«, hatte er einmal zu Marleen gesagt. Sie hatte ihn nicht einmal fragen müssen, was er meinte, es wäre ohnehin sinnlos gewesen. Er hätte es einfach wiederholt, möglicherweise sogar im Dialekt und mit einem Blitzen in den Augen. Sie hatte ihn beobachtet in den folgenden Tagen, bis sie begriff, dass er nicht wirklich Buchstaben betrachtete, sondern das, was sie umgab, und das, was sie aussparten — so wie die besten Fotografen im Sucher ihrer Kamera das Negativ sehen, im Weißen das Schwarze.
Passeraub, auf seine kauzige Weise, hatte ihr die Tür geöffnet, hinter der sich alles, aber auch wirklich alles, als Gegenteil des Konkreten zeigte, als Spiegelung, Hohlraum, Fläche, Verhältnis von zu; und die Buchstaben waren nicht mehr als Gäste darin, den einen Tag herzlich aufgenommen und den anderen Tag gleichgültig rausgeworfen. Es gab keinen Grund, Buchstaben zu lieben. Es gab auch keine schönen Buchstaben und keine hässlichen, nur eine Folge von richtigen oder eine Folge von falschen, und Passeraub sagte immerzu ja und nein, dazwischen war nichts, einfach gar nichts.
In diese Lage hatte er sich gebracht aus eigener Kraft. Was mit zwei Händen zu machen war, hatte er getan; für den Rest gab es immer kluge Helfer, ständige und flüchtige. Alain nannte ihn scherzhaft» Passé«, weil es Passeraub gleichgültig war, was hinter der Taste F5 oder F8 verborgen war, wie man ein System konfigurierte oder für eine Anwendung zurechtstutzte. Alain war spät eingestellt worden, weil niemand sonst bereit gewesen war, den Arbeitstag vor einem schwarzen Glas zu verbringen mit einem brummenden Kasten neben dem Knie. Er hatte Grafik studiert und sich im Mac eingefuchst, und als sich zeigte, dass die Welt des Mac rasch größer wurde, kam Monique dazu. Sie hatte von der ersten Klasse an Boole’sche Algebra gelernt,»ganz mein Ding«, bekannte sie, die kaum die Optima von der Kosmos unterscheiden konnte. Passeraub sah darüber hinweg, ein weiser Meister, nicht mehr die Spur von einem Schweizer Bauernbuben, der er einst gewesen war.
Читать дальше