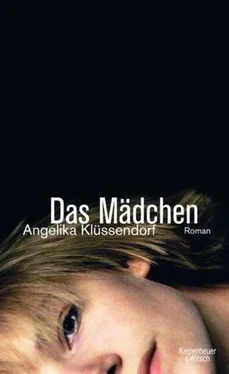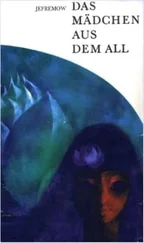Die Mutter sitzt im Bett, hat ihre Augen mit der Hand abgedeckt, als blende sie das Sonnenlicht, dabei sind die Gardinen zugezogen.
Mir geht’s schlecht, sagt die Mutter, massier mich. Ein Speichelfaden zieht sich von ihrer Unterlippe langsam auf den riesigen Bauch.
Sie kann sich nicht vorstellen, dass da drinnen ein Kind sein soll. Während sie vorsichtig die Kopfhaut massiert, beginnt jäh und grell ihr Zahn zu hämmern, und diesmal ist der Schmerz kaum zu ertragen. Sie atmet geräuschvoll zwischen den Zähnen aus. Der Schmerz erfasst den ganzen Kopf und nimmt ihr den Atem. Sie schnappt nach Luft, heult los und kann nichts dagegen tun, sie steht einfach nur da, umklammert ihr Gesicht mit beiden Händen und brüllt, mein Zahn, mein Zahn; nur flüchtig nimmt sie wahr, wie die Mutter das Zimmer verlässt.
Sie ist die Einzige in der Klasse, die sich den Kontrolluntersuchungen entzieht, immer, wenn der Zahnarzt in die Schule kommt, schafft sie es zu verschwinden. Die Vorstellung der Torturen, die er ihr zufügen könnte, ist für sie viel schlimmer als der Zahnschmerz. Nein, sie wird niemals zum Zahnarzt gehen, auch dann nicht, wenn sie nur noch verfaulte Zahnstümpfe im Mund hat.
Ihr Bruder steht plötzlich vor ihr, mit einer Schnapsflasche in der Hand. Er hat den Auftrag, sie in den Keller zu bringen. Dort soll sie den Schnaps trinken, dann würde der Schmerz verschwinden.
Der erste Schluck schmeckt scheußlich, wie Medizin, doch schon der zweite nimmt ihrem Schmerz die Spitze. Winzige Schlucke umspülen ihr Zahnfleisch, Wärme breitet sich in ihrem Innern aus, die Knie werden weich. Ihr Körper fällt in eine wohltuende Taubheit, das quälende Hämmern im Kopf weicht einem Schluckauf, der in ihren Ohren widerhallt.
Sie erwacht von dem Geräusch des Windes, der gegen die offene Fensterluke peitscht, und weiß nicht, ob es morgens oder abends ist. Als sie sich mühsam vom Boden erhebt, steigt ihr ein Brechreiz in die Kehle. Die Luft rollt mit schwerem Gewicht über sie hinweg, der Zahnschmerz ist verschwunden, doch jemand scheint ihren Kopf in eine Schraubzwinge gepresst zu haben, und übel ist ihr, so übel. Mit geschlossenen Augen beugt sie sich über den Kohlehaufen und kotzt sich die Seele aus dem Leib — ihre Seele riecht säuerlich, schmeckt bitter wie Galle und ist nur noch durch einen Speichelfaden mit ihrem Inneren verbunden. Sie kommt sich riesig vor, wie aufgeblasen, die Füße vor ihr scheinen nicht ihre eigenen zu sein. Eine Stimme dringt zu ihr, sie schafft es, die Augen zu öffnen. Die Stimme ihres Bruders ist lauter, als sie sein sollte. Nach einer Weile begreift sie, was er ihr sagen will: Die Mutter ist im Krankenhaus.
Sie ist weg, wiederholt Alex, weg.
Undeutlich nimmt sie wahr, dass er weint.
Sie kommt wieder, sagt sie und hofft, es wäre nicht so. Sie hat Durst, großen Durst.
Wird sie sterben? sagt Alex.
Sie schüttelt den Kopf, doch es ist ihr egal. Sie kann es kaum erwarten, ihren Kopf unter den Wasserhahn zu halten, noch nie hat sie einen solchen Durst verspürt.
Seit der Fehlgeburt der Mutter ist ihr Vater wieder häufiger bei ihnen. Er versucht sogar einmal zu kochen, doch die Bohnen auf dem Herd werden einfach nicht weich. Sie wird jeden Abend in die Kneipe geschickt, um den Nachschub an Bier zu sichern. Ihr Vater erzählt Geschichten, die sie bald auswendig kennt, was für ein guter Sportler er war, neun Sekunden für 60 Meter, und das mit fünfzehn Jahren, sie erfährt alle Einzelheiten über seinen ersten Rausch und über die Kriegsverletzung seines Großvaters. Die Mutter verlässt kaum das Bett.
Oft sind es schon früh morgens über dreißig Grad. Ihr kommt es so vor, als würden sich die Dinge um sie herum auflösen. Als sie die Treppen bohnert, scheint sie an den Stufen festzukleben. Während sie den Bohnerbesen über die Treppenstufen wuchtet, versinkt sie in ihren Tagtraum, geht in einer kühleren Luft durch den Wald, beginnt zu laufen, läuft, ohne sich umzudrehen.
Sie hat aus einem der lauten Selbstgespräche der Mutter erfahren, dass sie Zwillinge verloren hat, einen Jungen und ein Mädchen, mit einer klagenden Stimme ruft sie immer wieder nach ihren Babys. Sie versteht diesen Schmerz nicht. War es nicht das, was sie wollte? Es ist verwirrend, denn die Trauerrufe klingen echt, und schließlich begreift sie, dass die Mutter um sich selbst weint.
Dann ist von einem Tag auf den anderen wieder alles beim Alten, mit einem eisigen Hauch öffnet sich die Schlafzimmertür, und die Mutter inspiziert mit wütender Kraft die Wohnung, reißt die Fenster auf, erteilt Befehle.
Die Nacht vor dem ersten Schultag nach den Ferien scheint kaum zu vergehen. Sie gibt sich das Versprechen, eine gute Schülerin zu sein, freut sich darauf, die erste Seite eines neuen Heftes vollzuschreiben, sie verspürt den Ehrgeiz, ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft zu werden, vielleicht wird sie sogar freiwillig den Posten der Milchkassiererin übernehmen.
Sie holt Elvira vor dem Unterricht ab. Elviras Mutter ist noch dicker geworden, ihr Atem geht schwer, sie kommt nur noch seitlich durch die Tür. Sie kann sich nicht vorstellen, dass Elviras Mutter jemals ein junges Mädchen war, auch ihre Mutter kann sie sich nicht als junges Mädchen vorstellen. Wenn sie Fotos aus dieser Zeit betrachtet, ist ihr das auf eine merkwürdige Art peinlich, und besonders verstörend findet sie die Kinderbilder, auf denen ihre Mutter blond gelockt in einer Blechbadewanne planscht, ein pausbäckiges Mädchen mit einem verblüfften Lächeln im Gesicht.
Sie haben einen neuen Klassenlehrer, Herrn Baum, einen kleinen, durchtrainierten Mann, der nicht lange zu fackeln scheint. Schon in der zweiten Stunde fliegt sein Schlüsselbund in die hinterste Bankreihe und trifft den Störenfried am Kopf. Sie empfindet ein süßes Frösteln, weil nicht sie gemeint ist; der neue Klassenlehrer weiß nichts über sie. Sie versucht, ein interessiertes Gesicht aufzusetzen, jedem seiner Worte zu folgen. Doch während sie sich noch eifrig meldet, bemerkt sie, dass die Klassenbesten ebenfalls bemüht sind, Herrn Baum zu gefallen, und sie weiß, es ist ein aussichtsloses Unterfangen, mit ihnen zu konkurrieren.
Sie sprechen darüber, wie sich die Schüler im Falle eines Atomkrieges verhalten sollen; die Angaben des Lehrers kommen ihr unklar vor: Sie sollen sich auf der Straße neben die Bordsteinkante legen, die Augen geschlossen halten und sich so lange in den Straßenstaub pressen, bis alles vorbei ist. Wie kommen sie so schnell auf die Straße? Oder wird der Abwurf der Atombombe etwa vorher angekündigt? Der Lehrer zuckt über ihre Fragen die Achseln und räumt ein, dass sie sich zur Not auch unter ihre Schultische legen könnten.
Obwohl sie sich anstrengen wollte, vergisst sie schon bald die Hausaufgaben, stört den Unterricht, erhält den ersten Tadel. Wenn sie morgens zu spät kommt, bleibt sie vor ihrem Klassenzimmer stehen, die Stimme des Lehrers dringt durch die Tür, und sie traut sich nicht hineinzugehen, sie wartet bis zur Pause oder schwänzt die Schule, streift den Rest des Tages durch die Stadt.
Es gibt eine blinde, alte Frau, der sie manchmal über die Straße hilft. Die Frau erkennt sie an ihrer Stimme, ach, du bist es, sagt sie und nimmt vertrauensvoll ihren Arm. Einmal wünscht sich die blinde Frau, dass sie ihr erzählt, was sie sieht. Sie schaut sich um und erblickt nichts, was ihr erzählenswert erscheint. Es ist nicht viel los, sagt sie, die Leute stehen Schlange vor dem Gemüseladen, drei russische Soldaten laufen hintereinander am Bäcker vorbei, vor dem Milchmann putzt ein Junge sein Fahrrad. Wo sind die Tauben? sagt die blinde Frau, und sie führt die Alte in den Clara-Zetkin-Park. Sie setzen sich auf eine Bank. Sie betrachtet die Blinde und spürt Lust, ihr Blödsinn zu erzählen, dass der Himmel grün ist, Kürbisse an den Bäumen wachsen und Hunde vorbeifliegen. Doch sie ist sich nicht sicher, ob die alte Frau seit ihrer Geburt blind ist, und so beschränkt sie sich darauf, das, was sie sieht, auszuschmücken. Die Tauben haben rot lackierte Füße, sagt sie, und sie scheinen zu lachen, und tatsächlich, je länger sie die Tauben anstarrt, desto mehr meint sie, ein Lächeln in ihren Vogelgesichtern zu sehen.
Читать дальше