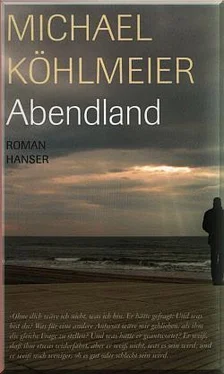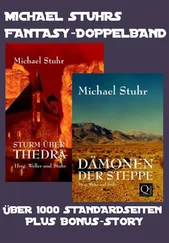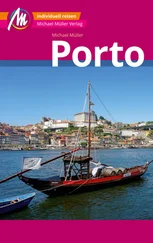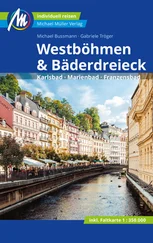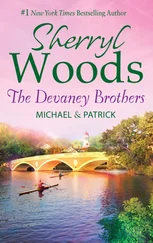«Ich habe dich nach deiner ersten Erinnerung gefragt. Ich will dir nun von meiner ersten Erinnerung erzählen.
Auch ich war vier Jahre alt. Ich war in Wien. Ich habe keine Ahnung, wie ich nach Wien gekommen war. Ich erinnere mich nicht einmal, ob ich zusammen mit meiner Mutter dort war. Ich schließe aber aus dem Folgenden, daß sie mich nicht begleitet hat. Ohne meine Mutter, ohne meinen Vater, natürlich ohne ihn. Wahrscheinlich hatte mich meine Großmutter in Meran abgeholt. Das kam schon vor: Daß meine Großmutter an meine Eltern schrieb, es sei wieder einmal Zeit, den Enkel nach Wien abzugeben. Es war Sommer, und den Tag über spielte ich vor dem Haus unter den Bäumen auf dem Rudolfsplatz. In den heißen Monaten waren dort Karussells aufgebaut und eine Schießbude und Stände mit gebrannten Mandeln und Limonade. Auf der westlichen Seite des Parks standen zwei Fiaker. Von dort roch es nach Pferd und nach dem Tabak, den die Kutscher rauchten. Meine Großmutter gab mir ein paar Münzen, die durfte ich verprassen. Sicher hat man mir ein Dienstmädchen zur Aufsicht nachgeschickt. Es wird einigen Abstand gehalten haben. ›Er soll sich nicht kontrolliert vorkommen.‹ Ein kleiner Erwachsener.
Woran ich mich nun wirklich gut erinnere: meine Großmutter in einem schwarzen bauschigen Kleid, auf ihrer Frisur ein schwarzer Hut, ich an ihrer Hand, wir stehen auf dem Bahnhof, die riesenhafte Dampflokomotive, Räder bis über den Kopf meiner Großmutter und die Transmissionsstangen. Dampf. Weißer, blauer, brauner, schwarzer. Wir fahren nach Berlin. Ich sage vor mich hin: ›Wir fahren nach Berlin, wir fahren nach Berlin.‹ Meine Großmutter und ich. Ich trage einen Lederranzen auf dem Rücken, mit einem Fell auf der Klappe. Darin bewahre ich ein Pferd und einen Reiter auf. Aus Blech. Manchmal hole ich die beiden hervor, stecke den Reiter auf das Pferd, stelle das Ding auf das Tischchen unter dem Zugfenster und denke mir, ich sei der Reiter mit dem bunten Turban und sprenge neben dem Zug über die Felder, setze über die Gräben, hetze durch die Wälder und springe, wenn wir durch eine Stadt fahren, von Dach zu Dach.
In Berlin treffen wir Tante Franzi. Sie fragt meine Großmutter: ›Hast du den Jungen mitgebracht?‹ Warum fragt sie das? Sie sieht mich ja. Auch Tante Franzi trägt schwarze Kleider und auch sie einen schwarzen Hut. Wir steigen in einem sehr vornehmen Hotel ab. Ich bin geneigt zu glauben, es war das Adlon. In einem anderen wären meine Großmutter und Tante Franzi nicht abgestiegen. Meine Großmutter hatte mir nicht erklärt, was wir in Berlin tun würden. Aber das spielte ja keine Rolle. Tante Franzi konnte gar nicht genug davon bekommen, mir im Gesicht herumzufahren, und immer wieder wollte sie mich auf den Arm nehmen. Und immer wieder hat sie ausgerufen, wie glücklich sie doch wäre, wenn sie auch so was Schönes, Liebes hätte. Zuerst hat sie getan, als ob ich gar nicht anwesend wäre, und nun dieses Übermaß. Sie war sechs Jahre älter als meine Großmutter, hatte aber einen Mordsrespekt vor ihrer jüngeren Schwester.
Am nächsten Tag fahren wir mit der Straßenbahn. Bald stehen wir vor einem furchteinflößenden Gebäude. Es ist das Polizeipräsidium von Charlottenburg. Ein Mann mit zwei schneidigen, scharf begrenzten Schnauzbartstreifen und einer dicken Hornbrille mit kreisrunden Gläsern wartet auf uns. Er stellt sich als Dr. Zitschin vor. Er gibt mir die Hand und deutet eine Verbeugung an. Er hat Papiere bei sich. Die zeigt er den beiden Uniformierten, die beim Eingang stehen. Ihre Kopfbedeckung sieht ähnlich aus wie das Dach des Polizeipräsidiums. Das Papier, das mich betrifft, darf ich herzeigen. Meine Großmutter hebt mich hoch und nimmt mich auf den Arm. Und dort bleibe ich, bis wir das Gebäude wieder verlassen. Dr. Zitschin geht voraus, ihm folgt ein Polizist. Wir gehen durch Flure, schließlich betreten wir einen niedrigen Raum. An der Wand entlang zieht sich eine Bank. Sonst ist nichts in dem Raum. Auch kein Fenster. Wir warten. Dr. Zitschin geht auf und ab. Ich sitze auf dem Schoß meiner Großmutter. Tante Franzi weint und sucht immer nach der Hand ihrer Schwester. Die Tür öffnet sich. Ein Mann tritt ein, rechts und links von ihm zwei Polizisten. Der Mann ist glattrasiert. Auch sein Kopf ist rasiert. Er lächelt. Er hat sehr weiße Haut. Und sehr weiße Zähne. Und helle Augen. Mich schaut er nicht an. Tante Franzi umarmt ihn und weint nun noch lauter. Einer der Polizisten sagt, man dürfe den Mann nicht angreifen. Der Mann setzt sich auf die Bank uns gegenüber. Zwischen uns und ihm sind gut fünf Meter. Neben ihn setzen sich die beiden Polizisten. Eng neben ihn.
Meine Großmutter sagt zu mir: ›Carl Jacob, das ist dein Onkel Hanns.‹
Er war nicht mein Onkel, er war mein Großonkel. Der Bruder von Tante Franzi und meiner Großmutter. Hanns Alverdes.
Hanns Alverdes war wegen zehnfachen Mordes zum Tode verurteilt worden. Vorübergehend saß er in einer der Zellen im Polizeipräsidium von Charlottenburg. Am Tag nach unserem Besuch sollte er in ein anderes Gefängnis gebracht werden und dort auf seine Hinrichtung warten. Köpfen. In welches Gefängnis, wurde nicht verraten. Dr. Zitschin — er war der Anwalt meines Großonkels — sagte, es bestehe noch eine Chance, im September nämlich finde der Juristentag in Danzig statt, bei dieser Gelegenheit werde ein Antrag zur Abschaffung der Todesstrafe vorgelegt. Bis dahin jedenfalls werde das Urteil nicht vollstreckt, das sei ihm versichert worden.
Ich erinnere mich nicht, wie lange wir im Gefängnis gewesen waren, und auch nicht, was dort sonst noch vorgefallen war. Am Ende unseres Besuchs erlaubten die Polizisten meinem Großonkel, daß er mich auf den Arm nehme. Aber ich wollte das nicht. Ich schmiegte mich an meine Großmutter, umklammerte ihren Hals mit meinen Armen, spreizte meine Beine und umfing ihre Taille und biß in den Kragen ihres Kleides. Da spürte ich den Zeigefinger des fremden Mannes in meinem Rücken. Er hackt mit dem Zeigefinger in meinen Rücken, genau dorthin, wo darunter mein Herz ist, und sagt: ›Laß’ dich doch mal von mir drücken, Carljacobchen! Das tut mir gut und dir nicht weh. Ich will dich doch nur einmal drücken! Ich hab’ noch nie so einen sauberen, kleinen Herrn auf dem Arm gehabt.‹ Er spricht leise und nah an meinem Ohr. Ich habe mein Leben lang diese Stimme nicht vergessen, glaub mir. Diesen Tonfall. Die Vokale wie durchhängende Seile. Ich wiiiill dich dooooch nur einmaaaal drüüüücken … In den unspektakulärsten Gesprächen kam es immer wieder vor, daß irgend etwas diesen Tonfall in meiner Erinnerung aufgerufen hat. Wenn ich mich zum Beispiel mit unserem Rektor unterhalten habe, dem lieben, hochverehrten, etwas unterbelichteten Dr. Ramsauer, auf einmal hörte ich in meinem Kopf diese Stimme, die Wort für Wort die Rede dieses harmlosen, im großen und ganzen liebenswürdigen Mannes nachäffte, indem sie die festgezurrten Selbstlaute aus ihrer Verankerung riß, und auf einmal war er nicht mehr harmlos und auch nicht im großen und ganzen liebenswürdig. Und bei anderen Menschen ging mir das genauso, Männern, Frauen, immer wieder. Ohne daß ich einen Anlaß gesehen hätte. Als würde sich diese Stimme immer wieder in Erinnerung rufen. Auf dem Arm meiner Großmutter, an die ich mich klammerte, wußte ich, warum man mich hierhergebracht hatte. Ich wußte es, ich wußte es. Ich soll diesem Mann übergeben werden. Wenn er mich erst auf dem Arm hält, läßt er mich nicht mehr herunter. Wenn er es schafft, mich festzuhalten, dann gehöre ich ihm für immer. Er wird sich umdrehen und mit mir fortgehen. Meine Großmutter und meine Tante wollen mich diesem Mann schenken. Darum hat mich meine Großmutter hierhergebracht. Ein Entsetzen erfaßte mich, so elementar, daß mir die Tränen aus den Augen fielen und der Speichel aus dem Mund tropfte und ich mein Wasser nicht halten konnte. Die Bluse meiner Großmutter war naß und ihr Nacken auch. Aber sie verriet mich nicht. Sie sagte nur: ›Wenn du nicht willst, Carl Jacob, mußt du auch nicht.‹ Aber das glaubte ich ihr nicht. Sie ist nicht auf meiner Seite. Sie tut nur so. ›Carl Jacob, Carl Jacob‹, wimmert Tante Franzi, ›Carl Jacob, stell dich nicht so an! Er will dich doch nur halten. Darf er denn nicht einmal das mehr?‹ ›Willst du nicht vielleicht doch?‹ fragt mich meine Großmutter. ›Nur kurz, Carl Jacob. Ich bin ja hier. Du würdest Onkel Hanns eine große Freude bereiten.‹ ›Aber er will doch, der kleine Mann will doch‹, höre ich wieder seine Stimme in meinem Rücken. ›Gib ihn mir einfach! Er will ja. Du stellst dich an. Du. Warum so ein Theater!‹ — Duuuu stellst dich an. Duuuu … Waruuuum so ein Theaaaater … — Sein Finger hackt weiter zwischen meine Schulterblätter, fester nun, und er drückt bei jedem Stoß die Kuppe eine Weile gegen mein Rückgrat, ich spürte seinen Fingernagel durch mein Hemd. Und noch leiser als bisher sagt er: ›Um Himmels willen, soll ich denn zu so einem Dreikäsehoch bitte sagen, nur damit ich ihn wiegen darf, wie schwer er ist?‹ — Wiiiiegen darf, wie schweeeer er iiiist … — ›Friederike, bitte, laß ihn los!‹ kreischt Tante Franzi und legt ihre Hände um meine Rippen und versucht, mich von ihrer Schwester wegzureißen. ›Laß den Bengel doch einfach los!‹ Der Mann kichert: ›Mensch, Carljacobchen, das tut doch nicht weh. Ich hab’ doch keine Eisenpranken.‹ Einer der Polizisten mischt sich ein: ›Sehen Sie denn nicht, daß der Kleine nicht will?‹ Nun bohrt der Mann den Finger nicht mehr in meinen Rücken. Ich höre ihn ausatmen. Wie nach einem verlorenen Kampf. Meine Großmutter sagt: ›Hanns, es ist gut. Franzi, es ist gut. Es soll nicht sein. Schluß jetzt! Franzi, setz dich hin!‹ Sie dreht ihrem Bruder und ihrer Schwester den Rücken zu. Ich gucke an ihrem Hals vorbei, durch die Haare hindurch, die unter ihrem Hut hervorquellen. Ich sehe Tante Franzi den fremden Mann umarmen, der unbedingt mich umarmen wollte und der nun dasteht und nichts tut, die Arme hängen läßt und die Augen offen hat. Jetzt schreit Tante Franzi sogar. Das ist kein Heulen mehr. Der Mann tut wie ich, er schaut über die Schulter seiner Schwester, schaut durch ihre Haare hindurch, zu mir herüber schaut er. Ich denke, er denkt sich, dich krieg’ ich noch, wart’s nur ab. Die Polizisten reißen Tante Franzi von ihm weg. Zu zweit schaffen sie es nicht, Dr. Zitschin muß mithelfen. Er streckt die Arme aus, faltet die Hände, als würde er gleich vom Sprungbrett ins Wasser hüpfen, und schiebt die Arme wie einen Keil zwischen Tante Franziska und den Mann und gibt dabei Geräusche von sich, wie wenn er ein schweres Paket auf den Kutschbock stemmte. Wir müssen den Raum verlassen. Wenn man das gewußt hätte, sagt einer der Polizisten. Draußen macht Dr. Zitschin Tante Franzi Vorwürfe. Weil sie sich so wenig zusammengenommen hat. Ihr Verhalten habe ihm geschadet, sagt er. Und auch ihrem Bruder. Aber er sagt auch, ihm würde es nicht anders ergehen als ihr in so einer Situation.
Читать дальше