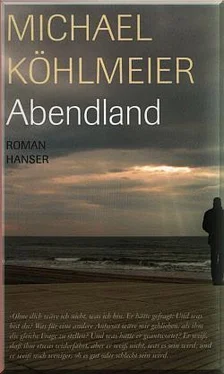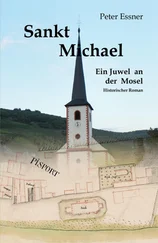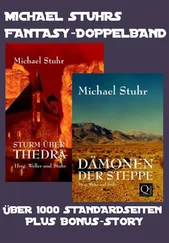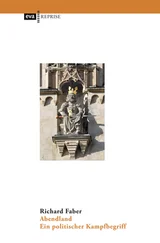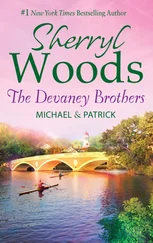«Ich nehme den Wecker und schmeiße damit die Fensterscheibe ein.«
«Ich verstehe diesen Witz nicht.«
«Ich brauche dich nicht.«
«Sebastians Zimmer «zeigte nach Süden und Westen, freier Blick auf den Patscherkofel und den Lansersee; es lag unter dem Dach, über Margaridas Schlafzimmer, und war über eine schmale, steile Holzstiege zu erreichen. Von dem engen Flur davor gingen noch zwei weitere Zimmer ab und ein nicht ausgebauter, fensterloser Raum, der vollgestopft war mit Koffern und Gerümpel. Die beiden anderen Zimmer waren hübsch für Gäste eingerichtet und waren, soweit ich weiß, nie gebraucht worden, weil in den unteren Stockwerken genügend Platz war. (Frau Mungenasts Zimmer lag zwischen den ehemaligen Schlafzimmern von Carl und Margarida. Ich habe es nie betreten.) Meines war das geräumigste der Dachzimmerchen, wegen der beiden Erker auch das verwinkeltste, und es war mit denselben Möbeln und in ähnlicher Ordnung eingerichtet wie ehedem mein Zimmer in der Anichstraße. Eine Dusche und ein WC waren da, und alles, was ich brauchte an Kleidern und Wäsche, sogar ein Paar Bergschuhe der Firma Hanwag stand unten im Kasten, gut hundert Bücher waren alphabetisch nach Autoren in einem Regal aufgereiht, ein Radioapparat und ein kleiner Fernseher und ein Plattenspieler und ein gutes Dutzend Schallplatten — Jazz, Folk, Blues, Rock’n’Roll, aber auch Die Winterreise von Schubert, die Margarida so sehr geliebt, und eine schwere Box mit Mozarts Don Giovanni , die Carl aus seiner Sammlung ausgemustert hatte, als er auf CD umgestiegen war. Margarida hatte dafür gesorgt, daß es mir an nichts mangelte; ich hätte nackt ankommen können zu jeder Tages- und Nachtzeit. Wenn sie irgendwo auf ein Buch gestoßen war, von dem sie meinte, es könne mir gefallen, kaufte sie es und stellte es in» Sebastians Zimmer «ins Regal. Sie hatte meine Kleidergrößen und meine Schuhgröße gekannt und natürlich meine Vorlieben, und bei jedem Besuch fand ich etwas Neues im Kasten, ein Hemd oder eine Krawatte oder einen ärmellosen Pullover.
Ich setzte mich an den Schreibtisch, der vor dem westlichen Erkerfenster stand, und formulierte eine Inhaltsangabe des vergangenen Tages, damit ich ein Gerüst hätte für meine Notizen. So hatte ich es gehalten während meines Besuchs, das war Teil meiner Eckermannarbeit. Vermerkte dazu auch meine eigene Befindlichkeit; was mich am meisten beeindruckt hatte — an diesem Tag nicht so sehr Carls Geständnis, daß er in São Paulo 1961 den Plan gefaßt hatte, Daniel Guerreiro Jacinto zu ermorden, auch nicht, daß er sich in Lissabon einen Killer besorgt hatte, sondern sein Zusammenbruch am Vormittag, als er unten beim See zwischen Sonnenschein und Schneetreiben nach dem lieben Gott gerufen hatte. Erinnerte auch an Carls Sticheleien über mein Zusammenleben mit Evelyn; fügte in Klammern eine Rüge an mich selbst hinzu, weil ich ihm von ihr überhaupt erzählt hatte, vor allem, weil ich ihm erzählt hatte, daß sie gelegentlich gleichzeitig zusammen mit einem Deutschlehrer und einem Sportlehrer ins Bett ging. Ich schrieb noch einmal — in Volksschülerschrift, wie ein Kind, das den Wunschzettel fürs Christkind aufsetzt — Name und Telefonnummer von Veronika Brugger auf. Am Ende der Seite stehen der Name» Dagmar«— ohne Kommentar — und darunter der Name» David«— ebenfalls ohne Kommentar. So endet C.J.C. 7, das letzte der Notizhefte, die ich in Lans geführt habe.
Nie wieder werde ich ein solcher sein, der sich an sich selbst erinnert als einen, der einen Abschiedsschmerz empfand, wie ich ihn im Augenblick empfinde, da ich mich an den Abschied von Carl erinnere. — Er hätte an diesem Gedankenmäander seine kleine Freude gehabt. Über die syntaktische Selbstbezüglichkeit der Vorzukunft hatten wir uns irgendwann einmal ausführlich am Telefon unterhalten; das war in Zusammenhang mit Douglas Hofstadters berühmtem Buch über Kurt Gödel, Maurits Cornelis Escher und Johann Sebastian Bach gewesen, das er für die Zeitschrift profil rezensieren sollte, aber nicht wollte, und dem Redakteur als Ersatz mich empfohlen hatte; wenn ich mich recht erinnere, war es im Frühjahr 1986 gewesen, bald nachdem ich aus North Dakota zurückgekommen war. Ich hatte ihn angerufen und ihn gebeten, mir einige Dinge zu erklären, zum Beispiel Gödels Unvollständigkeitssatz — und warum, wie ich irgendwo gelesen hätte, manche Kritiker der Meinung sein konnten, dieser sei ein erster Schritt zu einem tatsächlich schlagenden, nämlich unschlagbar logischen Gottesbeweis. Er hatte schallend gelacht und geantwortet, wenn seiner Meinung nach irgendwo ein Gottesbeweis verborgen liege, dann im Phänomen der Erinnerung, das eigentlich als Urbild der Selbstbezüglichkeit in Hofstadters Buch eine zentrale Stelle hätte einnehmen müssen. Die Erinnerung beschreibe einen denkwürdigen Kreis, der sich von der Gegenwart in die Vergangenheit dreht, bis er die 180 Grad erreicht, also sozusagen in der Gegenwart desjenigen ankommt, an den erinnert werden soll, gleich darauf aber in die Zukunft wechselt, weil Erinnerung immer auch die Reflexion des Sicherinnernden über sich selbst mit einschließt, er sich also sagt, so, wie ich mich jetzt an diesen erinnere, werde ich mich eines Tages an mich selbst erinnern, nämlich, daß ich einst der war, der ich jetzt bin — womit er aber bereits in der Vorzukunft, im futurum exactum , angekommen ist, also bei 270 Grad, wo sich der Kreis zum Ausgangspunkt zurückkrümmt. Die Erinnerung sei wie die Treppe der Mönche auf dem Bild des Maurits Cornelis Escher, die immer nach oben — oder nach unten — führt, in Wahrheit aber nie die Ebene verläßt, weswegen dieser Zustand irreal und irrational sei, in seiner Wirkung jedoch ungeheuer mächtig. Die pure Erinnerung, sozusagen die Erinnerung an sich, lasse sich in der Musik beobachten, in besonders reiner Form in der kanonischen Kunst des Johann Sebastian Bach (unübertroffen in der Kunst der Fuge ), wenn er ein Thema immer wieder aufnehme und verändere — als Krebs oder horizontal gespiegelt, in die Quint transponiert oder um einige Töne versetzt oder in allen erdenklichen Permutationen —, was ja voraussetze, daß bei jeder Verformung das Original des Themas vom Zuhörer erinnert werde, ansonsten die Konstruktion in sich zusammenfalle. Die Erinnerung verleihe uns, zumindest in gedanklicher Form, Allgegenwärtigkeit, woraus der Verfasser der biblischen Genesis wohl die Chuzpe bezogen hätte, zu behaupten, Gott habe den Menschen ihm zum Bilde geschaffen. Ein möglicher Gottesbeweis, so führte Carl weiter aus, könnte eventuell in der Antinomie des futurum exactum gründen, und zwar in der selbstbezüglichen Schleife — ich werde einer gewesen sein, der dachte, er werde einer gewesen sein, der dachte, er werde einer gewesen sein, der dachte, er werde einer gewesen sein … und so weiter bis in alle Ewigkeit. Denn bis in alle Ewigkeit wird der in Form des futurum exactum sich an sich selbst erinnernde Geist aufgespalten sein, weil dieses System zwar widerspruchsfrei, aber nicht vollständig sei. Das Ding an sich, in diesem Fall das sich erinnernde Ich, wird zum Spiegel im Spiegel, dem Auge ins Unendliche entrückt; die Wiederholung der Wiederholung der Wiederholung; und plötzlich werde klar, was Kierkegaard meinte, als er die Wiederholung eine Erinnerung in die Zukunft nannte. Wenn die formale Logik a priori sei, also Menschenwerk, müßte es zumindest denkbar sein, sie widerspruchsfrei und vollständig zu gestalten, denn dies läge in diesem Fall ja allein in Menschenhand. Gödels zweiter Unvollständigkeitssatz aber führte allen agnostischen Formalisten, zu denen auch er, Carl, sich zähle, vor Augen, daß sich die Unergründlichkeit des Dinges an sich durch einen Nachweis der Widerspruchsfreiheit formaler Systeme nicht aus der Welt schaffen lasse. Womit Gödel zum Leidwesen seines — Carls — hochverehrten Lehrers David Hilbert bewiesen habe, daß die Logik uns nur geborgt worden sei. Aber wer könne uns so etwas borgen, wenn nicht ER? — Warum er dann weiterhin nicht an Gott glaube, fragte ich ihn. Seine Antwort:»Weil er aus mir eben so einen gemacht hat.«— Wieder einmal war ich mir nicht sicher gewesen, ob er scherzte — oder ob er scherzte, um zu verbergen, wie ernst es ihm war.
Читать дальше