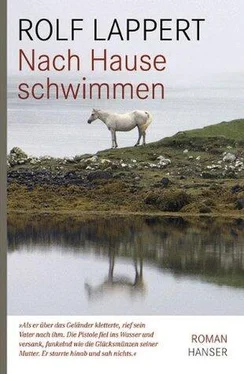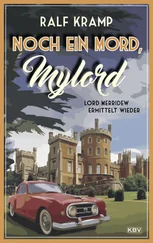Ich habe Aimee nie nach ihrer Telefonnummer gefragt, ihre Adresse habe ich mir nicht gemerkt. Wenn ich in die Bronx fahren würde, um das Haus zu suchen, fände ich es vermutlich, irgendwie, irgendwann. Im Telefonbuch steht sie nicht, auch die Auskunft hatte nur eine Aimee Ward zu bieten, aber die schreibt sich Amy, ist Friseuse und wohnt in New Jersey.
Wo ich bin, weiß sie. Wenn sie mich sehen will, wird sie herkommen. Aber diese Hoffnung habe ich aufgegeben, schon vor Tagen. Ich bin nicht gerade der Typ, der einer Frau nicht mehr aus dem Kopf geht. Wahrscheinlich ist sie froh, mich los zu sein, ohne Geschrei und Tränen, wie ich es aus Filmen kenne.
Gut möglich, dass ich hier noch sitze, wenn ich so alt bin wie die Männer, die sich dieses Hotel als Ort zum Sterben ausgesucht haben. Leonidas ist vorgestern für einen Monat nach Kreta geflogen, wo er mit dreihundert Verwandten den Tod seines Lieblingsonkels betrauert. Heute Morgen kam eine E-Mail von ihm. Seine Mutter habe sich weinend auf den Boden geworfen, als er ihr Haus betrat. Ob aus Freude, ihren Sohn zu sehen, oder aus Kummer über den Tod ihres Bruders, wisse er nicht. Sein Onkel, ein ehemaliger Arzt, sei irgendwie einbalsamiert und in der dekorierten Garage seines Hauses aufgebahrt worden. Hinter der Leiche im Sonntagsanzug hänge ein altes Blechschild, das für Mobi-Motorenöl werbe, und in einer Ecke stehe das Rennrad, mit dem der Verstorbene jedes Wochenende herumgefahren sei. Leonidas wolle eine Story über all das schreiben. Von Theaterstücken, auch Komödien, habe er vorerst die Schnauze voll. Kein Schwein interessiere sich dafür, lässt er mich wissen. Jetzt wolle er es mit Kurzgeschichten versuchen.
Die Nachtschicht ist nicht übel. Die meiste Zeit habe ich Ruhe vor den alten Knackern, die sich in ihren Zimmern in einem unruhigen Schlaf wälzen. Mazursky, Alfred und Enrique sitzen zwar jede Nacht bis drei, vier Uhr morgens in der Lobby, trinken schlechten Wein, quatschen dummes Zeug, spielen Karten oder Domino oder irgendetwas anderes, das Zeit totschlägt, aber sie nerven mich nicht mehr. Spencer geht wie jeden Abend um halb elf nach oben in sein Zimmer, nachdem er eine Weile schweigend auf dem Sofa gesessen hat. Dobbs besucht mich jeweils gegen neun und bringt Tee mit, manchmal Kekse. Dann sitzen wir am Computer aus Winstons Beständen und surfen im Internet. Dobbs ist völlig fasziniert von unseren nächtlichen Ausflügen ins Cyberspace. Wir verbringen Stunden vor dem Bildschirm und geben aufs Geratewohl Stichwörter in die Suchmaschine ein. Dann betrachten wir andächtig Aufnahmen von gesprengten Hochhäusern, Beinprothesen aus China, Termitenbauten, Mondgesteinsproben, Verkehrsunfällen mit Nashörnern, von fliegenden Fertighäusern und tätowierten Männern, die uns traurig ansehen.
Manchmal hat Dobbs eine Zeitung oder ein Buch dabei, und wir tippen blind mit einem Kugelschreiber auf ein Wort, das wir dann eingeben. Halloween. Domestizieren. Sprengstoffgürtel. Seerosen. Beziehungsunfähigkeit. Es gibt kurze Filme, die wir uns ansehen. Ein Baum wird maschinell in wenigen Sekunden gefällt, von den Ästen befreit, geschält und in gleich lange Stücke zerlegt. Nackte Menschen, die durch Schnee rennen und in ein ins Eis geschlagenes Loch springen. Eine schwarze Katze, die in ein Aquarium fällt, immer wieder, weil Dobbs endlich mal lacht. Eine Weltumrundung mit dem Satelliten. Die zehn schönsten Touchdowns.
Wir geben Wörter ein, die wir uns ausdenken, oder wir schließen beim Tippen die Augen. Wir versuchen es mit Phantasiewebseiten und folgen abgründigen Links, wir landen in Asien und Russland, bei harmlosen Spinnern und Verrückten und Leuten, um die man sich wirklich Sorgen machen muss. Wir lesen Auszüge aus dem Tagebuch eines chilenischen Opernsängers, staunen beim Anblick von Bisswunden australischer Haie und lernen eine Bildhauerin aus Nevada kennen, die Türme aus Lehmziegeln baut, von denen sie springt, bis sie sich ein Bein bricht. Nach der Heilung legt sie den Gips in den Turm und verschließt ihn. Man kann ihre Werke nicht kaufen, nur mieten. Ich müsste zweieinhalb Jahre hier arbeiten, um einen ihrer Türme einen Monat lang zu mieten.
Als Dobbs auf seinem Zimmer ist, gebe ich bei Google Aimee Ward ein. Drei Treffer. Eine wohnt in Utah, eine in England, die dritte in Wyoming. Eine ist Sportlerin, die andere Bürgermeisterin eines winzigen Kaffs, die in Utah schreibt medizinische Artikel für Fachzeitschriften. Ich gehe auf eine Seite mit Stadtplänen der Bronx und streife durch die Straßen, suche die U-Bahn-Station, an der wir ausgestiegen sind, finde sie aber nicht, gehe hoch zur Fordham Road und zur Kingsbridge Road, runter zur Burnside Avenue, dann rüber zur Tremont Avenue. Der große grüne Fleck ist der Botanische Garten. Auf der Website sehe ich den Kuppelbau aus Glas und die Gewächshäuser, Bäume und Seen und einen Fluss, alles mitten in der Bronx. Ich betrachte Bambussträucher und versuche mich an den Namen einer Bar zu erinnern, an der wir vorbeigegangen sind. Auf der Website des Zoos suche ich nach den Mitarbeitern, aber die Tierpfleger sind nicht aufgeführt. Über Stewart hätte ich Aimee gefunden. Ich könnte in den Zoo gehen und nach ihm fragen. Vielleicht hätte ich Glück und würde ihn dabei erwischen, wie er Zebrakacke in eine Schubkarre lädt. Natürlich könnte ich in der Stadt der Selbstmörder anrufen, bestimmt haben die noch ihre Adresse oder Telefonnummer.
Susan und Kate Caldwell Institut für Humanforschung, eintausendzweihundertelf Einträge. Selbstmord, einhundertzwanzig Millionen Treffer. Ich klicke wahllos ein paar Seiten an, stoße auf Selbsthilfegruppen und Polizeiberichte, auf Hemingway und Sylvia Plath und einen kalifornischen Professor, der sich die Mühe gemacht hat, Selbstmordarten nach Erfolgswahrscheinlichkeit, Sterbezeit und Schmerzfaktor aufzulisten. Sich in die Luft zu jagen ist Donald I. Templers Meinung nach am effizientesten. Auf seiner Schmerzskala, die von eins bis hundert reicht, steht bei Sprengstoff eine Vier. Die Chancen, dabei auch wirklich umzukommen, sind mit sechsundneunzig Prozent sehr gut und werden nur noch von einem Kopfschuss übertroffen, wo man zu neunundneunzig Prozent draufgeht und einen Schmerzpegel von sechs aushalten muss, wenn man als Waffe ein Gewehr wählt. Mit einer Pistole sinkt die Erfolgsquote um zwei Prozent, und der Schmerzpegel liegt bei dreizehn. Ein leichtes Schaudern befällt mich, als ich lese, dass Selbstverbrennung mit fünfundneunzig Punkten die schmerzhafteste Art ist, sich zu töten, dass sie im Schnitt siebenundfünfzig Minuten dauert und nur in siebenundsiebzig von einhundert Fällen erfolgreich ist. Das Ertrinken in einem See oder Meer ist mit neunundsiebzig Punkten genauso qualvoll wie das Ertrinken in der Badewanne, und beides dauert durchschnittlich neunzehn Minuten. Für die Naturvariante spricht, dass ihr mit dreiundsechzig Prozent fast dreimal so viel Erfolg winkt wie der häuslichen Lösung.
Wenn die Nachtschicht zu Ende ist, esse ich etwas und lege mich dann für ein paar Stunden hin. Ich brauche nicht viel Schlaf. Gegen zwölf bin ich meistens wieder auf und erledige die Arbeiten, für die Dobbs zu alt ist. Vor einer Woche habe ich Randolph dazu überredet, Dobbs als meinen Assistenten einzustellen. Dobbs ist für die leichten Jobs zuständig, ich mache alles andere. Er wandert mit dem Staubsauger durch das Gebäude, ich schleppe die neuen Gasflaschen für Madame Robespierre in die Küche. Er räumt die alten Zeitungen aus der Lobby und leert die Aschenbecher, ich steige in den Liftschacht, um Alfreds Sozialversicherungskarte rauszuholen. Ich zerre den Abfallcontainer über den Hinterhof bis zur Straßenecke, ich streiche Fett in die Scharniere der Feuerleiter, ich säge die Bretter zu, die unter Mazurskys Matratze kommen, damit sein ausgeleierter Rücken nicht noch krummer wird, und ich suche auf dem Dach nach dem Leck, durch das Wasser ins oberste Stockwerk dringt, während sich der Himmel über mir entleert.
Читать дальше