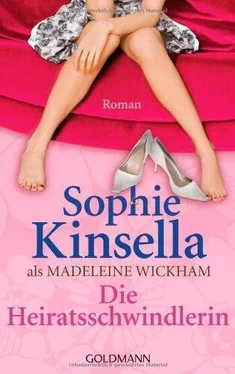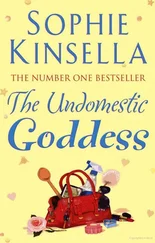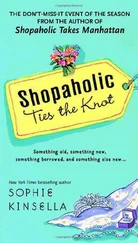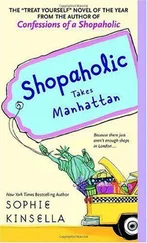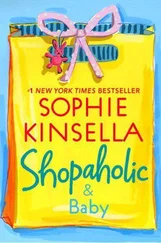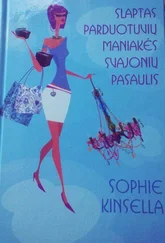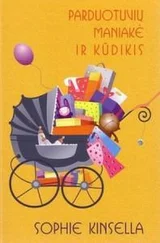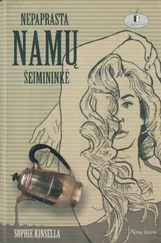»Ihr hattet also wirklich keine Ahnung, dass sie verheiratet ist?«, wollte Harry wissen.
»Nicht die geringste.«
»Sie hat euch alle angelogen.«
»Jeden Einzelnen von uns«, erwiderte James ernst. Als er aufsah, grinste Harry ihn an. »Was? Du findest das lustig?«
»Ach, komm«, meinte Harry. »Die Chuzpe des Mädchens muss man einfach bewundern! Dazu gehört schon was, mit dem Bewusstsein zum Altar zu schreiten, dass da draußen ein Ehemann nur darauf wartet, dir eine Falle zu stellen.«
»So kann man das auch sehen.«
»Du nicht?«
»Nein.« James schüttelte den Kopf. »So, wie ich das sehe, hat Milly mit ihrer Gedankenlosigkeit vielen eine Menge Ärger und Kummer bereitet. Ich schäme mich, dass sie meine Tochter ist.«
»Ach komm, lass sie in Ruhe!«
»Dann lass Simon auch in Ruhe!«, entgegnete James. »Er ist unschuldig, denk dran. Der Gelackmeierte.«
»Er ist ein überheblicher, moralistischer kleiner Diktator. Das Leben muss in gewissen Bahnen verlaufen, ansonsten ist er nicht interessiert.« Harry trank einen Schluck Bier. »Er hat es viel zu lange viel zu einfach gehabt, das ist sein Problem.«
»Weißt du, ich würde genau das Gegenteil behaupten«, meinte James. »Kann nicht leicht sein, in deinem Schatten zu stehen. Bin mir nicht sicher, ob ich selbst das fertig brächte.«
Harry zuckte wortlos mit den Achseln. Eine Weile schwiegen beide. Harry leerte sein Bier, hielt einen Augenblick inne und sah dann auf.
»Wie geht’s Isobel?«, fragte er beiläufig. »Wie hat sie auf die ganze Sache reagiert?«
»Wie üblich«, meinte James. »Hat wenig rausgelassen.« Er leerte sein Glas. »Die arme Isobel hat augenblicklich selber genug am Hals.«
»Berufliche Probleme?« Harry lehnte sich vor.
»Nicht nur.«
»Also noch was anderes? Steckt sie irgendwie in Schwierigkeiten?« Der Anflug eines Lächelns huschte über James’ Gesicht.
»Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen.«
»Wie meinst du das?«
James starrte in sein leeres Bierglas.
»Ich schätze, ein großes Geheimnis ist es ohnehin nicht«, sagte er und blickte in Harrys nachdenkliches Gesicht. »Sie ist schwanger.«
»Schwanger?« Ein Ausdruck blanken Schocks erschien auf Harrys Miene. »Isobel ist schwanger?«
»Ja. Ich kann’s selbst kaum glauben.«
»Und ihr seid euch da ganz sicher?«, fragte Harry. »Kein Irrtum möglich?«
Gerührt über Harrys Besorgnis, lächelte James ihn an.
»Keine Bange. Die kriegt das schon hin.«
»Hat sie mit dir darüber gesprochen?«
»Sie lässt sich nicht recht in die Karten schauen«, sagte James. »Wir wissen nicht mal, wer der Vater ist.«
»Ah.« Harry trank einen großen Schluck Bier.
»Das Einzige, was wir tun können, ist, sie zu unterstützen, egal, welche Entscheidung sie trifft.«
»Entscheidung?« Harry sah auf.
»Na, ob sie das Kind behalten will oder … nicht.« James zuckte verlegen die Achseln und sah fort. Ein seltsamer Ausdruck trat in Harrys Augen.
»Oh, ich verstehe«, sagte er bedächtig. »Das wäre natürlich eine Möglichkeit.« Er schloss die Augen. »Dumm von mir.«
»Was?«
»Nichts.« Harry schlug die Augen wieder auf. »Nichts.«
»Wie auch immer«, sagte James. »Dein Problem ist es nicht.« Er sah auf Harrys leeres Glas. »Ich besorge dir noch eins.«
»Nein. Ich hole dir noch eins.«
»Aber du hast doch schon …«
»Bitte, James.« James fand, dass Harry plötzlich niedergeschlagen klang. Fast traurig. »Bitte, James. Lass mich.«
Isobel war bis zum Garden for the Blind marschiert. Nun saß sie auf einer gusseisernen Bank, sah zu, wie das Brunnenwasser unaufhörlich in den kleinen Teich tröpfelte, und versuchte, in Ruhe nachzudenken. Einem Endlosfilm gleich, sah sie immer wieder Harrys Gesichtsausdruck vor sich, als sie ihn verlassen hatte; hörte immer wieder seine Stimme. Die ständige Wiederholung hätte den Schmerz in ihr eigentlich dämpfen müssen, hätte sie in die Lage versetzen müssen, ihre Situation logisch zu analysieren. Aber der Schmerz ließ nicht nach; ihre Gedanken kamen nicht zur Ruhe. Sie fühlte sich innerlich völlig zerrissen.
Sie und Harry hatten sich erst vor ein paar Monaten anlässlich Millys und Simons Verlobungsfeier kennen gelernt. Gleich beim Händeschütteln hatte es zwischen ihnen gefunkt. Beider Stimmen hatten leicht gebebt, und wie Spiegelbilder hatten sie sich beide rasch abgewandt und mit anderen gesprochen. Aber Harrys Augen ruhten jedes Mal auf ihr, wenn sie sich umdrehte, und sie spürte, wie ihr ganzer Körper auf seine Aufmerksamkeit reagierte. In der Woche darauf trafen sie sich heimlich zum Dinner. Er schmuggelte sie zu sich ins Haus, und am nächsten Morgen beobachtete sie von seinem Schlafzimmerfenster aus, wie Milly Simon auf der Auffahrt hinterherwinkte. Im nächsten Monat waren sie in verschiedenen Flugzeugen nach Paris gereist. Jede Begegnung war etwas ganz Besonderes gewesen. Sie hatten beschlossen, es niemandem zu erzählen, die Dinge locker und unverbindlich zu lassen. Zwei Erwachsene, die einander genossen, weiter nichts.
Doch jetzt konnte nichts mehr locker sein, nichts unverbindlich. Welchen Weg auch immer sie einschlug – er hatte enorme Konsequenzen. Sie würde Harry verlieren. Sie würde ihre Freiheit verlieren. Sie wäre notgedrungen auf die Hilfe ihrer Mutter angewiesen. Das Leben würde ein unerträgliches Einerlei aus Arbeit, Kaffeeklatsch mit anderen Müttern und geisttötendem Babygebrabbel werden.
Wenn sie das Kind andererseits abtrieb …
Sie verspürte einen Stich in der Brust. Wem machte sie was vor? Worin bestand diese so genannte Wahl? Ja, sie hatte eine Wahl. Jede moderne Frau hatte eine Wahl. Aber in Wahrheit hatte sie keine. Sie war Sklavin ihrer selbst – Sklavin ihrer mütterlichen Gefühle, von deren Existenz sie nichts geahnt hatte, Sklavin des kleinen Geschöpfes, das in ihr wuchs, des ursprünglichen, überwältigenden Wunsches nach Leben.
Rupert saß in der National Portrait Gallery auf einer Bank und starrte ein Gemälde Philipps II. von Spanien an. Es war gute zwei Stunden her, dass Martin sich verabschiedet, Ruperts Hand umschlossen und ihn ermahnt hatte, anzurufen, wann immer ihm danach war. Seitdem war Rupert ziellos herumgeirrt, völlig in seine Gedanken vertieft, ohne die Scharen von Einkaufsbummlern und Touristen zu registrieren, mit denen er immer wieder zusammenstieß. Von Zeit zu Zeit versuchte er, Milly anzurufen. Aber jedes Mal war besetzt, doch er war insgeheim erleichtert. Er wollte Allans Tod mit niemandem teilen. Noch nicht.
Der Brief steckte immer noch ungeöffnet in seiner Aktentasche. Er hatte noch nicht gewagt, ihn aufzumachen. Seine Angst war einfach zu groß – sowohl davor, dass er seinen Erwartungen nicht entsprach, als auch davor, dass er es tat. Doch nun, unter Philipps strengem, kompromisslosem Blick griff Rupert zu seiner Tasche, fummelte an den Verschlüssen herum und zog den Brief hervor. Wieder verspürte er einen schmerzvollen Stich, als er seinen Namen in Allans Handschrift sah. Das war die letzte Kommunikation, die je zwischen ihnen stattfinden würde. Ein Teil von ihm wollte den Brief ungeöffnet begraben, Allans letzte Worte ungelesen und unbefleckt lassen. Aber noch während ihm der Gedanke durch den Kopf ging, riss er schon mit zitternden Händen an dem Papier, und er zog dicke, cremefarbene Briefbögen heraus, jeder einseitig mit einer schwarzen, gleichmäßigen Schrift bedeckt.
Lieber Rupert,
Fürchtet euch nicht! Fürchtet euch nicht, sagte der Engel. Ich möchte Dir mit diesem Brief kein schlechtes Gewissen machen. Zumindest nicht bewusst. Nicht viel.
Eigentlich weiß ich nicht mal genau, warum ich überhaupt schreibe. Wirst Du diesen Brief je lesen? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich hast Du schon vergessen, wer ich bin; wahrscheinlich bist Du glücklich verheiratet und hast Drillinge. Gelegentlich gebe ich mich der Vorstellung hin, Du stündest plötzlich in der Tür und nähmst mich in die Arme, und die anderen todgeweihten Patienten würden jubeln und mit ihren Stöcken auf den Boden trommeln. In Wirklichkeit wird dieser Brief, wie so viele andere einst bedeutsame Ereignisse dieser Welt, in einem Müllwagen landen, um zu irgendjemandes Frühstück recycelt zu werden. Der Gedanke gefällt mir. Allanflakes. Mit einer extra Portion Optimismus und einer Spur Bitterkeit.
Читать дальше