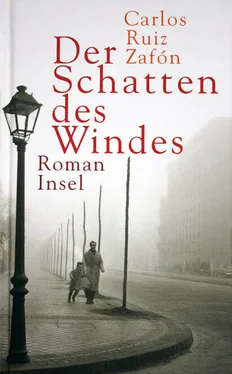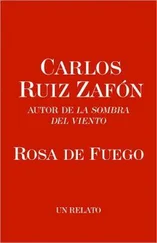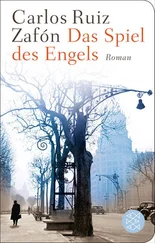»Es ist die Geschichte, die Sie gesucht haben, Daniel. Die Geschichte einer Frau, die ich nie kennengelernt habe, obwohl sie meinen Namen trug und mein Blut hatte. Jetzt gehört sie Ihnen.« Ich steckte den Umschlag in die Manteltasche.
»Ich muß Sie bitten, mich allein zu lassen. Vor einer Weile, als ich diese Seiten las, habe ich gedacht, ich finde sie wieder. Sosehr ich mich auch bemühe, ich kann mich an sie nur erinnern, als sie noch ein Mädchen war. Als Kind war sie sehr schweigsam, wissen Sie. Am meisten haben ihr Märchen gefallen. Immer hat sie mich gebeten, ihr Märchen vorzulesen, und ich glaube nicht, daß je ein Kind früher lesen gelernt hat. Sie wollte auch Geschichten erfinden und Schriftstellerin werden. Ihre Mutter sagte, das alles ist deine Schuld, Nuria betet dich an, und da sie denkt, du liebst nur Bücher, will sie eben Bücher schreiben, damit du auch sie liebst.«
»Isaac, ich halte es nicht für eine gute Idee, daß sie heute nacht allein bleiben. Warum kommen Sie nicht mit mir? Sie verbringen die Nacht bei uns und leisten erst noch meinem Vater Gesellschaft.« Wieder schüttelte er den Kopf.
»Ich habe zu tun, Daniel. Gehen Sie nach Hause und lesen Sie diese Seiten. Sie gehören Ihnen.« Der Alte wandte sich ab, und ich ging zur Tür. Ich stand bereits auf der Schwelle, als seine Stimme mich rief, beinahe flüsternd.
»Daniel?«
»Ja?«
»Seien Sie sehr vorsichtig.« Auf der Straße war es, als schleppe sich die Schwärze übers Pflaster, dicht auf meinen Fersen. Ich ging schneller und behielt dieses Tempo bei, bis ich zu unserer Wohnung in der Calle Santa Ana kam. Beim Eintreten sah ich meinen Vater mit einem Buch auf seinem Sessel sitzen. Es war ein Fotoalbum. Als er mich erblickte, stand er mit so erleichtertem Ausdruck auf, als wäre ihm ein gewaltiger Stein vom Herzen gefallen.
»Ich habe mir schon Sorgen gemacht«, sagte er.
»Wie war die Beerdigung?« Ich zuckte die Schultern, und er nickte ernst, womit das Thema abgeschlossen war.
»Ich habe dir etwas zu essen gemacht. Wenn du magst, wärme ich es auf, und…«
»Ich habe keinen Hunger, danke. Ich habe unterwegs etwas Kleines gegessen.« Er schaute mir in die Augen, nickte wieder und begann die Teller vom Tisch abzuräumen. Da trat ich, ohne recht zu wissen, warum, zu ihm und umarmte ihn. Überrascht umarmte er mich ebenfalls.
»Daniel, ist dir nicht gut?« Ich drückte ihn kräftig.
»Ich habe dich lieb«, sagte ich leise.Die Glocken der Kathedrale schlugen Mitternacht, als ich Nuria Monforts Manuskript zu lesen begann. Ihre kleine, ordentliche Schrift erinnerte mich an die Reinlichkeit ihres Schreibtischs, als hätte sie in den Worten den Frieden und die Sicherheit gesucht, die ihr das Leben versagt hatte.
Nuria Monfort: Bericht über Erscheinungen
1933–1955
Julián Carax und ich lernten uns im Herbst 1933 kennen. Damals arbeitete ich für den Verleger Josep Cabestany. Señor Cabestany hatte Carax 1927 auf einer seiner verlegerischen
»Sondierungsreisen« nach Paris entdeckt. Julián verdiente sich seinen Lebensunterhalt mit abendlichem Klavierspielen in einem Animierlokal, und des Nachts schrieb er. Die Inhaberin des Lokals, eine gewisse Irène Marceau, verkehrte mit den meisten Pariser Verlegern, und dank ihrer Bitten, Gefälligkeiten und Indiskretionsdrohungen hatte Julián in verschiedenen Verlagen mehrere Romane veröffentlichen können — mit katastrophalem kommerziellem Ergebnis. Für einen Spottpreis, der die Übersetzung der französisch geschriebenen Originale ins Spanische durch den Autor einschloß, hatte Cabestany die Exklusivrechte erworben, um Carax’ Werke in Spanien und Südamerika herauszubringen. Er war zuversichtlich, von jedem etwa dreitausend Exemplare absetzen zu können, aber die ersten beiden in Spanien publizierten Titel waren ein totales Fiasko: Von beiden wurden kaum hundert Exemplare verkauft. Trotz dieser Mißerfolge bekamen wir alle zwei Jahre von Julián ein neues Manuskript, das Cabestany immer bedenkenlos akzeptierte, da er mit dem Autor eine Verpflichtung eingegangen sei, schließlich bedeute Gewinn nicht alles und gute Literatur müsse man fördern.
Neugierig fragte ich ihn eines Tages, warum er weiterhin Romane von Julián Carax veröffentliche und dabei regelmäßig Geld verliere. Wortlos ging er zu seinem Regal, zog eines von Juliáns Büchern heraus und forderte mich auf, es zu lesen. Das tat ich. Zwei Wochen später hatte ich sie alle gelesen. Diesmal lautete meine Frage, wie es möglich war, daß wir von diesen Romanen so wenig Exemplare verkauften.
»Ich weiß es nicht«, sagte Cabestany.
»Aber wir werden es weiterhin versuchen.« Das erschien mir eine bewundernswerte Geste, die nicht zu dem Bild von Geschäftstüchtigkeit passen wollte, das ich mir von Cabestany gemacht hatte. Vielleicht hatte ich ihn falsch eingeschätzt. Die Person von Julián Carax interessierte mich immer mehr. Alles mit ihm Zusammenhängende war von Geheimnis umgeben. Zumindest ein- oder zweimal monatlich rief jemand an und fragte nach Julián Carax’ Adresse in Paris. Bald merkte ich, daß es immer dieselbe Stimme war, die sich jedesmal als jemand anders ausgab. Ich sagte jeweils bloß das, was schon auf der letzten Seite der Bücher stand: daß Julián in Paris wohnte. Mit der Zeit meldete sich der Mann nicht mehr. Für alle Fälle hatte ich Juliáns Adresse aus den Verlagsarchiven gestrichen. Ich war die einzige, die ihm schrieb, und ich kannte sie auswendig.Monate später fiel mir zufällig ein Ordner mit Rechnungen in die Hand. Einerseits waren es die, welche die Druckerei für die Herstellungskosten von Julián Carax’ Büchern an Señor Cabestany schickte. Anderseits waren es Kopien der Rechnungen, die Cabestany seinerseits an jemanden schickte, der diese Kosten in voller Höhe übernahm. Es war ein Mann, der mit dem Verlag nichts zu tun und von dem ich noch nie gehört hatte: Miquel Moliner. Aber die Druck- und Auslieferungskosten waren wesentlich niedriger als die Señor Moliner fakturierte Summe, was bedeutete, daß der Verlag Geld verdiente, indem er Bücher druckte, welche direkt in ein Lager wanderten. Ich hatte nicht den Mut, Cabestanys finanzielle Machenschaften zu hinterfragen — ich fürchtete um meine Stelle. Aber ich schrieb mir die Adresse dieses Miquel Moliner auf, eine Hausnummer in der Calle Puertaferrisa. Monatelang trug ich diese Adresse mit mir herum, ehe ich es wagte, ihn aufzusuchen. Schließlich siegte mein Gewissen, und ich ging zu ihm, um ihm zu sagen, daß Cabestany ihn übers Ohr haue. Er lächelte und sagte, er wisse es.
»Jeder macht das, wozu er taugt.« Ich fragte ihn, ob er derjenige sei, der so oft angerufen habe, um Carax’ Adresse herauszufinden. Er verneinte und schärfte mir mit ernster Miene ein, diese Adresse niemandem zu geben. Niemals.Miquel Moliner war ein rätselhafter Mann. Er lebte allein in einem höhlenartigen, halb zerfallenen Palast, der zur Erbschaft seines Vaters gehörte, eines Industriellen, der mit der Fabrikation von Waffen und, wie es hieß, als Kriegsgewinnler reich geworden war. Miquel lebte alles andere als in Saus und Braus, sondern führte ein fast mönchisches Leben und ließ es sich angelegen sein, das in seinen Augen blutbesudelte Geld für die Restaurierung von Museen, Kathedralen, Schulen, Bibliotheken und Krankenhäusern durchzubringen und sicherzustellen, daß die Werke seines Jugendfreundes Julián Carax in seiner Geburtsstadt veröffentlicht wurden.
»Geld habe ich mehr als genug, Freunde wie Julián aber fehlen mir«, sagte er als einzige Erklärung.Mit seinen Geschwistern oder den restlichen Familienmitgliedern, von denen er wie von Fremden sprach, hatte er kaum Kontakt. Er war unverheiratet und verließ selten das Grundstück seines kleinen Palastes, in dem er nur den oberen Stock bewohnte. Dort hatte er sein Büro eingerichtet, wo er fieberhaft Artikel und Kolumnen für mehrere Madrider und Barceloneser Zeitungen und Zeitschriften verfaßte, technische Texte aus dem Französischen und Deutschen übersetzte sowie Lexika und Schulbücher stilistisch überarbeitete. Miquel Moliner war besessen von der Krankheit des Büßerfleißes, und obwohl er bei andern den Müßiggang respektierte, ja sie darum beneidete, mied er ihn selbst wie die Pest. Aber er prahlte nicht mit seinem Arbeitsethos, sondern machte sich über seinen Produktionszwang lustig und nannte ihn eine harmlosere Art der Feigheit.
Читать дальше