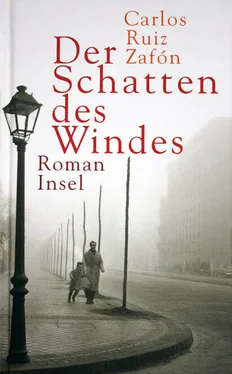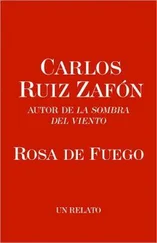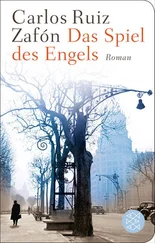»Ohne irgendwas zu lesen, geht es bei mir einfach nicht«, sagte ich.
»Genau wie bei mir. Und dann heißt es, die Spanier lesen nicht. Borgen Sie es mir?«
»Da oben auf dem Spülkasten ist die letzte Empfehlung des nationalen Kulturrats. Damit liegen Sie goldrichtig.« Ohne die Haltung zu verlieren, ging ich zu meinem Vater zurück, der dabei war, mir eine Tasse Milchkaffee zu machen.
»Was will der denn?« fragte ich.
»Er hat mir geschworen, er scheißt gleich in die Hose. Was sollte ich tun?«
»Ihn auf der Straße lassen — so wäre ihm warm geworden.« Mein Vater runzelte die Stirn.
»Wenn es dir nichts ausmacht, geh ich gleich nach oben.«
»Ja, natürlich. Und zieh dir trockene Sachen an, sonst kriegst du noch eine Lungenentzündung.« In der Wohnung war es kalt und still. Ich ging in mein Zimmer und spähte aus dem Fenster. Die zweite Wache stand noch immer da unten, vor dem Eingang zur Kirche Santa Ana. Ich zog die nassen Kleider aus und schlüpfte in einen warmen Pyjama und einen Morgenmantel, der meinem Großvater gehört hatte. Dann legte ich mich aufs Bett, ohne auch nur das Licht anzuknipsen, und überließ mich dem Halbdunkel und dem Prasseln des Regens auf den Scheiben. Ich schloß die Augen und versuchte Beas Bild, Berührung und Geruch heraufzubeschwören. In der vergangenen Nacht hatte ich kein Auge zugetan, und bald übermannte mich die Müdigkeit.Als ich erwachte, dämmerte durch die beschlagenen Scheiben grau der Morgen herein. Ich zog mich warm an, mit halbhohen Stiefeln. Dann ging ich leise auf den Gang hinaus, tastete mich durch die Wohnung und glitt auf die Straße hinaus. In der Ferne leuchteten schon die Lichter der Kioske auf den Ramblas. An dem bei der Einmündung zur Calle Tallers kaufte ich die erste Ausgabe des Tages, die noch nach frischer Farbe roch. Eilig blätterte ich mich durch die Seiten zu den Todesanzeigen. Nuria Monforts Name stand unter einem Kreuz, und ich spürte, wie mir die Augen flackerten. Mit der zusammengefalteten Zeitung unter dem Arm machte ich mich auf die Suche nach Dunkelheit. Die Beerdigung fand an diesem Nachmittag auf dem Friedhof des Montjuïc statt. Auf einem Umweg ging ich wieder nach Hause. Mein Vater schlief noch. In meinem Zimmer setzte ich mich an den Schreibtisch und zog den Füllfederhalter aus seinem Etui. Ich nahm ein weißes Blatt Papier und wünschte mir, er möchte mich lenken. Doch in meinen Händen hatte er nichts zu sagen. Umsonst suchte ich nach den Worten, die ich Nuria Monfort anbieten wollte, aber ich war unfähig, irgend etwas zu schreiben oder zu empfinden außer der unerklärlichen Angst, die mir ihr Fehlen verursachte. Schattenhaft gehst du hin, dachte ich. So, wie du gelebt hast.
Kurz vor drei Uhr nachmittags stieg ich auf dem Paseo de Colón in den Bus, der mich zum Friedhof des Montjuïc bringen sollte. Durchs Fenster sah man den Wald von Masten und flatternden Wimpeln im Hafenbecken. Der fast leere Bus fuhr um den Montjuïc-Hügel herum und nahm dann die Straße hinauf zum Eingang dieses großen Stadtfriedhofs. Ich war der letzte Fahrgast.
»Wann kommt denn der letzte Bus vorbei?« fragte ich den Fahrer.
»Um halb fünf.« Vor dem Friedhofseingang stieg ich aus. Eine Zypressenallee erhob sich im Dunst. Sogar von hier aus, zu Füßen des Hügels, erkannte man die unendliche Totenstadt, die immer weiter den Hang hinaufgewachsen war, bis sie die Kuppe überschritten hatte. Ein Labyrinth aus Gräbern, Grabsteinen, monumentalen Mausoleen, von Feuerengeln gekrönten Türmen, bemoosten Steinstatuen, die im Morast versanken. Ich atmete tief durch und ging hinein. Meine Mutter war etwa hundert Meter von diesem Weg entfernt begraben. Bei jedem Schritt spürte ich die Kälte dieses Ortes, den Schrecken der in vergilbten Fotomedaillons zwischen Kerzen und verwelkten Blumen festgehaltenen Gesichter. Kurz danach konnte ich in der Ferne die um das Grab herum angezündeten Gaslaternen sehen. Ein halbes Dutzend Menschen standen vor einem aschfarbenen Himmel. Ich beschleunigte meine Schritte und blieb stehen, sobald ich die Worte des Priesters vernehmen konnte.Der Sarg, eine Kiste aus unpoliertem Pinienholz, lag auf dem Lehm. Auf ihre Schaufeln gestützt, bewachten ihn zwei Totengräber. Ich betrachtete mir die Anwesenden. Der alte Isaac, der Aufseher des Friedhofs der Vergessenen Bücher, war nicht zur Beerdigung seiner Tochter gekommen. Ich erkannte Nuria Monforts Etagennachbarin, die unter Kopfschütteln weinte, während ihr ein abgehärmter Mann tröstend den Rücken streichelte, vermutlich ihr Mann. Neben ihnen stand eine etwa vierzig Jahre alte Frau, die einen Blumenstrauß trug. Sie weinte lautlos und mit zusammengepreßten Lippen, den Blick vom Grab abgewandt. Ich hatte sie noch nie gesehen. Etwas abseits der Gruppe befand sich in seinem grauen Mantel, den Hut auf dem Rücken, der Polizist, der mir am Vortag das Leben gerettet hatte, Palacios. Er schaute auf und beobachtete mich einige Sekunden, ohne mit der Wimper zu zucken. Die blinden, sinnentleerten Worte des Priesters waren das einzige, was uns von der schrecklichen Stille trennte. Ich betrachtete den mit Lehm besprenkelten Sarg und stellte mir vor, wie Nuria Monfort drin lag, und merkte nicht, daß ich weinte, bis die Unbekannte in Grau zu mir trat und mir eine Blume aus ihrem Strauß gab. Ich blieb stehen, bis sich die Gruppe zerstreute und die Totengräber auf ein Zeichen des Priesters ihre Arbeit zu verrichten begannen. Ich steckte die Blume in die Manteltasche und ging, unfähig, das Lebewohl auszusprechen, das ich mitgebracht hatte.Es begann zu dämmern, als ich zum Friedhofseingang kam, und ich nahm an, ich hätte den letzten Bus verpaßt, so daß ich mich darauf einrichtete, eine lange Wanderung zu machen, und auf der Straße losmarschierte, die den Hafen entlang nach Barcelona zurückführte. Etwa zwanzig Meter vor mir parkte ein schwarzes Auto mit eingeschaltetem Licht. Im Innern rauchte jemand eine Zigarette. Als ich näher kam, öffnete mir Palacios die Beifahrertür.
»Komm, ich bring dich nach Hause. Um diese Zeit wirst du hier weder einen Bus noch ein Taxi finden.« Ich zögerte einen Augenblick.
»Ich geh lieber zu Fuß.«
»Red keinen Unsinn. Steig ein.« Er sprach mit dem schneidenden Ton dessen, der zu befehlen gewohnt ist und sofortigen Gehorsam erwartet.
»Bitte«, fügte er hinzu.Ich stieg ein, und er ließ den Motor an.
»Enrique Palacios«, sagte er und streckte mir die Hand entgegen. Ich ergriff sie nicht.
»Wenn Sie mich auf dem Paseo de Colón absetzen, ist mir schon gedient.« Mit einem Ruck fuhr der Wagen an. Wir legten ein gutes Stück zurück, ohne ein Wort zu sagen.
»Ich möchte, daß du weißt, daß mir das mit Señora Monfort sehr leid tut.« Aus seinem Mund kamen mir diese Worte wie eine Obszönität, als Beleidigung vor.
»Ich danke Ihnen, daß Sie mir neulich das Leben gerettet haben, aber ich muß Ihnen sagen, daß es mich einen Dreck interessiert, was Sie empfinden, Señor Enrique Palacios.«
»Ich bin nicht das, was du denkst, Daniel. Ich möchte dir helfen.«
»Wenn Sie erwarten, daß ich Ihnen sage, wo Fermín ist, können Sie mich gleich hier absetzen.«
»Es interessiert mich einen feuchten Staub, wo dein Freund ist. Ich bin jetzt nicht im Dienst.« Ich sagte nichts.
»Du hast kein Vertrauen zu mir, und ich kann es dir nicht verdenken. Aber hör mir wenigstens zu. Das alles ist schon zu weit gediehen. Diese Frau hätte nicht zu sterben brauchen. Ich bitte dich, die ganze Geschichte fahrenzulassen und diesen Mann, Carax, für immer zu vergessen.«
»Sie reden, als wäre das, was da geschieht, mein Wille. Ich bin nur Zuschauer. Die Vorstellung bestreitet Ihr Chef mit Ihnen und Ihren Kollegen.«
»Ich habe die Beerdigungen satt, Daniel. Ich möchte nicht auch noch deiner beiwohnen müssen.«
»Um so besser, Sie sind nämlich nicht eingeladen.«
Читать дальше