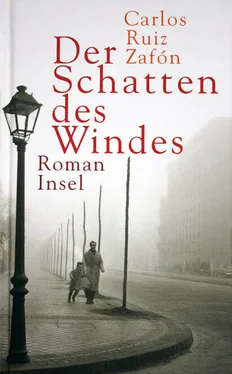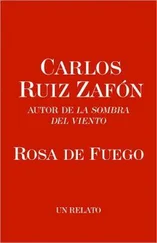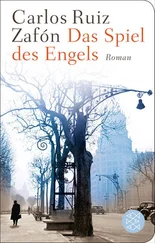»Geh, Daniel. Verlaß diese Wohnung und komm nicht wieder. Du hast schon genug angerichtet.« Ich ließ sie im Eßzimmer zurück und ging auf die Tür zu. Auf halbem Weg blieb ich stehen und kehrte um. Nuria Monfort saß auf dem Boden, den Rücken an die Wand gelehnt. Der ganze Zauber um ihre Erscheinung war dahin.
Den Blick starr auf den Boden gerichtet, ging ich über die Plaza de San Felipe Neri. Ich schleppte den Schmerz mit, den ich von den Lippen dieser Frau genommen hatte, einen Schmerz, als dessen Komplize und Instrument ich mich jetzt fühlte, ohne jedoch zu begreifen, wie und warum. ›Du weißt nicht, was du angerichtet hast, Daniel.‹ Ich wollte nur noch weg von hier. Als ich an der Kirche vorüberging, bemerkte ich den hageren Priester mit der großen Nase kaum, der mich, Meßbuch und Rosenkranz in der Hand, vor dem Eingang bedächtig segnete. Erst einige Minuten später ging mir ein Licht auf.
Ich kam mit beinahe einer dreiviertel Stunde Verspätung in die Buchhandlung zurück. Als mein Vater mich erblickte, runzelte er vorwurfsvoll die Stirn und schaute auf die Uhr.
»Ziemlich spät. Ihr wißt, daß ich zu einem Kunden nach Sant Cugat muß, und laßt mich hier allein.«
»Und Fermín? Ist er noch nicht zurück?« Mein Vater schüttelte mürrisch den Kopf.
»Übrigens, du hast einen Brief. Ich hab ihn dir neben die Kasse gelegt.«
»Entschuldige, Papa, aber…«
Mit einer Handbewegung bedeutete er mir, ich solle mir die Entschuldigungen sparen, bewehrte sich mit Mantel und Hut und ging grußlos zur Tür hinaus. So, wie ich ihn kannte, würde sich sein Ärger verflogen haben, noch bevor er am Bahnhof war. Was mich erstaunte, war Fermíns Ausbleiben. Ich hatte ihn auf der Plaza de San Felipe als Priester gesehen, wo er darauf wartete, daß Nuria Monfort herausgeschossen käme und ihn zum großen Geheimnis des Komplotts führte. Mein Glaube an diese Strategie war zu Asche geworden, und ich stellte mir vor, falls Nuria Monfort wirklich aus dem Haus käme, würde ihr Fermín am Ende zur Apotheke oder Bäckerei folgen. Ein vortrefflicher Plan. Ich ging zur Kasse, um einen Blick auf den von meinem Vater erwähnten Brief zu werfen. Der Umschlag trug einen aufgedruckten Absender, der mir das bißchen Mut zunichte machte, das mir noch geblieben war, um den Tag zu überstehen. MILITÄRBEZIRK BARCELONA MUSTERUNGSBÜRO
»Halleluja«, murmelte ich.
Ich wußte, was der Umschlag enthielt, ohne ihn öffnen zu müssen, aber ich tat es trotzdem, um mich im Schlamm zu suhlen. Das Schreiben war knapp gehalten, zwei Absätze in dieser Prosa zwischen glühender Proklamation und Operettenarie, die charakteristisch ist für das militärische Briefwesen. Es wurde mir verkündet, ich, Daniel Sempere Martín, hätte in zwei Monaten die Ehre und den Stolz, mich der heiligsten und erbauendsten Aufgabe anzuschließen, welche das Leben dem hispanischen Manne anzubieten habe: der Heimat zu dienen und die Uniform des nationalen Kreuzzuges zur Verteidigung des geistigen Bestands des Abendlandes anzuziehen. Ich baute darauf, daß Fermín der Sache wenigstens eine Pointe abringen und uns mit seiner Versversion von Der Fall des jüdisch-freimaurerischen Trutzbündnisses eine Weile zum Lachen bringen könnte. Zwei Monate. Acht Wochen. Sechzig Tage. Ich konnte die Zeit immer weiter unterteilen, bis ich zu den Sekunden und damit auf eine immense Zahl kam. Es blieben mir noch fünf Millionen hundertvierundachtzigtausend Sekunden Freiheit.
Vielleicht konnte mir Don Federico, der nach Ansicht meines Vaters in der Lage war, eigenhändig einen Volkswagen zu bauen, eine Uhr mit Scheibenbremsen machen. Vielleicht erklärte mir jemand, wie ich es anstellen sollte, um Bea nicht für immer zu verlieren. Als ich die Türglocke hörte, dachte ich, Fermín sei endlich zurückgekommen, in der Überzeugung, unsere detektivischen Bemühungen seien nicht einmal für einen Witz gut.
»Nanu, der Erbe bewacht das Schloß, wie es seine Pflicht und Schuldigkeit ist, wenn auch mit Leichenbittermiene. Mach ein heiteres Gesicht, Junge, du siehst ja aus wie ein Karpfen mit Migräne«, sagte Gustavo Barceló, angetan mit einem Kamelhaarmantel und einen Elfenbeinstock in der Hand, den er nicht brauchte und wie einen Weihwasserwedel schwang.
»Ist dein Vater nicht da, Daniel?«
»Tut mir leid, Don Gustavo. Er ist zu einem Kunden gegangen und kommt wahrscheinlich erst…«
»Sehr gut. Ich will nämlich nicht zu ihm, und es ist besser, er hört nicht, was ich dir zu sagen habe.« Er blinzelte mir zu, während er aus den Handschuhen schlüpfte und verdrießlich den Laden betrachtete.
»Und unser Kollege Fermín? Ist er auch irgendwo?«
»Im Gefecht verschwunden.«
»Vermutlich bei der Anwendung seiner Talente auf die Lösung des Falles Carax.«
»Mit Leib und Seele. Das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, trug er eine Soutane und erteilte den Segen urbi et orbi.«
»Hm… Es ist meine Schuld, weil ich euch aufgehetzt habe. Hätte ich doch den Schnabel gehalten.«
»Ich sehe, Sie sind etwas unruhig. Ist etwas geschehen?«
»Nicht direkt. Oder doch, in gewisser Hinsicht schon.«
»Was wollten Sie mir erzählen, Don Gustavo?« Er lächelte mir sanft zu. Sein üblicher hochmütiger Ausdruck und seine Salonarroganz waren einem gewissen Ernst, einem Anflug von Vorsicht und nicht geringer Besorgnis gewichen.
»Heute morgen habe ich Don Manuel Gutiérrez Fonseca kennengelernt, 59, Junggeselle und seit 1924 Angestellter des städtischen Leichenschauhauses. Dreißig Jahre Dienst auf der Schwelle zur Finsternis — das stammt von ihm, nicht von mir. Don Manuel ist ein Herr alter Schule, höflich, nett und entgegenkommend. Er wohnt seit fünfzehn Jahren zur Untermiete in einem Zimmer in der Calle de la Ceniza, das er mit zwölf Wellensittichen teilt, die den Trauermarsch zu trällern gelernt haben. Er hat ein Abonnement für den Olymp des Liceo-Theaters und mag Verdi und Donizetti. Er hat mir gesagt, das Entscheidende an seiner Arbeit sei es, das Reglement zu befolgen. Im Reglement ist alles vorgesehen, insbesondere bei Situationen, in denen man nicht mehr weiterweiß. Ein Beispiel: Vor fünfzehn Jahren hat Don Manuel einmal einen von der Polizei gebrachten Leinensack geöffnet und sich dem besten Freund seiner Kindheit gegenübergesehen. Der Rest der Leiche kam in einem separaten Sack. Don Manuel hat sich über die Erschütterung hinweggesetzt und das Reglement befolgt.«
»Möchten Sie einen Kaffee, Don Gustavo? Sie werden ja ganz gelb.«
»Ich bitte darum.« Ich holte die Thermoskanne und schenkte ihm eine Tasse mit sieben Stück Zucker ein. Er trank sie in einem Zug aus.
»Besser?«
»Es geht gleich wieder. Also, Don Manuel hatte Dienst an dem Tag, an dem Julián Carax’ Leichnam in die Nekropsie kam, im September 1936. Natürlich erinnerte sich Don Manuel nicht mehr an den Namen, aber ein Nachsuchen in den Archiven und eine Spende von zwanzig Duros für seinen Ruhestandfonds haben sein Gedächtnis bemerkenswert aufgefrischt. Kannst du mir folgen?« Ich nickte, fast in Trance.
»Don Manuel erinnert sich an die Einzelheiten jenes Tages, weil das, wie er mir erzählte, eines der wenigen Male war, wo er sich über das Reglement hinweggesetzt hat. Laut Polizei war der Tote in einer Gasse des Raval gefunden worden, kurz vor Tagesanbruch. Gegen zehn Uhr vormittags gelangte er ins Leichenhaus. Er hatte nur ein Buch und einen Paß bei sich, der ihn als Julián Fortuny Carax auswies, gebürtig aus Barcelona, geboren im Jahr 1900. Der Paß wies einen Stempel des Grenzübergangs La Junquera auf, woraus hervorging, daß Carax das Land einen Monat zuvor betreten hatte. Offensichtlich war die Todesursache eine Schußwunde. Don Manuel ist zwar nicht Arzt, aber mit der Zeit hat er das Repertoire kennengelernt. Seiner Meinung nach war der Schuß — direkt über dem Herzen — aus nächster Nähe abgegeben worden. Dank des Passes konnte man Señor Fortuny, Carax’ Vater, ausfindig machen, der noch am selben Abend ins Leichenhaus kam, wo er den Toten identifizieren sollte.«
Читать дальше