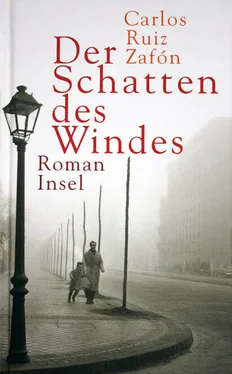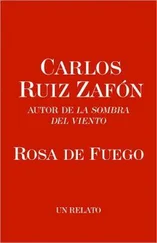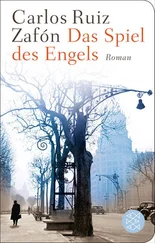»Girón, du Schwein«. Wieder am Tisch, stellte ich fest, daß Fermín an der Theke stand und mit unserem Kellner über Fußball diskutierte, während er die Rechnung bezahlte.
»Geht’s besser?« fragte er.Ich nickte.
»Das ist ein Blutdruckabfall«, sagte er.
»Da, nehmen Sie ein Lutschbonbon, das kuriert alles.« Als wir das Café verließen, beharrte er darauf, mit dem Taxi zur San-Gabriel-Schule zu fahren und uns die UBahn für einen andern Tag aufzuheben, mit dem Argument, es sei ein Morgen wie im Bilderbuch und die Tunnel seien für die Ratten.
»Ein Taxi nach Sarriá kostet ein Vermögen«, warf ich ein.
»Das übernimmt die Berufskasse der Idioten«, sagte er.
»Der Patriot da hat sich im Wechselgeld vertan, und wir haben ein gutes Geschäft gemacht. Und in Ihrem Zustand ist eine Reise unter Tag nichts für Sie.« Derart mit unrechtmäßigen Mitteln versehen, stellten wir uns unten an der Rambla de Cataluña an eine Ecke und warteten auf ein Taxi. Wir mußten einige vorbeifahren lassen, denn Fermín erklärte, wenn er schon einmal in ein Auto steige, müsse es zumindest ein Studebaker sein. Erst nach einer Viertelstunde erschien ein ihm zusagendes Fahrzeug, das er mit aufgeregtem Fuchteln stoppte. Er wollte unbedingt auf dem Vordersitz fahren, was ihm Gelegenheit gab, sich in eine Diskussion über das Gold von Moskau und Josef Stalin einzulassen, der des Fahrers Idol und geistiger Führer auf Distanz war.
»In diesem Jahrhundert hat es drei große Figuren gegeben: Dolores Ibárruri, Manolete und Josef Stalin«, verkündete der Fahrer, entschlossen, uns mit einer detaillierten Hagiographie des illustren Genossen zu beglücken.Ich saß bequem auf dem Rücksitz, ohne mich an dem Gespräch zu beteiligen, und genoß durchs offene Fenster die frische Luft. Fermín, begeistert von der Spazierfahrt im Studebaker, animierte den Fahrer mit gezielten Fragen.
»Nun, ich habe gehört, seit er einen Mispelkern verschluckt hat, leidet er gräßlich an der Prostata und kann jetzt nur noch urinieren, wenn man ihm die Internationale vorsingt«, warf Fermín hin.
»Faschistische Propaganda«, entgegnete der Fahrer.
»Der Genosse pißt wie ein Stier. Mit so ’ner Wassermenge kann selbst die Wolga nicht aufwarten.« Diese angeregte Debatte begleitete uns auf der ganzen Fahrt durch die Vía Augusta zum höhergelegenen Teil der Stadt. Es wurde immer heller, und eine frische Brise überzog den Himmel mit tiefem Blau. Als wir zur Calle Ganduxer gelangten, bog der Fahrer rechts ein, und gemächlich fuhren wir zum Paseo de la Bonanova hinauf.Die San-Gabriel-Schule erhob sich baumumstanden am oberen Ende einer engen Straße, die sich von der Bonanova heraufschlängelte. Die mit dolchförmigen Fenstern gespickte Fassade betonte das Profil eines gotischen Palastes aus rotem Backstein und schien zwischen Bogen und Türmen zu schweben, die in kathedralähnlichen Grannen über die Wipfel der Platanen aufragten. Wir stiegen aus und betraten einen dichtbewachsenen Garten voller Brunnen, aus denen sich verrostete Putten erhoben, und durchflochten von steinernen Pfaden, die zwischen den Bäumen hinanführten. Auf dem Weg zum Haupteingang setzte mich Fermín mit einer seiner Lektionen zur Sozialgeschichte über die Institution ins Bild.
»Obwohl sie Ihnen jetzt wie Rasputins Mausoleum erscheinen mag, war die San-Gabriel-Schule seinerzeit eines der angesehensten und exklusivsten Institute von ganz Barcelona. In den Zeiten der Republik ist sie heruntergekommen, denn die damaligen Neureichen, die neuen Industriellen und Bankiers, deren Sprößlingen man jahrelang einen Platz verweigert hatte, weil ihre Namen nach Neu rochen, beschlossen, ihre eigenen Schulen zu gründen, wo man sie respektvoll behandelte und wo sie ihrerseits anderer Leute Kindern einen Platz verweigern konnten. Das Geld ist wie jedes andere Virus: Sobald die Seele dessen, der es hortet, verfault, macht es sich auf die Suche nach frischem Blut. In dieser Welt währt ein Name weniger lange als eine Zuckermandel. In ihren guten Zeiten, also mehr oder weniger zwischen 1880 und 1930, nahm die San-Gabriel-Schule die Crème de la crème der verwöhnten Kinder aus altem Adel und mit klingender Börse auf. Die Aldayas und Konsorten kamen als Internatsschüler an diesen düsteren Ort, um sich mit ihresgleichen zu verbrüdern, die Messe zu hören und Geschichte zu lernen, damit sie sie auf diese Weise ad nauseam wiederholen konnten.«
»Aber Julián Carax war nicht unbedingt einer von ihnen«, bemerkte ich.
»Nun, manchmal bieten diese vortrefflichen Institutionen für die Kinder des Gärtners oder eines Schuhputzers ein oder zwei Stipendien an, um so ihre Geisteserhabenheit und christliche Großherzigkeit zu demonstrieren. Die wirkungsvollste Art, die Armen unschädlich zu machen, besteht darin, daß man sie lehrt, die Reichen imitieren zu wollen. Das ist das Gift, und damit blendet der Kapitalismus die…«
»Pst, Fermín, wenn einer dieser Geistlichen Sie hört, wird man uns rausschmeißen«, unterbrach ich ihn leise, als ich sah, daß uns oben auf der Treppe, die zum Schulportal emporführte, zwei Priester mit einer Mischung aus Neugier und Reserviertheit beobachteten, und ich fragte mich, ob sie wohl von unserem Gespräch etwas mitbekommen hatten.Einer von ihnen kam mit höflichem Lächeln und bischöflich auf der Brust gefalteten Händen auf uns zu. Er mußte etwa fünfzig sein, und seine schlanke Gestalt und das schüttere Haar ließen ihn wie einen Raubvogel aussehen. Er hatte einen durchdringenden Blick und roch nach frischem Kölnisch Wasser und Mottenpulver.
»Guten Morgen. Ich bin Pater Fernando Ramos«, verkündete er.
»Womit kann ich Ihnen dienen?« Fermín reichte ihm die Hand, die der Priester, in sein eisiges Lächeln gehüllt, kurz studierte, ehe er sie drückte.
»Fermín Romero de Torres, bibliographischer Berater von Sempere und Sohn, höchst erfreut, Ihre fromme Exzellenz zu grüßen. Hier zu meiner Seite befindet sich mein Mitarbeiter und zugleich Freund Daniel, ein junger Mann mit großer Zukunft und von ausgewiesen christlichem Wesen.« Pater Fernando betrachtete uns, ohne mit der Wimper zu zucken. Ich wäre am liebsten im Erdboden verschwunden.
»Das Vergnügen ist ganz meinerseits, Señor Romero de Torres«, antwortete er gallig.
»Darf ich Sie fragen, was dieses großartige Duo zu unserer bescheidenen Anstalt führt?« Ich beschloß einzugreifen, ehe Fermín dem Priester eine weitere Ungeheuerlichkeit auftischte und wir uns eiligst davonmachen müßten.
»Pater Fernando, wir versuchen zwei ehemalige Schüler der San-Gabriel-Schule zu finden: Jorge Aldaya und Julián Carax.« Pater Fernando preßte die Lippen zusammen und zog eine Braue in die Höhe.
»Julián ist vor über fünfzehn Jahren gestorben, und Aldaya ist nach Argentinien ausgewandert«, sagte er knapp.
»Haben Sie sie gekannt?« fragte Fermín.Der sezierende Blick des Priesters verweilte auf jedem von uns, bevor er antwortete.
»Wir waren Klassenkameraden. Darf ich fragen, woher Ihr Interesse rührt?« Ich dachte eben darüber nach, wie wir diese Frage beantworten sollten, da kam mir Fermín zuvor.
»Es ist so, daß uns eine Anzahl Dinge in die Hände gelangt sind, die den beiden Erwähnten gehören oder gehörten — in diesem Punkt ist die Rechtsprechung ja unklar.«
»Und welcher Natur sind die besagten Dinge, wenn die Frage gestattet ist?«
»Ich bitte Euer Gnaden, unser Schweigen zu akzeptieren, denn bei diesem Gegenstande gibt es, so wahr Gott lebt, nur zu viele Gründe des Bedenkens und Verschweigens, die nichts mit dem allerhöchsten Vertrauen zu tun haben, das uns Ihre Exzellenz und der Orden, den Sie so würdevoll und fromm vertreten, abverdienen«, sagte Fermín in rasendem Tempo.Pater Fernando schaute ihn an, beinahe erstarrt. Ich beschloß, den Gesprächsfaden wiederaufzunehmen, bevor Fermín zu Atem käme.
Читать дальше