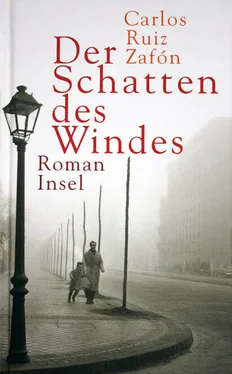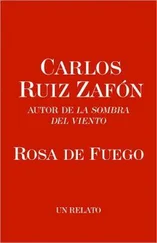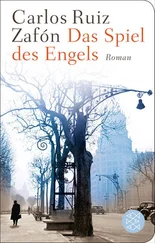»Die habe ich gemacht«, erklärte er stolz.Ich war unfähig, zu begreifen, was sie waren oder darstellten, aber ich schwieg und nickte staunend. Ich hatte das Gefühl, dieser hoch aufgeschossene Einzelgänger hatte sich seine eigenen Freunde aus Blech gebaut und ich war der erste, dem er sie zeigte. Es war sein Geheimnis. Ich erzählte ihm von meiner Mutter und wie sehr ich sie vermißte. Als meine Stimme unhörbar wurde, umarmte er mich schweigend. Wir waren zehn Jahre alt. Von diesem Tag an wurde er mein bester und ich sein einziger Freund.Trotz seines kriegerischen Äußeren war er ein friedfertiger Mensch, dem sein Aussehen jegliche Konfrontation ersparte. Er stotterte ziemlich stark, vor allem wenn er mit Leuten sprach, die nicht seine Mutter, seine Schwester oder ich waren, was er fast nie tat. Er war fasziniert von verrückten Erfindungen und mechanischen Vorrichtungen, und bald entdeckte ich, daß er Gerätschaften aller Art, vom Grammophonapparat bis zur Addiermaschine, in ihre Einzelteile zerlegte, um ihre Geheimnisse zu ergründen. Wenn er nicht mit mir zusammen war oder für seinen Vater arbeitete, verbrachte er die meiste Zeit in seinem Zimmer beim Basteln. Was er an Intelligenz zuviel hatte, fehlte ihm an Sinn fürs Praktische. Sein Interesse an der realen Welt konzentrierte sich auf Aspekte wie die Synchronisierung der Ampeln auf der Gran Vía, die Geheimnisse des illuminierten Brunnens am Fuß des Montjuïc oder die Automaten im Vergnügungspark auf dem Tibidabo.Jeden Nachmittag arbeitete er im Büro seines Vaters, und manchmal kam er nach Feierabend in der Buchhandlung vorbei. Mein Vater erkundigte sich immer nach seinen Erfindungen und schenkte ihm Handbücher der Mechanik oder Biographien von Ingenieuren wie Eiffel und Edison, die Tomás vergötterte. Mit den Jahren hatte er große Zuneigung zu meinem Vater gefaßt und erfand für ihn aus Teilen eines alten Ventilators ein automatisches System zur Archivierung bibliographischer Karteikarten. Seit vier Jahren arbeitete er an dem Projekt, aber mein Vater zeigte noch immer Begeisterung für dessen Fortschritte, damit Tomás den Mut nicht verlöre. Anfänglich hatte ich mich nicht ohne Sorge gefragt, wie Fermín auf meinen Freund reagieren würde.
»Sie sind bestimmt Daniels Erfinderfreund. Hoch erfreut, Sie kennenzulernen. Fermín Romero de Torres, bibliographischer Berater der Buchhandlung Sempere, zu dienen.«
»Tomás Aguilar«, stotterte mein Freund lächelnd und drückte Fermíns Hand.
»Vorsicht, was Sie da haben, ist keine Hand, sondern eine hydraulische Presse, und für meine Arbeit im Unternehmen muß ich mir meine Violinistenfinger bewahren.« Unter Entschuldigungen gab ihn Tomás frei.
»Ach, übrigens, was halten Sie vom Fermatschen Prinzip?« fragte Fermín und rieb sich die Finger.Sogleich verwickelten sie sich in eine unverständliche Diskussion über höhere Mathematik, die mir wie Chinesisch vorkam. Fermín siezte ihn immer oder nannte ihn Doktor und überhörte geflissentlich sein Stottern. Um sich für Fermíns unendliche Geduld mit ihm erkenntlich zu zeigen, brachte ihm Tomás schachtelweise Schweizer Schokoladenplätzchen, deren Verpackung mit Fotos von unglaublich blauen Seen, Kühen auf technicolorgrünen Wiesen und Kuckucksuhren geschmückt war.
»Ihr Freund Tomás hat Talent, aber es fehlt ihm eine Richtung im Leben und ein wenig Chuzpe, damit macht man Karriere«, meinte Fermín Romero de Torres.
»Der wissenschaftliche Geist hat das so an sich. Schauen Sie doch bloß Albert Einstein. So viele Wunderdinge hat er erkannt, und das erste, für das man eine praktische Verwendung hat, ist die Atombombe, und auch noch ohne seine Einwilligung. Und mit dieser Boxervisage, die Tomás hat, wird man es ihm in akademischen Kreisen sehr schwer machen — was in diesem Dasein den Ausschlag gibt, ist allein der Schein.« Da er Tomás vor Not und Unverständnis bewahren wollte, hatte Fermín beschlossen, man müsse seine latente Redekunst und Geselligkeit schulen.
»Als guter Affe ist der Mensch ein soziales Wesen, und als wesentliche Norm ethischen Verhaltens zeichnen ihn Vetternwirtschaft, Nepotismus, Schwindel und Klatsch aus«, argumentierte er.
»Reine Biologie.«
»So schlimm wird es ja wohl nicht sein.«
»Was für ein Simpel Sie manchmal sein können, Daniel.« Das Aussehen eines harten Kerls hatte Tomás von seinem Vater geerbt, einem erfolgreichen Grundstücksverwalter, dessen Büro in der Calle Pelayo neben dem Warenhaus El Siglo lag. Señor Aguilar gehörte der privilegierten Menschengruppe an, die immer recht hat. Ein Mann von tiefen Überzeugungen, war er sich unter anderem sicher, daß sein Sohn eine verzagte Seele und ein Geistesschwacher war. Um solch schmähliche Behinderungen auszugleichen, nahm er die verschiedensten Privatlehrer in Dienst, die seinen Erstgeborenen auf Gleichmaß bringen sollten.
»Sie haben meinen Sohn zu behandeln, als wäre er ein Dummkopf, ist das klar?« hatte ich ihn oft sagen hören. Die Lehrer versuchten es auf alle erdenklichen Weisen, selbst mit inständigem Bitten, doch Tomás pflegte ausschließlich Lateinisch mit ihnen zu sprechen, eine Sprache, die er so fließend wie der Papst und ohne zu stottern beherrschte. Über kurz oder lang legten die Hauslehrer ihr Amt nieder, aus Verzweiflung und weil sie fürchteten, der Junge sei besessen und behexe sie auf aramäisch mit Teufelsparolen. Señor Aguilars einzige Hoffnung war der Militärdienst, der aus seinem Sohn einen rechtschaffenen Menschen machen sollte.Tomás hatte eine Schwester, die um ein Jahr älter war als wir, Beatriz. Ihr hatte ich unsere Freundschaft zu verdanken, denn hätte ich an jenem weit zurückliegenden Nachmittag nicht gesehen, wie sie an der Hand ihres Vaters auf den Schulschluß wartete, so hätte ich mich nicht über sie lustig gemacht, mein Freund hätte mir nie eine Abreibung verpaßt, und er hätte niemals den Mut gehabt, mich anzusprechen. Bea Aguilar war das lebendige Abbild ihrer Mutter und der Augapfel ihres Vaters. Rothaarig und totenblaß, steckte sie immer in sündhaft teuren Seiden- oder luftigen Wollkleidern. Sie hatte die Figur eines Mannequins und schritt kerzengerade einher, selbstgefällig und wie die Prinzessin ihres eigenen Märchens. Ihre Augen waren grünblau, aber sie betonte immer wieder, sie seien smaragd- und saphirfarben. Obwohl — oder vielleicht gerade weil — sie Jahre bei den Theresianerinnen verbracht hatte, trank sie hinter dem Rücken ihres Vaters Anis im hohen Stielglas, trug Seidenstrümpfe der Marke La Perla Gris und schminkte sich wie die Filmvamps, die meinen Freund Fermín um den Schlaf brachten. Ich konnte sie nicht ausstehen, und sie erwiderte meine offene Feindseligkeit mit verächtlichen Blicken. Sie hatte einen Freund, der als Leutnant in Murcia Militärdienst leistete, einen herausgeputzten Falangisten namens Pablo Cascos Buendía, Sproß einer uralten Familie, die an den galicischen Rias zahllose Werften besaß. Leutnant Cascos Buendía, welcher dank eines in der Militärregierung sitzenden Onkels sein halbes Leben in Urlaub war, gab immer Sermone über die genetische und geistige Überlegenheit der spanischen Rasse und den unmittelbar bevorstehenden Verfall des bolschewistischen Reichs von sich.
»Marx ist tot«, sagte er feierlich.
»Genau seit dem Jahr 1883«, sagte ich.
»Halt bloß das Maul, du elender Wicht, sonst kriegst du eine geschmiert, daß du in der Rioja landest.« Mehr als einmal hatte ich Bea dabei ertappt, wie sie bei sich die Einfältigkeiten belächelte, die ihr Leutnantfreund zum besten gab. Dann blickte sie auf und betrachtete mich undurchdringlich. Ich lächelte ihr mit der matten Herzlichkeit von Feinden in unbestimmter Waffenruhe zu, schaute aber gleich wieder weg. Eher wäre ich gestorben, als es zuzugeben, aber im Grunde meines Wesens hatte ich Angst vor ihr.
Zu Beginn dieses Jahres beschlossen Tomás und Fermín Romero de Torres, ihre jeweilige Erfindungsgabe in einem neuen Projekt zu verschmelzen, das meinen Freund und mich ihrer Meinung nach vom Militärdienst befreien sollte. Besonders Fermín teilte Señor Aguilars Begeisterung für die Felderfahrung gar nicht.
Читать дальше