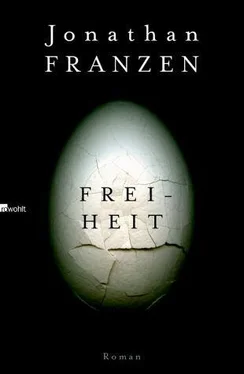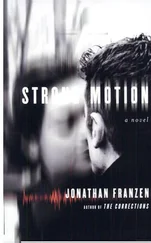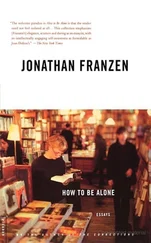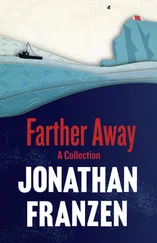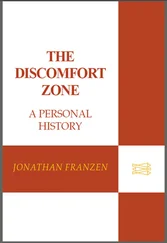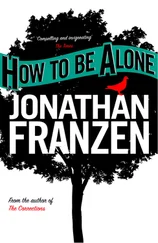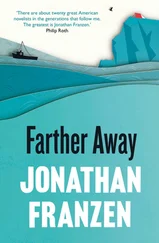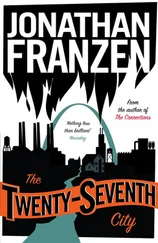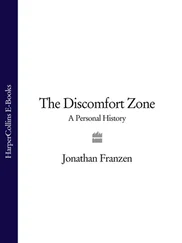«Bei Cantor Fitzgerald gab es viele wie ihn», sagte Joey. «Sehr taffe Trader. Und die sind nicht rausgekommen.»
«Dann waren sie eben nicht wie Nick», sagte sie.
Als Joey sah, wie sie sich innerlich verschloss, überlegte er, wie sehr er sich wohl stählen und wie viel Geld er verdienen müsste, um bei ihresgleichen überhaupt ins Rennen gehen zu können. Sein Schwanz in seinen Shorts regte sich wieder, als wollte er sich der Herausforderung gewachsen zeigen. Seine weicheren Teile jedoch, sein Herz und sein Gehirn, versanken angesichts der ungeheuren Größe dieser Aufgabe in Hoffnungslosigkeit.
«Vielleicht gehe ich heute mal zur Wall Street und sehe mir das an», sagte er.
«Samstags ist alles zu.»
«Ich will nur mal peilen, wie es da aussieht, vielleicht arbeite ich da ja mal.»
«Nichts für ungut?», sagte Jenna und schlug ihr Buch wieder auf. «Dafür wirkst du viel zu nett.»
Vier Wochen später war Joey wieder in Manhattan und hütete bei seiner Tante Abigail ein. Den ganzen Herbst über hatte er sich den Kopf zerbrochen, wo er die Weihnachtsferien verbringen sollte, da seine beiden konkurrierenden Zuhauses in St. Paul einander ausschlossen und drei Wochen viel zu lang waren, um sich bei der Familie eines neuen Collegefreundes einzuquartieren. Er hatte den vagen Plan gehabt, sich bei einem seiner besseren Highschool-Freunde aufzuhalten, was ihm ermöglicht hätte, seinen Eltern und den Monaghans getrennte Besuche abzustatten; dann aber stellte sich heraus, dass Abigail über die Feiertage nach Avignon fahren wollte, um an einem internationalen Pantomime-Workshop teilzunehmen, und sich an dem Thanksgiving-Wochenende, an dem sie sich getroffen hatten, ihrerseits Gedanken machte, wer währenddessen wohl in ihrer Wohnung in der Charles Street sein und die komplexen Nahrungsbedürfnisse ihrer Katzen Tigger und Piglet befriedigen würde.
Das Treffen mit seiner Tante war aufschlussreich, wenn auch einseitig gewesen. Abigail war zwar jünger als seine Mutter, sah aber in jeder Hinsicht älter aus, nur nicht in der der Kleidung, die ihm teenagerhaft nuttig vorkam. Sie roch nach Zigaretten, und sie hatte eine herzzerreißende Art, ihr Stück Schokoladenmousse-Kuchen zu essen, indem sie ihn vorab Bissen für Bissen zerteilte, um ihn desto intensiver zu genießen, als wäre er das Beste, was ihr an jenem Tag widerfahren sollte. Die wenigen Fragen, die sie Joey stellte, beantwortete sie sich selbst, bevor er auch nur piep sagen konnte. Größtenteils hielt sie einen Monolog samt ironischen Kommentaren und relativierenden Einwürfen, der etwas von einem Zug hatte, auf den er aufspringen durfte, um eine Weile mitzufahren, wobei er sich den Kontext selbst liefern und bei vielen Bezügen raten musste. Mit ihrem Gequassel wirkte sie auf ihn wie eine traurige Comic-Version seiner Mutter, eine Mahnung, wie sie werden könnte, wenn sie nicht aufpasste.
Anscheinend war für Abigail allein schon Joeys Existenz ein Vorwurf, der eine ausgedehnte Schilderung ihres Lebens erforderte. Die traditionelle Heirat-Kinder-Eigenheim-Geschichte war nicht ihr Ding, sagte sie, ebenso wenig die seichte Kommerzwelt des konventionellen Theaters mit seinen demütigend abgekarteten Vorsprechterminen und seinen Casting-Chefs, die immer nur das neueste Sternchen wollten und nicht das Geringste über Originalität des Ausdrucks wussten, ebenso wenig die Welt der Stand-up-Comedy, in der Fuß zu fassen sie sich, ausgerüstet mit tollem Material über die Wahrheit einer amerikanischen Vorstadtkindheit, sehrrrrr lange bemüht hatte, bis sie irgendwann einsah, dass einzig und allein Testosteron und Toilettenwitze zählten. Sie zog erschöpfend über die Komödiantinnen Tina Frey und Sarah Silverman her und pries dann das Genie diverser «Künstler», die, wie Joey mutmaßte, Pantomimen oder Clowns sein mussten und mit denen in zunehmendem Kontakt zu stehen sie sich glücklich schätzte, wenngleich der Kontakt nach wie vor hauptsächlich via Workshops bestand. Während sie so dahinredete, merkte er, dass er ihre Entschlossenheit bewunderte, sich ohne jedweden Erfolg der Art, wie er für ihn durchaus noch erreichbar war, über Wasser zu halten. Sie war so schrullig und selbstbezogen, dass ihm der Verdruss von Schuldgefühlen erspart blieb und er direkt zum Mitleid übergehen konnte. Er merkte, dass er seiner Tante als Repräsentant nicht nur seines Glücks, sondern auch des Glücks ihrer Schwester keine größere Freundlichkeit erweisen konnte, als ihr zu erlauben, sich vor ihm zu rechtfertigen, und ihr zu versprechen, sich gleich bei nächster Gelegenheit einen Auftritt von ihr anzusehen. Dafür belohnte sie ihn mit dem Angebot, bei ihr einzuhüten.
Seine ersten Tage in der Stadt, in denen er mit seinem Wohnheimgenossen Casey die Läden abklapperte, waren wie hyperlebendige Fortsetzungen der Urbanen Träume, die er jede Nacht hatte. Die Menschheit strömte von allen Seiten auf ihn ein. Auf dem Union Square pfiffen und trommelten Musiker aus den Anden. Feuerwehrleute nickten feierlich der Menge zu, die sich um einen 11.-September-Schrein vor einer Feuerwache scharte. Vor Bloomingdale's bemächtigten sich zwei in Pelz gehüllte Damen tollkühn eines Taxis, das Casey herangewinkt hatte. Tres scharfe Realschulmädchen mit Jeans unter dem Minirock lümmelten mit breit gespreizten Beinen in der U-Bahn. In düstere Jumbo-Parkas gekleidete Ghetto-Kids mit Cornrows, Nationalgardisten, die vor der Grand Central mit Hightech-Waffen patrouillierten. Und dann noch die chinesische Großmutter, die DVDs von Filmen verhökerte, die noch gar nicht angelaufen waren, der Breakdancer, der sich einen Muskel oder eine Sehne gerissen hatte und sich auf dem Boden einer Bahn der Linie 6 unter Schmerzen wiegte, der hartnäckige Saxophonspieler, dem Joey, trotz Caseys Warnung, er werde übers Ohr gehauen, fünf Dollar gab, damit er zu seinem Gig fahren konnte: Jede Begegnung war wie ein Gedicht, das er sich auf der Stelle einprägte.
Caseys Eltern wohnten in einem Apartment mit direktem Zugang zum Lift, ein Muss, wie Joey fand, sollte er in New York je den großen Wurf schaffen. An Heiligabend und am Ersten Weihnachtsfeiertag ging er zu ihnen zum Abendessen, womit er die Lügen über seinen Aufenthaltsort während der Ferien stützte, die er seinen Eltern aufgetischt hatte. Am nächsten Morgen machten sich Casey und seine Familie jedoch zu einer Skireise auf, und Joey wusste, dass er ihre Gastfreundschaft ohnehin nicht noch länger in Anspruch nehmen konnte. Als er in Abigails muffige, vollgerümpelte Wohnung zurückkehrte und sah, dass sich Piglet und/oder Tigger in strafendem Katzenprotest gegen seine lange Abwesenheit an mehreren Stellen erbrochen hatten, wurde er der merkwürdigen Idiotie seines Plans gewahr, dort zwei ganze Wochen allein zu verbringen.
Sogleich machte er alles noch schlimmer, indem er mit seiner Mutter sprach und einräumte, dass einige seiner Pläne «geplatzt» seien und er «stattdessen» bei ihrer Schwester einhüte.
«In Abigails Wohnung?», sagte sie. «Allein? Ohne dass sie überhaupt mit mir gesprochen hat? In New York? Allein?»
«Klar», sagte Joey.
«Entschuldige», sagte sie, «aber du musst ihr sagen, dass das nicht in Ordnung ist. Sag ihr, sie soll mich auf der Stelle anrufen. Heute Abend noch. Auf der Stelle. Sofort. Unbedingt.»
«Dafür ist es viel zu spät. Sie ist längst in Frankreich. Aber das geht schon. Die Gegend ist wirklich sicher.»
Doch seine Mutter hörte nicht zu. Sie hatte mit seinem Vater einen Wortwechsel, der für Joey nicht zu verstehen war, aber etwas hysterisch klang. Und dann meldete sich sein Dad.
«Joey? Hör mal zu. Bist du da?»
«Wo soll ich denn sonst sein?»
«Hör mal zu. Wenn du nicht über den Anstand verfügst, ein paar Tage bei deiner Mutter in einem Haus zu verbringen, das ihr so viel bedeutet und in das du nie wieder einen Fuß setzen wirst, dann ist mir das gleich. Es war deine schreckliche Entscheidung, die du bei Gelegenheit bereuen kannst. Und das Zeug, das du in deinem Zimmer gelassen hast, obwohl wir gehofft hatten, dass du herkommen und es wegschaffen würdest — das geben wir dann eben zur Wohlfahrt oder lassen es von der Müllabfuhr abholen. Das ist dann dein Verlust, nicht unserer. Aber allein in einer Stadt zu sein, in der allein zu sein du zu jung bist, in einer Stadt, die wiederholt von Terroristen angegriffen wurde, und zwar nicht nur für eine Nacht oder zwei, sondern für Wochen, das zieht geradezu zwangsläufig nach sich, dass deine Mutter sich die gesamte Zeit über Sorgen macht.»
Читать дальше