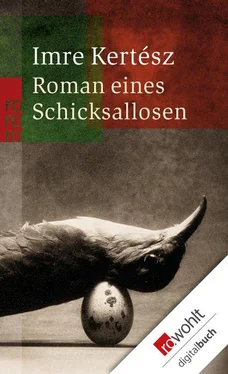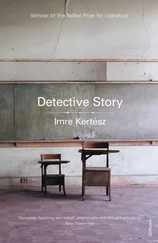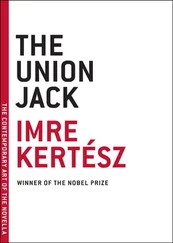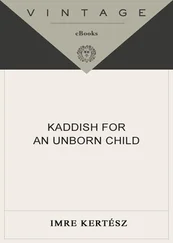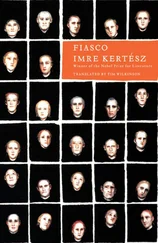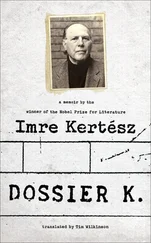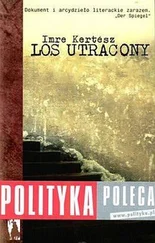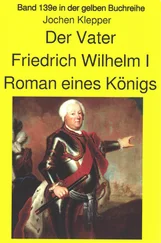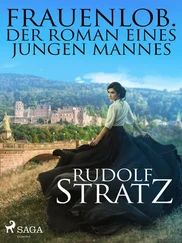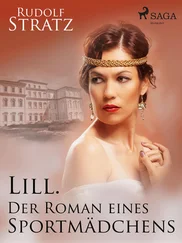Nach ein paar Schritten erkannte ich unser Haus. Es stand noch, unversehrt, völlig in Ordnung. Der vertraute Geruch des Tordurchgangs, der in seinem vergitterten Schacht ruhende wacklige Aufzug und die gelblich gewordenen, ausgetretenen Stufen bereiteten mir den Empfang, und weiter oben konnte ich auch den an einen bestimmten traulichen Augenblick erinnernden Treppenabsatz begrüßen. Auf unserem Stockwerk klingelte ich dann an unserer Tür. Sie öffnete sich auch bald, aber nur so weit, wie der innere Verschluss, irgend so ein Haken oder eine Sperrkette, es zuließ, und ich war etwas überrascht, da ich mich von früher nicht an eine solche Vorrichtung erinnerte. Aus dem Türspalt schaute mich das gelbe, knochige Gesicht einer fremden Frau etwa mittleren Alters an. Sie fragte, wen ich suche, und ich sagte zu ihr, ich wohnte hier. «Nein», sagte sie, «hier wohnen wir» und wollte die Tür schon wieder schließen, was ihr aber nicht gelang, da ich den Fuß dazwischengestellt hatte. Ich versuchte ihr zu erklären, das sei ein Irrtum, denn von hier sei ich weggegangen, und es sei ganz sicher, dass wir hier wohnten, sie hingegen versicherte mir, ich täuschte mich, weil ohne jeden Zweifel sie hier wohnten, und gleichzeitig schüttelte sie freundlich, höflich, aber bedauernd den Kopf und versuchte, die Tür zu schließen, während ich versuchte, sie aufzuhalten. In einem Augenblick, als ich zu der Nummer hochsah, ob ich mich nicht vielleicht doch in der Tür geirrt hätte, gab offenbar wohl mein Fuß nach, denn da hat sich ihr Bemühen als erfolgreich erwiesen, und ich hörte noch, wie sie in dem zufallenden Schloss den Schlüssel gleich zweimal umdrehte.
Auf dem Weg zum Treppenhaus zurück stockte ich vor einer vertrauten Tür. Ich klingelte, und bald erschien eine dicke, stattliche Frau. Schon wollte sie – auf bereits bekannte Art – die Tür wieder zumachen; da blitzte hinter ihr eine Brille auf, und aus dem Halbdunkel schälte sich das graue Gesicht von Herrn Fleischmann heraus. Neben ihm tauchten ein umfangreicher Bauch, Pantoffeln, ein großer roter Kopf, ein kindlicher Scheitel und der ausgebrannte Stummel einer Zigarre auf: der alte Steiner, beide, wie ich sie zurückgelassen hatte, so als wäre es gestern gewesen, am Vorabend des Zollhaus-Tages. Sie standen da, schauten mich an, riefen meinen Namen, und der alte Steiner umarmte mich, so, wie ich war, samt Mütze, verschwitzt, in meiner gestreiften Jacke. Sie holten mich herein, ins Zimmer, und Frau Fleischmann ist in die Küche geeilt, um zu schauen, ob «ein Häppchen zu essen» da sei, wie sie sich ausdrückte. Ich musste die üblichen Fragen beantworten: woher, wie, wann, auf welche Weise, dann fragte ich und erfuhr, dass in unserer Wohnung tatsächlich inzwischen andere Leute wohnten. Ich wollte wissen: «Und wir?», und weil sie sich irgendwie schwertaten, fragte ich: «Mein Vater?», worauf sie dann endgültig verstummt sind. Nach kurzer Zeit hob sich langsam eine Hand – ich glaube, die von Herrn Steiner – in die Höhe, machte sich auf den Weg und ließ sich dann, wie eine vorsichtige alte Fledermaus, auf meinem Arm nieder. Dem, was sie dann sagten, konnte ich im Wesentlichen so viel entnehmen, dass «wir an der Echtheit der Trauerbotschaft leider nicht zweifeln können», weil sie auf dem «Zeugnis ehemaliger Kameraden» beruhe, demgemäß mein Vater «nach kurzem Leiden verschieden» sei, in einem «deutschen Lager», das sich aber eigentlich auf österreichischem Gebiet befinde, na … wie heißt es doch gleich …, und ich sagte: «Mauthausen.» – «Mauthausen!» riefen sie erfreut, worauf sie sich wieder verdüsterten: «Ja, genau.» Ich fragte sie dann, ob sie nicht vielleicht Nachricht von meiner Mutter hätten, und sie sagten gleich: Aber ja, doch, und zwar eine erfreuliche, sie lebt, ist gesund, vor ein paar Monaten war sie hier im Haus, sie selbst hatten sie gesehen und mit ihr gesprochen, sie hatte nach mir gefragt. Und meine Stiefmutter?, wollte ich auch noch wissen und erfuhr: «Na ja, sie hat inzwischen wieder geheiratet.» – «Ach», forschte ich weiter, «wen denn?», und da sind sie wieder über den Namen gestolpert. Der eine hat gesagt: «Irgendeinen Kovács, wenn ich mich nicht irre», der andere: «Nein, nicht Kovács, eher Futó.» Ich habe gesagt: «Sütő», und auch jetzt nickten sie erfreut und waren nun ganz sicher: «Richtig, Sütő, natürlich» – genauso wie gerade zuvor. Sie verdanke ihm viel, «eigentlich alles», sagten sie dann: Er habe «das Vermögen hinübergerettet», er habe «sie in den schweren Zeiten versteckt» – so haben sie es formuliert. «Vielleicht», sann Herr Fleischmann noch ein wenig nach, «hat sie es ein bisschen eilig gehabt», und dem stimmte auch der alte Steiner zu. «Aber letzten Endes», meinte er noch, «ist das verständlich», was dann wieder der andere Alte zugab.
Dann saß ich noch ein Weilchen bei ihnen herum, weil ich schon lange nicht mehr so gesessen hatte, in einem bordeauxrot bezogenen, weichen Samtfauteuil. Auch Frau Fleischmann war inzwischen zurückgekommen und hatte auf einem weißen Porzellanteller mit Zierrand Schmalzbrote gebracht, mit Streupaprika und dünnen Zwiebelringen verziert, denn sie erinnerte sich, dass ich das früher sehr gern gemocht hatte, was ich auch sogleich bezüglich der Gegenwart bekräftigte. Unterdessen erzählten die beiden Alten, «ja, auch hier zu Hause» sei es «nicht leicht» gewesen. Ihr Bericht gab mir den Eindruck eines wirren, verwickelten und nicht nachvollziehbaren Geschehens von nebelhaften Umrissen, die eigentlich nichts so recht erkennen und verstehen ließen. Es war mehr die häufige, fast schon ermüdende Wiederholung eines Wortes, was mir an ihrer Litanei auffiel, ein Wort, mit dem sie jede neue Wende, jede Veränderung, jede Bewegung bezeichneten: So «kamen» zum Beispiel die Judensternhäuser, «kam» der fünfzehnte Oktober, «kamen» die Pfeilkreuzler, «kam» das Ghetto, «kam» die Sache am Donau-Ufer, «kam» die Befreiung. Nun und dann war da der übliche Fehler: Als hätte dieses ganze verwischte, in Wirklichkeit unvorstellbar erscheinende und auch in den Einzelheiten – so wie ich sah – für sie nicht mehr vollständig nachvollziehbare Geschehen nicht in der gewohnten Abfolge von Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten stattgefunden, sondern gewissermaßen auf einmal, irgendwie in einem einzigen Wirbel, Taumel, etwa auf so einer merkwürdigen, unerwartet in eine Ausschweifung ausartenden Nachmittagsgesellschaft, wo die Teilnehmer – weiß Gott, warum – plötzlich alle aus dem Häuschen geraten und zuletzt überhaupt nicht mehr wissen, was sie tun. Irgendwann sind sie dann verstummt, und nach einer kurzen Stille hat der alte Fleischmann auf einmal die Frage an mich gerichtet: «Und was für Pläne hast du für die Zukunft?» Ich war etwas überrascht und habe gesagt, daran hätte ich noch nicht so recht gedacht. Da regte sich auch der andere Alte und beugte sich auf seinem Stuhl zu mir. Auch die Fledermaus erhob sich wieder und ließ sich diesmal auf meinem Knie nieder statt auf meinem Arm. «Vor allem», sagte er, «musst du die Gräuel vergessen.» Ich war noch mehr überrascht und habe gefragt: «Wieso?» – «Damit du», antwortete er, «leben kannst», und Herr Fleischmann nickte und fügte hinzu: «Frei leben», worauf der andere Alte nickte und hinzufügte: «Mit einer solchen Last kann man kein neues Leben beginnen», und da hatte er bis zu einem gewissen Grad recht, das musste ich zugeben. Nur verstand ich nicht ganz, wie sie etwas verlangen konnten, was unmöglich ist, und ich habe dann auch bemerkt, was geschehen sei, sei geschehen, und ich könne ja meinem Erinnerungsvermögen nichts befehlen. Ein neues Leben – meinte ich – könnte ich nur beginnen, wenn ich neu geboren würde oder wenn irgendein Leiden, eine Krankheit oder so etwas meinen Geist befiele, was sie mir ja hoffentlich nicht wünschten. «Und überhaupt», fügte ich hinzu, «habe ich von Gräueln nichts bemerkt», und da sah ich, dass sie ziemlich verblüfft waren. Was das heißen solle, wollten sie wissen, ich hätte «nichts bemerkt»? Da habe ich sie nun aber gefragt, was sie denn wohl in diesen «schweren Zeiten» gemacht hätten. «Na ja … wir haben gelebt», sagte der eine nachdenklich. «Wir haben zu überleben versucht», fügte der andere hinzu. Also hatten auch sie einen Schritt nach dem anderen gemacht – wie ich bemerkte. Was für Schritte, wollten sie wissen, und da habe ich auch ihnen erzählt, wie das zum Beispiel in Auschwitz zugegangen war. Pro Eisenbahnzug – ich will nicht behaupten, dass es unbedingt jedes Mal so war, denn das kann ich nicht wissen –, zumindest in unserem Fall aber ist mit ungefähr dreitausend Personen zu rechnen. Nehmen wir davon etwa tausend Männer an. Rechnen wir für die Untersuchung ein, zwei Sekunden, eher eine als zwei. Den ersten und den letzten lassen wir weg, die zählen ja nie. In der Mitte jedoch, wo auch ich stand, muss man also mit einer Wartezeit von zehn bis zwanzig Minuten rechnen, bis man zu dem Punkt gelangt, wo sich entscheidet: gleich das Gas oder noch einmal davongekommen. In der Zwischenzeit aber bewegt sich die Reihe ständig fort, geht immer weiter voran, und ein jeder macht immer einen Schritt, einen kleineren oder einen größeren, je nach Betriebsgeschwindigkeit.
Читать дальше