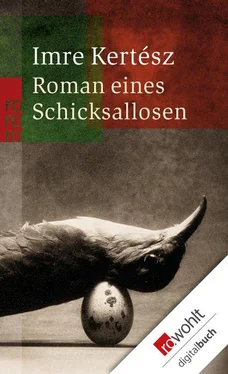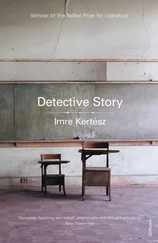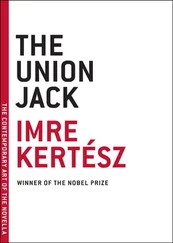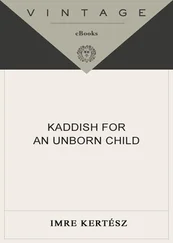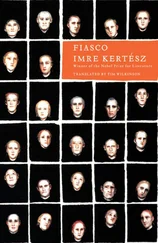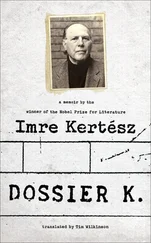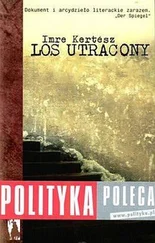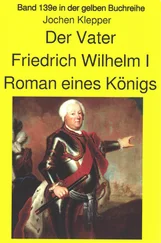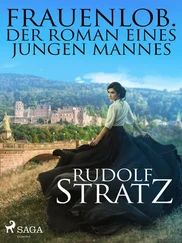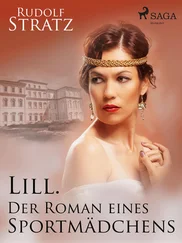Imre Kertész - Roman eines Schicksallosen
Здесь есть возможность читать онлайн «Imre Kertész - Roman eines Schicksallosen» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Город: Reinbek bei Hamburg, Год выпуска: 2010, ISBN: 2010, Издательство: Rowohlt, Жанр: Современная проза, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Roman eines Schicksallosen
- Автор:
- Издательство:Rowohlt
- Жанр:
- Год:2010
- Город:Reinbek bei Hamburg
- ISBN:9783644106215
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Roman eines Schicksallosen: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Roman eines Schicksallosen»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Roman eines Schicksallosen — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Roman eines Schicksallosen», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Und schließlich war da auch noch das Beispiel meines Helfers. Ich hatte ihn im Waschraum getroffen – denn, nun ja, allmählich konnte ich mir gar nicht mehr vorstellen, dass ich mich woanders waschen könnte als an dem auf- und zudrehbaren Wasserhahn in dem sich am Ende des Flurs zur Linken öffnenden Waschraum, das aber auch hier nicht wegen der Vorschrift, sondern einfach wegen der Schicklichkeit, wie mir allmählich klar wurde; ja, mit der Zeit merkte ich sogar, wie ich es beinahe schon übelnahm, dass der Ort ungeheizt, das Wasser kalt war und ein Handtuch fehlte. Dort befand sich auch die rote, tragbare, einem offenen Schrank ähnelnde Örtlichkeit, deren stets sauberer Behälter weiß Gott von wem gepflegt, ausgetauscht, gereinigt wurde. Bei einer solchen Gelegenheit, als ich gerade beim Gehen war, betrat ein Mann den Raum. Ein schöner Mann, mit zurückgekämmtem, trotzdem ungebärdig in die Stirn fallendem, glattem schwarzem Haar und dem da und dort etwas grünlich schattierten Gesicht schwarzhaariger Menschen; in Anbetracht seines schon vollen Mannesalters, seines gepflegten Äußeren und des schneeweißen Mantels hätte ich ihn für einen Arzt gehalten, wenn die Aufschrift auf seiner Armbinde mich nicht darüber belehrt hätte, dass er nur Pfleger war, während das T in seinem roten Dreieck ihn als Tschechen auswies. Er stutzte und schien von meinem Anblick etwas überrascht, ja sogar ein bisschen betroffen, nach der Art, wie er mein Gesicht, meinen aus dem Hemd herausragenden Hals, mein Brustbein und meine Beine betrachtete. Er fragte auch gleich etwas, und ich antwortete, wie ich es aus den polnischen Gesprächen aufgeschnappt hatte: «Nje rosumjem.» Daraufhin erkundigte er sich auf Deutsch, wer ich sei, woher ich komme. Ich sagte «Ungar» , hier aus Saal sechs. Worauf er, zur Verdeutlichung auch noch seinen Zeigefinger benutzend, sagte: «Du: warten hier. Ik: wek . Ein Moment zurück. Verstehn?» Ich sagte: «Verstehen.» Er ging weg, kam zurück, und auf einmal hatte ich ein viertel Brot und eine kleine, hübsche Konservendose mit schon hochgebogenem Deckel in der Hand, eine Dose mit noch unberührtem, haschiertem rosarotem Fleisch. Ich blickte auf, um mich zu bedanken – doch da konnte ich nur noch sehen, wie die Tür hinter ihm zuging. Als ich dann wieder im Zimmer war und versuchte, Pjetka von dem Mann zu berichten, mit ein paar Worten auch sein Äußeres zu beschreiben, wusste er sofort, dass es der Pfleger vom Zimmer neben uns, von Saal sieben, sein musste. Er hat auch seinen Namen genannt. Ich verstand Ba-usch, obgleich er wohl eher Bohusch gesagt haben musste, wie ich mir dann überlegte. So habe ich es später auch von meinem Nachbarn gehört – denn zwischendurch lösten sich die Kranken in unserem Zimmer ab, alte gingen, neue kamen. Auch in das Bett über mir brachte Pjetka, nachdem er noch am ersten Nachmittag jemanden hinausgetragen hatte, bald einen neuen, mir im Alter und – wie ich später erfuhr – auch rassenmäßig entsprechenden, aber Polnisch sprechenden Jungen, dessen Namen ich als Ku-halski oder Ku-harski verstand, wenn Pjetka oder Zbischek ihn nannten, wobei sie ihn immer so aussprachen, dass das «harski» herausgehoben, betont wurde; hin und wieder scherzten sie mit ihm, und vielleicht neckten, ja, ärgerten sie ihn auch, denn er war oft wütend, wie zumindest sein schnelles Mundwerk deutlich machte, der gereizte Tonfall seiner schon voller werdenden Stimme und sein unablässiges Herumzappeln, bei dem dann durch die Querlatten immer ein Regen von Strohhalmen auf mein Gesicht herunterkam – das alles, wie ich sehen konnte, zum größten Vergnügen eines jeden Polen im Zimmer. Neben mich, in das Bett des ungarischen Kranken, kam auch jemand, auch wieder ein Junge, was für einer es war, konnte ich zunächst nicht so recht ausmachen. Er konnte sich zwar mit Pjetka gut verständigen, und doch schien sein Polnisch meinem allmählich schon geübten Ohr nicht ganz geheuer. Wenn ich ihn ungarisch anredete, antwortete er nicht, wobei er mir aber mit seinem wieder nachwachsenden roten Haar, seinem ziemlich vollen, recht ansehnlichen sommersprossigen Gesicht, den alles rasch erfassenden, sich sofort zurechtfindenden blauen Augen gleich irgendwie verdächtig vorkam. Während er sich niederließ, sich einrichtete, bemerkte ich an der Innenseite seines Handgelenks blaue Zeichen, die Auschwitzer Nummerierung, eine Zahl in den Millionen. Erst als eines Vormittags ganz plötzlich die Tür aufging und Bohusch hereinkam, um mir, wie er es ein-, zweimal in der Woche zu tun pflegte, die aus Brot und Fleischkonserve bestehende Gabe auf die Decke zu legen, wonach er, für einen Dank keine Zeit lassend und auch Pjetka nur kurz zunickend, schon wieder draußen war: Da erst hat sich herausgestellt, dass der Rothaarige doch Ungarisch konnte, und zwar mindestens ebenso gut wie ich, denn er hat sofort gefragt: «Wer war das?» Ich habe gesagt, soviel ich wisse, sei es der Pfleger aus dem Nebenzimmer, ein gewisser Ba-usch, und da hat er mich korrigiert: «Bohusch vielleicht», denn das sei, behauptete er, ein sehr verbreiteter Name in der Tschechoslowakei, woher übrigens auch er käme. Ich erkundigte mich, wieso er denn bisher kein Ungarisch verstanden habe, und er sagte, weil er die Ungarn überhaupt nicht möge. Ich musste zugeben, dass er da recht hatte und dass ich im Großen und Ganzen auch nicht viel Anlass fand, sie zu mögen. Daraufhin schlug er vor, wir sollten in der Sprache der Juden sprechen, doch da musste ich eben zugeben, dass ich sie nicht verstand, und so sind wir schließlich doch beim Ungarischen geblieben. Er nannte auch seinen Namen: Luis oder vielleicht Lojis, ich verstand es nicht ganz. Ich bemerkte dann: «Also Lajos», wogegen er sich aber sehr wehrte, denn das sei Ungarisch, er aber sei Tscheche und bestehe auf dem Unterschied: Lois. Ich fragte ihn, wieso er so viele Sprachen spreche, und da erzählte er, er stamme eigentlich aus dem Oberland, von wo sie vor den Ungarn, wie er sagte: «vor der ungarischen Besetzung», geflohen seien, die ganze Familie samt Verwandten und zahlreichen Bekannten, und tatsächlich, da kam mir wieder ein Tag in den Sinn, ein ferner, ferner Tag, noch zu Hause, als Fahnenschmuck, Musik und seit dem Morgen andauernde Feierlichkeiten der Freude kundgaben, dass das Oberland wieder ungarisch war. Ins Konzentrationslager war er aus einem Ort gekommen, der – wenn ich es recht verstand – «Teresin» heißt. Er bemerkte: «Du kennst es bestimmt als Theresienstadt.» Ich sagte nein, überhaupt nicht, weder so noch so, ich kenne es einfach nicht, worüber er sehr verwundert war, aber in einer Weise, wie ich mich etwa über die wundern würde, die noch nie etwas vom Zollhaus in Csepel gehört haben. Daraufhin hat er mich aufgeklärt: «Das ist das Ghetto von Prag.» Wie er behauptete, konnte er sich außer mit den Ungarn und den Tschechen, na, und dann den Juden und den Deutschen auch noch mit den Slowaken, den Polen, den Ukrainern, ja, wenn es sein muss, sogar auch noch mit den Russen unterhalten. Am Ende schlossen wir regelrecht Freundschaft, und da er neugierig darauf war, erzählte ich ihm, wie ich Bohusch kennengelernt hatte, und dann berichtete ich ihm auch noch von meinen ersten Erlebnissen, Eindrücken, von den Gedanken, die ich am ersten Tag bezüglich des Zimmers gehabt hatte, was er so interessant fand, dass er es auch Pjetka übersetzte, der mich ganz schön ausgelacht hat; ebenso übersetzte er ihm, wie ich wegen der Sache mit dem ungarischen Kranken erschrocken gewesen war, und gab mir Pjetkas Antwort weiter, nämlich dass der Tod des Kranken seit Tagen erwartet worden und aus reinem Zufall gerade da eingetreten war, und noch vieles andere mehr, und mir war nur ein wenig peinlich, dass er jeden seiner Sätze mit «ten matjar», also «dieser Ungar», begann, auf diese Art leitete er offensichtlich jeweils das ein, was er weitersagte – wobei dieser Sprachgebrauch Pjetkas Aufmerksamkeit zum Glück irgendwie entging, wie mir schien. Mir fiel dann auf, ohne dass ich mir dabei etwas dachte, ohne dass ich etwas daraus folgerte, wie auffällig oft und lange er draußen etwas zu erledigen hatte, und erst als er einmal mit Brot und Konservendose: Sachen, die offensichtlich von Bohusch stammten, ins Zimmer zurückkam, war ich einigermaßen überrascht – übrigens unvernünftigerweise, versteht sich, das musste ich zugeben. Wie er sagte, war auch er zufällig im Waschraum mit ihm zusammengetroffen, genauso wie ich. Und auch er sei von ihm angesprochen worden, genau wie ich, und auch der Rest habe sich ganz genauso abgespielt wie bei mir. Den Unterschied hatte es immerhin gegeben, dass er mit ihm sprechen konnte, und da habe sich herausgestellt, dass sie aus der gleichen Heimat stammten, worüber sich Bohusch sehr, sehr gefreut habe, was schließlich nur natürlich sei, so meinte er, und das sah auch ich ein, in der Tat. Das alles fand ich – wenn ich es mit Vernunft betrachtete – durchaus klar, verständlich und einsehbar, und ich hatte die gleiche Einstellung dazu, die offensichtlich auch er hatte, wie zumindest aus dem letzten kurzen Zusatz: «Sei mir nicht böse, dass ich dir deinen Mann weggenommen habe», hervorging; das heißt, dass nun also ihm zukäme, was bisher mir zugekommen war, und ich würde jetzt zuschauen dürfen, während er schmauste, so wie er vorher mir zugeschaut hatte. Umso mehr staunte ich, als kaum eine Minute später die Tür aufging und Bohusch hereingeeilt kam, und zwar geradewegs zu mir. Von da an galt sein Besuch immer uns beiden. Einmal brachte er zwei Portionen, einmal bloß eine – je nachdem, wozu es reichte, denke ich, wobei er in letzterem Fall nie vergaß, mit einer Handbewegung das brüderliche Teilen zu verfügen. Nach wie vor war er jedes Mal in Eile, nach wie vor vergeudete er keine Zeit mit Worten, seine Miene war nach wie vor stets geschäftig, manchmal besorgt, ja, hin und wieder wütend, fast schon erbost, so wie jemand, der nunmehr die Last einer doppelten Sorge hat, dem eine doppelte Verpflichtung auf den Schultern liegt, der aber nichts anderes tun kann, als das zu tragen, was ihm aufgebürdet ist – und ich dachte mir, der Grund dafür kann eigentlich nur sein, dass er selbst seine Freude daran findet, weil er das, wie es scheint, in einem gewissen Sinn nötig hat, es war seine Methode, um es so zu sagen; einen anderen Grund konnte ich, insbesondere in Anbetracht der Nachfrage nach einer so raren Ware und ihres entsprechenden Preises, in keiner Weise finden, wie immer ich es auch drehte, wendete, erwog. Das war der Augenblick, in dem ich, glaube ich, diese Menschen begriff, so im Großen und Ganzen zumindest. Denn wenn ich meine ganze Erfahrung zu Hilfe nahm, alle Zusammenhänge herstellte, ja, dann blieb kein Zweifel mehr, dann erkannte ich ihn, wenn er sich auch in einer anderen Form zeigte, letztlich war es ein und dasselbe Mittel: Eigensinn – freilich unbestreitbar eine recht ausgefeilte, die nach meinem bisherigen Wissen erfolgreichste, nun, und vor allem die für mich nützlichste Form von Eigensinn, ganz ohne Zweifel.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Roman eines Schicksallosen»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Roman eines Schicksallosen» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Roman eines Schicksallosen» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.