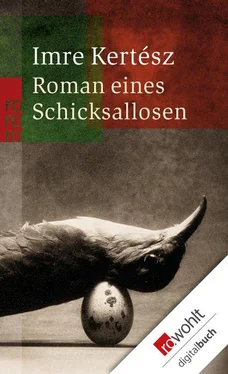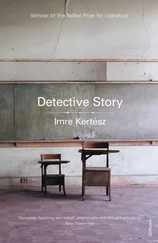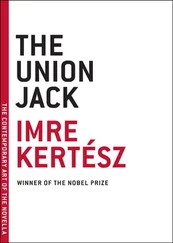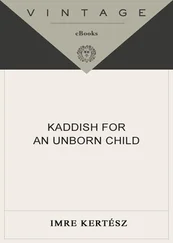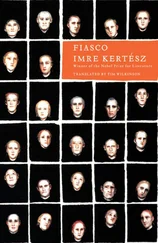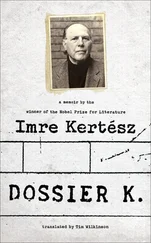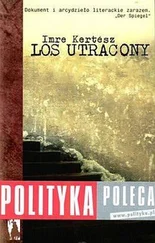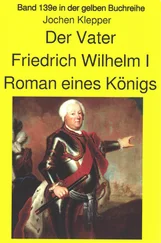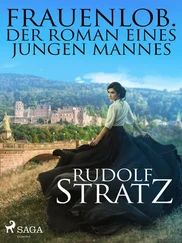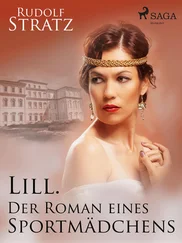Imre Kertész - Roman eines Schicksallosen
Здесь есть возможность читать онлайн «Imre Kertész - Roman eines Schicksallosen» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Город: Reinbek bei Hamburg, Год выпуска: 2010, ISBN: 2010, Издательство: Rowohlt, Жанр: Современная проза, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Roman eines Schicksallosen
- Автор:
- Издательство:Rowohlt
- Жанр:
- Год:2010
- Город:Reinbek bei Hamburg
- ISBN:9783644106215
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Roman eines Schicksallosen: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Roman eines Schicksallosen»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Roman eines Schicksallosen — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Roman eines Schicksallosen», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Auch der folgende Tag versprach aufregend zu werden – aber wer vermöchte schon jeden einzelnen Tag mit all seinen Ereignissen gegenwärtig zu halten. Auf jeden Fall kann ich berichten, die Küche funktionierte bis zuletzt ordnungsgemäß, und auch der Arzt war zumeist pünktlich. Eines Morgens dann, nicht lange nach dem Kaffee, eilige Schritte im Flur, ein schmetternder Ruf, so etwas wie eine Losung, worauf Pjetka schleunigst sein Paket aus seinem Versteck hervorholte, es sich unter den Arm klemmte und verschwand. Bald darauf, etwa gegen neun Uhr, hörte ich, wie sich der Kasten zum ersten Mal nicht an die Gefangenen, sondern an die Soldaten wandte: «An alle SS-Angehörigen» , und zwar gleich zweimal hintereinander: «Das Lager ist sofort zu verlassen!» Darauf hörte ich näher kommenden, sich entfernenden, eine Zeit lang mir gleichsam um die Ohren sausenden, dann allmählich abebbenden Gefechtslärm, worauf es still wurde – allzu still, denn umsonst wartete, lauschte, lauerte und horchte ich: Weder zur gewohnten Zeit noch danach gelang es mir, das – doch schon längst fällige – Geklapper, die dazugehörigen Rufe der Suppenträger auszumachen. Es war ungefähr gegen vier Uhr nachmittags, als der Kasten endlich knackte und uns nach einem kurzen Knistern und etlichen Blasgeräuschen mitteilte, hier sei der Lagerälteste, hier spreche der Lagerälteste. «Kameraden» , sagte er, hörbar mit einem Gefühl kämpfend, das ihn in der Kehle würgte, was seine Stimme einmal abbrechen, dann wieder zu scharf werden, beinahe schon in ein Pfeifen übergehen ließ, «wir sind frei!» , und ich dachte daran, dass also in diesem Punkt der Lagerälteste die gleiche Einstellung haben musste wie Pjetka, Bohusch, der Arzt und andere Gleichgesinnte, dass er anscheinend mit ihnen unter einer Decke steckte, um es so zu sagen, wenn er das Ereignis nun in dieser Weise und auch noch mit so offensichtlicher Freude verkünden konnte. Dann hat er eine kurze, hübsche Rede gehalten, und nach ihm kamen noch andere, redeten in verschiedensten Sprachen: «Attention, attention!» hörte ich zum Beispiel auf Französisch; «Posor, posor!», auf Tschechisch, glaube ich; «Njimanje, njimanje, ruski to warischtschi, njimanje!», und der melodische Tonfall beschwor für mich mit einemmal eine liebe Erinnerung herauf, denn es war die Sprache, die damals bei meiner Ankunft hier die Leute des Badekommandos gesprochen hatten; «Uwaga, uwaga!», worauf sich der polnische Kranke neben mir sogleich erregt in seinem Bett aufsetzte und uns alle anherrschte: «Tschicha bendsch! Teras polski kommunjiki!», und erst da fiel mir wieder ein, wie nervös er diesen ganzen Tag über gewesen war und wie er sich eins zusammengehaspelt und zusammengezappelt hatte; und dann, zu meiner größten Verblüffung, auf einmal: «Figyelem, figyelem! … Das ungarische Lagerkomitee …», und ich dachte: Nun, sieh an, das hätte ich auch nicht geglaubt, dass es so etwas gibt. Aber ich konnte noch so achtgeben, auch bei ihnen war, wie bei allen anderen vorher, nur von Freiheit die Rede und keine Andeutung, kein Wort von der noch ausstehenden Suppe. Auch ich war, natürlich, äußerst erfreut, dass wir frei waren, aber ich konnte halt nichts dafür, ich musste andererseits einfach denken: Gestern hätte so etwas zum Beispiel noch nicht vorkommen können. Draußen war der Aprilabend schon dunkel, auch Pjetka war wieder da, erhitzt, aufgewühlt, voll von unverständlichen Worten, als sich der Lagerälteste endlich über den Lautsprecher wieder meldete. Diesmal wandte er sich an die ehemaligen Mitglieder des Kartoffelschäler-Kommandos und bat sie, so freundlich zu sein und ihre alten Plätze in der Küche wieder einzunehmen, die anderen Bewohner des Lagers hingegen ersuchte er, wach zu bleiben, und wenn es sein müsse, bis Mitternacht, denn man sei im Begriff, sich an die Zubereitung einer kräftigen Gulaschsuppe zu machen: Da erst sank ich erleichtert auf mein Kissen zurück, da erst löste sich langsam etwas in mir, da erst dachte auch ich – wohl zum ersten Mal ernstlicher – an die Freiheit.
9
Nach Hause kehrte ich ungefähr zu der gleichen Zeit zurück, wie ich fortgegangen war. Auf jeden Fall war der Wald ringsum schon längst grün, auch über den Leichengruben war Gras gesprossen, und der Asphalt des seit Anbruch der neuen Zeiten so vernachlässigten Appellplatzes, der mit den Resten erloschener Feuerstellen, mit Lumpen, Papier und Konservendosen übersät war, begann in der hochsommerlichen Hitze zu schmelzen, als man in Buchenwald auch mich fragte, ob ich Lust hätte, die Reise anzutreten. Wir wären zumeist junge Leute, so hieß es, unter der Führung einer stämmigen Exzellenz vom ungarischen Lagerkomitee, eines schon grau werdenden Mannes mit Brille, der unterwegs die Dinge für uns erledigen wollte. Es gebe einen Lastwagen, nun, und auch die Bereitschaft seitens der amerikanischen Soldaten, uns ein Stück nach Osten mitzunehmen: Das Weitere sei unsere Sache, sagte der Mann und forderte uns auf, ihn «Onkel Miklós» zu nennen. Das Leben, fügte er hinzu, müsse weitergehen, und, ja, wirklich, etwas anderes konnte es nicht tun, das sah ich ein, nachdem die Dinge nun einmal so standen, dass es überhaupt etwas tun konnte, versteht sich. Im Großen und Ganzen durfte ich mich wieder als gesund betrachten, abgesehen von einigen Seltsamkeiten, kleineren Unannehmlichkeiten. Wenn ich mir zum Beispiel an irgendeiner Stelle meines Körpers den Finger ins Fleisch bohrte, blieb die Spur, die Einbuchtung noch lange da, so als hätte ich ihn in irgendein lebloses, unelastisches Material, sagen wir in Käse oder Wachs gebohrt. Auch mein Gesicht überraschte mich etwas, als ich es in einem der wohnlichen, mit einem Spiegel eingerichteten Zimmer des SS-Krankenhauses zum ersten Mal erblickte, denn von früher her hatte ich ein anderes Gesicht in Erinnerung. Dieses, das ich nun anschaute, hatte unter dem ein paar Zentimeter nachgewachsenen Haar eine auffällig niedrige Stirn, unter dem merkwürdig verbreiterten Ohransatz zwei ganz neue, unförmige Geschwülste, andernorts weiche Taschen und Säcke, und es glich – zumindest wenn ich meiner Lektüre von früher glauben wollte – im Großen und Ganzen eher den faltigen, zerfurchten Gesichtern von Menschen, die sich in allen Lüsten und Wonnen umgetan hatten und deshalb früh vergreist waren, und auch den Blick der winzig gewordenen Augen hatte ich anders, freundlicher, ja vertrauenerweckender in Erinnerung. Nun und dann hinkte ich auch noch ein bisschen, zog ein wenig das rechte Bein nach: Kein Problem – sagte Onkel Miklós –, die Heimatluft bringt das dann schon in Ordnung. Zu Hause – ließ er verlauten – bauen wir uns eine neue Heimat, und fürs Erste brachte er uns auch gleich ein paar Lieder bei. Als wir dann zu Fuß durch Ortschaften und Kleinstädte zogen – was im Lauf unserer Reise hin und wieder vorkam –, sangen wir sie, militärisch in Dreierkolonne geordnet. Ich meinerseits lernte besonders «Vor Madrid auf Barrikaden» schätzen – warum, wüsste ich eigentlich gar nicht zu sagen. Aus anderweitigen Gründen, aber ebenso gern sang ich auch ein anderes, vor allem wegen folgender Stelle: «Wir schuften den lieben langen Tag/wir darben ohne Ende/doch schon nehmen wir das Gewehr/fest in die zerschundenen Hände!» Wieder aus anderen Gründen lag mir eines am Herzen, in dem die Zeile vorkam: «Wir sind die junge Gar-de, das Pro-le-tari-at», worauf wir mit gewöhnlicher Stimme dazwischenrufen mussten: «Rotfront!», denn da vernahm ich jedes Mal deutlich das Klirren von Fenstern, die geschlossen, das Knallen von Türen, die zugeschlagen wurden, und sah rasch von Tor zu Tor huschende oder eilig dahinter verschwindende Menschen, Deutsche.
Im Übrigen hatte ich mich mit leichtem Gepäck: einem einigermaßen unhandlichen, weil zu engen und dafür zu langen hellblauen Leinending – einem amerikanischen Militärsack auf den Weg gemacht. Darin meine beiden dicken Decken, Unterwäsche zum Wechseln und ein grauer, schön gestrickter Pullover aus SS-Beständen, an den Handgelenken und am Hals mit einem grünen Streifen verziert, na und dann auch noch Proviant: Konserven und dergleichen. Ich selbst trug die grüne Tuchhose der amerikanischen Armee, ebenso deren sehr dauerhaft wirkende Schnürschuhe mit Gummisohlen, darüber die Gamaschen aus unverwüstlichem Leder, mit all den entsprechenden Riemen und Schnallen. Für meinen Kopf hatte ich mir eine seltsam geformte, zumindest der Jahreszeit nicht ganz gemäße, ein wenig zu schwere Mütze beschafft, die eine hohe Blende und oben Kanten und Ecken: ein schiefes Viereck, ein – wie mir aus der längst vergangenen Schulzeit einfiel – Rhombus schmückte und die vor mir ein polnischer Offizier getragen haben soll, wie man mir sagte. Es hätte mir aus den Magazinen wohl auch zu einer besseren Jacke gereicht, aber das bewährte alte, bis auf das fehlende Dreieck und die fehlende Nummer unveränderte Stück tat es letzten Endes auch, ja, ich hatte es mir geradezu ausgesucht, ich hing geradezu daran: So konnte es wenigstens keine Missverständnisse geben – meinte ich –, nun, und dann war es auch eine recht angenehme, zweckmäßige, leichte Bekleidung, zumindest so im Sommer, wie ich fand. Den Weg legten wir auf Lastwagen, Fuhrwerken, zu Fuß und mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurück – je nachdem, womit uns die verschiedenen Armeen dienen konnten. Wir schliefen auf Ochsenfuhrwerken, auf den Bänken und Kathedern verlassener Schulzimmer oder ganz einfach unter dem sommerlichen Sternenhimmel, in den Beeten, auf dem weichen Rasen von Parks zwischen schmucken Pfefferkuchenhäusern. Wir fuhren sogar mit dem Schiff, auf einem – zumindest für das an die Donau gewöhnte Auge – nicht sonderlich großen Strom, der, wie ich erfuhr, Elbe heißt, und ich passierte einen Ort, der offensichtlich früher eine Stadt gewesen war, jetzt aber insgesamt nur noch aus Schutthaufen und ein paar schwarzen, nackten Mauern bestand. Am Fuß dieser Mauern und Trümmer, nun und dann unter den Überresten von Brücken lebten, wohnten und schliefen die Einheimischen jetzt, und ich versuchte mich darüber zu freuen, versteht sich, nur musste ich spüren: Gerade sie machten mich dabei verlegen. Ich schaukelte in einer roten Straßenbahn dahin und reiste mit einer richtigen Eisenbahn, die richtige Waggons mit richtigen, für Menschen bestimmten Abteilen hatte – auch wenn ich zufällig nur noch auf ihrem Dach Platz fand. In einer Stadt stieg ich aus und hörte da neben dem Tschechischen schon viele ungarische Wörter, und während wir am Bahnhof auf den versprochenen Anschlusszug am Abend warteten, scharten sich Frauen, Alte, Männer, allerlei Leute um uns. Sie wollten wissen, ob wir aus dem Konzentrationslager kämen, und fragten viele von uns, so auch mich, ob wir dort nicht vielleicht einem ihrer Angehörigen begegnet seien, einem mit diesem oder jenem Namen. Ich sagte ihnen, im Konzentrationslager hätten die Menschen im Allgemeinen keinen Namen. Daraufhin bemühten sie sich, das Äußere, das Gesicht, die Haarfarbe, die besonderen Merkmale des Betreffenden zu beschreiben, und ich versuchte ihnen begreiflich zu machen, dass das keinen Zweck habe, weil sich die Menschen im Konzentrationslager zumeist sehr verändern. Worauf sie sich dann langsam verliefen, bis auf einen, der ganz sommerlich nur mit Hemd und Hose bekleidet war und die Daumen seitlich, wo die Hosenträger befestigt waren, hinter den Bund geklemmt hatte, während die übrigen Finger außen auf dem Stoff herumspielten und trommelten. Er war neugierig, zu erfahren – worüber ich ein bisschen lächeln musste –, ob ich die Gaskammern gesehen hätte. Ich sagte: «Dann würden wir jetzt nicht miteinander sprechen.» – «Na ja», sagte er, aber ob es wirklich Gaskammern gegeben habe, und ich sagte, aber ja, unter anderem gebe es auch Gaskammern, natürlich, und alles habe davon abgehangen, in welchem Lager welche Gebräuche herrschten. In Auschwitz zum Beispiel habe man mit ihrem Vorhandensein rechnen müssen. Ich hingegen – bemerkte ich – käme aus Buchenwald. «Woher?», fragte er, und ich musste es wiederholen: «Aus Buchenwald.» – «Also aus Buchenwald», sagte er und nickte dazu, und ich antwortete: «Ja.» Worauf er sagte: «Also, Moment mal», und das mit einer starren, strengen, beinahe schon schulmeisterlichen Miene. «Demnach hat der Herr», und ich weiß gar nicht, warum, aber irgendwie berührte mich diese ernsthafte, um nicht zu sagen einigermaßen feierliche Anrede, «von den Gaskammern gehört», und ich sagte wieder: «Aber ja.» – «Wobei Sie sich», so fuhr er fort, noch immer mit dieser starren Miene, gleichsam in den Dingen Ordnung und Klarheit schaffend, «aber doch nicht persönlich, mit eigenen Augen davon überzeugt haben», und ich musste zugeben: «Nein.» Worauf er bemerkte: «Aha», um dann weiterzutrippeln, steif, gerade aufgerichtet und, wie mir schien, irgendwie auch befriedigt, sofern mich nicht alles getäuscht hat. Bald darauf hieß es dann: Los, der Zug ist da, und ich konnte mir sogar einen recht guten Platz ergattern, auf einem Trittbrett der breiten, hölzernen Wagentreppe. Gegen Morgen bin ich erwacht, und da dampften wir gerade munter dahin. Und später wurde ich darauf aufmerksam, dass ich die Ortstafeln schon auf Ungarisch lesen konnte. Die Wasserfläche da – man wies auf sie hin –, welche die Augen blendete, das war schon die Donau, und das Land hier ringsum, das im frühen, aber schon starken Licht nur so glühte und flimmerte, das war – so wurde gesagt – bereits Ungarn. Nach einiger Zeit fuhren wir unter ein ramponiertes Dach ein, standen dann in einer Halle mit lauter ausgeschlagenen Scheiben: der Westbahnhof, wie man um mich herum feststellte, und tatsächlich, er war es, im Großen und Ganzen erkannte ich ihn wieder.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Roman eines Schicksallosen»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Roman eines Schicksallosen» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Roman eines Schicksallosen» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.