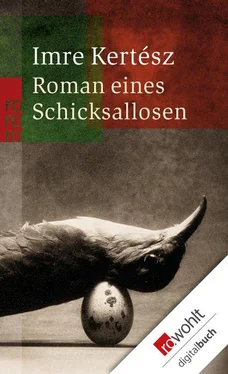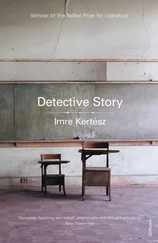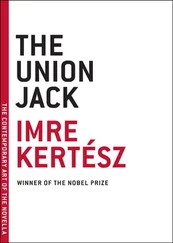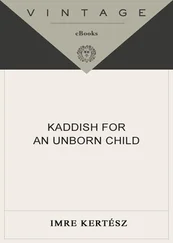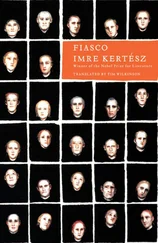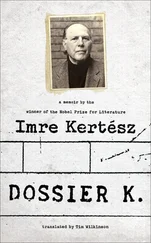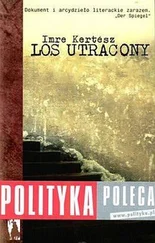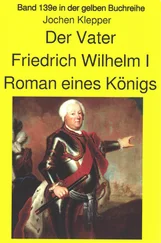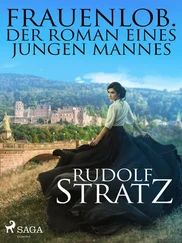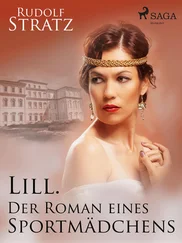Imre Kertész - Roman eines Schicksallosen
Здесь есть возможность читать онлайн «Imre Kertész - Roman eines Schicksallosen» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Город: Reinbek bei Hamburg, Год выпуска: 2010, ISBN: 2010, Издательство: Rowohlt, Жанр: Современная проза, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Roman eines Schicksallosen
- Автор:
- Издательство:Rowohlt
- Жанр:
- Год:2010
- Город:Reinbek bei Hamburg
- ISBN:9783644106215
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Roman eines Schicksallosen: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Roman eines Schicksallosen»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Roman eines Schicksallosen — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Roman eines Schicksallosen», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Doch gerade in diesem Augenblick kam der Pfleger wieder herein, und zwar direkt zu ihm, und ich staunte nur so, mit welcher Leichtigkeit er diesen – wie ich erst jetzt sah – doch noch recht gewichtigen Körper auf die Schulter nahm und zur Tür hinaustrug, während ein loses Stück Papierverband in der Bauchgegend des Kranken gleichsam zum Abschied winkte. Zur gleichen Zeit war ein kurzes Knacken, dann ein elektrisches Knistern zu vernehmen. Darauf meldete sich eine Stimme: «Friseure zum Bad, Friseure zum Bad» , sagte sie. Es war eine etwas schnarrende, sonst aber sehr angenehme, einschmeichelnde, ja fast schon betörend sanfte und melodiöse Stimme – die Art, bei der man gleichsam auch den Blick spürt, und zuerst hätte sie mich beinahe aus dem Bett geworfen. Bei den Kranken ringsum jedoch löste dieses Ereignis, wie ich sah, etwa genauso viel Aufregung aus wie zuvor meine Ankunft, und so dachte ich, also gehört das hier offensichtlich zur Tagesordnung. Rechts über der Tür entdeckte ich dann auch einen braunen Kasten, so eine Art Lautsprecher, und es ging mir auf, dass die Soldaten anscheinend über diesen Apparat irgendwoher ihre Befehle übermittelten. Kurz darauf kam abermals der Pfleger, abermals zu dem Bett neben mir. Er schlug die Decke und das Laken zurück, griff durch einen Schlitz in den Strohsack hinein, und die Art, wie er das Stroh, danach Laken und Decke wieder in Ordnung brachte, machte mir klar: den Mann von vorhin würde ich wohl kaum wiedersehen. Und ich konnte nichts dafür, dass meine Phantasie gleich wieder fragte: War das vielleicht die Strafe dafür, dass er das Geheimnis ausgeplaudert hatte, was sie – warum denn eigentlich nicht – über irgendeinen, dem anderen dort ähnlichen Apparat abgehört, abgefangen hatten? Ich wurde jedoch wieder auf eine Stimme aufmerksam – dieses Mal auf die eines Kranken, zum Fenster hin, auf dem dritten Bett von mir aus gesehen. Es war ein sehr magerer, bleicher junger Mann, und er trug noch Haare, und zwar dichte blonde, gewellte. Er sagte zwei-, dreimal dasselbe Wort, stöhnte es eher, die Vokale in die Länge ziehend, einen Namen, wie ich allmählich mitbekam: «Pjetka! … Pjetka! …» Worauf der Pfleger, auch er mit einer gedehnten und, so fühlte ich, recht herzlichen Stimme, nur ein Wort zu ihm sagte: «Co?» Darauf sagte der andere noch etwas Längeres, und Pjetka – denn ich hatte verstanden: so also hieß der Pfleger – ging zu seinem Bett. Er flüsterte lange auf ihn ein, so, wie wenn man jemandem ins Gewissen redet, ihn noch zu etwas Geduld, zu etwas längerem Ausharren mahnt. Inzwischen zog er ihn, eine Hand unter seinem Rücken, ein wenig hoch, klopfte unter ihm das Kissen zurecht, brachte auch seine Steppdecke in Ordnung, und das alles freundlich, herzlich, liebevoll – auf eine Art, die meine bisherigen Annahmen völlig durcheinanderbrachte, ja fast schon Lügen strafte. Diesen Ausdruck auf dem jetzt wieder liegenden Gesicht konnte ich wohl doch nur als Beruhigung, als eine gewisse Erleichterung verstehen, diese ersterbenden, seufzerartigen, aber doch gut hörbaren Worte: «Djinkuje … djinkuje bardzo …», doch wohl nur als Dank, wenn mich nicht alles täuschte. Und gänzlich über den Haufen geworfen wurden meine verzagten Erwägungen durch ein näher kommendes Geräusch, dann Lärm, dann das schließlich schon vom Flur hereindringende, unverwechselbare Geklapper, das mein ganzes Wesen aufwühlte, es mit beständig wachsender, immer unbezwingbarerer Erwartung erfüllte und zu guter Letzt gewissermaßen den Unterschied zwischen mir und dieser Bereitschaft verwischte. Draußen ein Lärmen, ein Kommen und Gehen, das Geklapper von Holzsohlen, schließlich das ungeduldige Rufen einer vollen Stimme: «Saal sechs! Essen holen!» Der Pfleger ging hinaus und zog dann mit Hilfe eines anderen, von dem im Türspalt nur die Arme zu sehen waren, einen schweren Kessel herein, und schon war das Zimmer mit dem Duft der Suppe erfüllt – auch wenn es heute deutlich nur der Duft von Dörrgemüse, der bekannten Lagersuppe, war: So hatte ich mich doch auch hierin geirrt.
Später machte ich dann noch weitere Beobachtungen, und während die Stunden, die Tageszeiten und schließlich die Tage vergingen, wurde mir allmählich alles klar. Jedenfalls musste ich mich nach einiger Zeit, wenn auch nur langsam, zurückhaltend und vorsichtig, von den Tatsachen überzeugen lassen, nämlich dass – wie es schien – auch das möglich und denkbar war, es mochte zwar ungewohnter sein, ja, und auch angenehmer, natürlich, aber im Grunde genommen, wenn ich es recht bedachte, war es nicht merkwürdiger als alle anderen Merkwürdigkeiten, die – es war ja schließlich ein Konzentrationslager – sonst noch möglich und denkbar waren, sowohl so als auch umgekehrt, natürlicherweise. Andererseits war es jedoch gerade dies, was mich störte, meine Sicherheit irgendwie untergrub: Letzten Endes, wenn ich es vernünftig betrachtete, konnte ich überhaupt keinen Grund, irgendeine denkbare, erkennbare, verständliche Begründung dafür sehen, dass ich zufällig gerade hier und nicht anderswo war. Nach und nach entdeckte ich, dass die Kranken hier alle einen Verband trugen, anders als in der Baracke vorher, und so wagte ich mit der Zeit die Annahme, dass sich dort womöglich die Abteilung für innere Krankheiten und hier – wer weiß – vielleicht die Chirurgie befand; doch konnte ich das natürlich noch nicht als hinreichenden Grund, als nötige Erklärung für die Mühe ansehen, für das ganze Unterfangen, dieses wahrlich wohlabgestimmte Zusammenspiel von Händen, Schultern, Überlegungen, das mich – wenn ich es richtig überdachte – von dem Karren bis hierher, in dieses Zimmer, in dieses Bett gebracht hatte. Ich versuchte auch, mir von den Kranken ein Bild zu machen, mich unter ihnen ein wenig auszukennen. Im Allgemeinen, so bemerkte ich, mussten es altgediente, alteingesessene Häftlinge sein. Wie eine Exzellenz kam mir keiner vor, obwohl ich sie andererseits auch mit den Zeitzern nicht hätte vergleichen können. Allmählich fiel mir auch auf, dass an der Brust der Besucher, die immer zur gleichen Abendstunde für eine Minute, auf einen Schwatz bei ihnen hereinschauten, stets nur rote Dreiecke zu sehen waren und zum Beispiel weder grüne noch schwarze – was ich übrigens keineswegs vermisste –, aber auch – und das vermisste mein Auge nun schon eher – keine gelben. Kurz und gut, sie waren anders, dem Blut, der Sprache, dem Alter nach, aber abgesehen davon auch sonst noch anders als ich oder die anderen, die ich bisher immer leicht verstanden hatte, und das beengte mich einigermaßen. Doch gerade darin – so spürte ich – lag irgendwo vielleicht die Erklärung. Da ist zum Beispiel Pjetka: Abends schlafen wir mit seinem Gruß «dobra noc» ein, morgens erwachen wir auf sein «dobre rano» hin. Die stets tadellose Ordnung im Zimmer, das Aufwischen des Fußbodens mit einem feuchten, um einen Stock gewickelten Lappen, das Beschaffen der täglichen Kohleration und das Heizen des Ofens, das Verteilen der Portionen und die Reinigung der dazugehörigen Näpfe und Löffel, im Bedarfsfall das Umhertragen der Kranken und wer weiß, was sonst noch: alles, alles das Werk seiner Hände. Wenn er auch nicht viele Worte macht, so sind doch sein Lächeln, seine Hilfsbereitschaft immer gleich, mit einem Wort: als wäre er nicht Inhaber eines wichtigen Amtes – schließlich ist er ja die erste Exzellenz des Zimmers –, sondern ganz einfach eine Person, die in erster Linie den Kranken zur Verfügung steht, ein Pfleger, in der Tat, so wie es auf seiner Armbinde steht.
Oder dann ist da der Arzt – denn wie sich herausgestellt hat, ist der mit dem nackten Gesicht hier der Arzt, ja sogar Oberarzt. Sein Besuch, um nicht zu sagen seine Visite, verläuft jeden Morgen nach dem gleichen, nie abgewandelten Ritual. Eben ist das Zimmer fertig, eben haben wir den Kaffee getrunken, und auch das Geschirr ist hinter dem aus einer Decke fabrizierten Vorhang verschwunden, wo Pjetka es aufbewahrt, und schon werden im Flur die vertrauten Schritte hörbar. Im nächsten Augenblick reißt eine energische Hand die Tür sperrangelweit auf, und mit einem Gruß, der wahrscheinlich «Guten Morgen» heißen soll, von dem man aber nur ein langgezogenes, kehliges «Moo’gn» hört, tritt der Arzt ein. Den Gruß zu erwidern ist – wer weiß, warum – unangebracht, und er erwartet es auch nicht, höchstens von Pjetka, der ihn mit seinem Lächeln, barhäuptig und in ehrerbietiger Haltung empfängt, aber – wie ich über eine lange Zeit hinweg öfter beobachten konnte – nicht mit der so wohlbekannten Ehrerbietung, die man den höhergestellten Exzellenzen schuldet, sondern eher so, als achte er ihn ganz einfach, aus eigener Einsicht, aus dem eigenen freien Willen sozusagen. Dann hebt der Arzt die schon von Pjetka vorbereiteten Krankenblätter einzeln hoch und studiert sie mit strenger, prüfender Miene – als ob es, sagen wir, wirkliche Krankenblätter wären, in einem wirklichen Krankenhaus, wo nichts wichtiger, nichts selbstverständlicher ist als die Frage nach dem Befinden des Kranken. Dann wendet er sich an Pjetka und macht da und dort ein, zwei, genauer: immer nur zweierlei Bemerkungen. «Kewisch … was? Kewischtjerd!» liest er zum Beispiel, und sich darauf zu melden, eine Antwort, irgendein Lebenszeichen zu geben wäre – wie ich bald gelernt habe – ebenso ungehörig, wie den Morgengruß zu erwidern. «Der kommt heute raus!» , womit er – wie ich mit der Zeit herausfand – jedes Mal sagen will, dass der Kranke im Lauf des Vormittags, sofern er dazu imstande ist, auf den eigenen Beinen, sonst eben auf Pjetkas Schulter, aber auf jeden Fall bei ihm zu erscheinen hat, bei seinen Messern, Scheren und Papierverbänden, in seinem Untersuchungszimmer, das so zehn bis fünfzehn Meter Weges vom Ausgang unseres Flurs entfernt liegt. (Er bat mich übrigens nicht um Erlaubnis, wie der Arzt in Zeitz, und auch mein Lärmen schien ihn überhaupt nicht zu stören, als er mit einer seiner seltsam geformten Scheren zwei neue Schnitte ins Fleisch meiner Hüfte machte – doch so, wie er dann meine Wunden ausdrückte, sie innen mit Gaze ausstopfte und zuletzt sogar, wenn auch sehr sparsam, noch mit einer Salbe bestrich, musste er, wie mir schien, unbestreitbar ein Fachmann sein.) Die zweite mögliche Bemerkung: «Der geht heute nach Hause!» bedeutet hingegen, dass er diesen Pflegling nunmehr als geheilt betrachtet und dieser also zurückkann – nach Hause, das heißt zurück in seinen Block im Lager, zu seiner Arbeit, zu seinem Kommando, versteht sich. Am folgenden Tag geht alles wieder ganz genau in der gleichen Weise vor sich, als genaue Kopie dieses Vorgangs, ganz ordnungsgemäß, wobei Pjetka und wir Kranken, ja beinahe schon die Einrichtungsgegenstände selbst mit gleichbleibendem Ernst teilnehmen und ihre Rollen spielen, zur Verfügung stehen, um Tag für Tag etwas Unveränderliches zu wiederholen, zu bekräftigen, einzuüben, zu bezeugen – mit einem Wort: als wäre nichts natürlicher, nichts unzweifelhafter, als dass für ihn, den Arzt, das Heilen, für uns Kranke aber die baldige Genesung, die rasche Wiederherstellung und darauf das Nachhausegehen die einzige Sorge ist, das einzige, sehnlich erwartete Ziel, in der Tat.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Roman eines Schicksallosen»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Roman eines Schicksallosen» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Roman eines Schicksallosen» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.