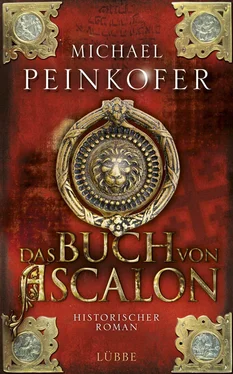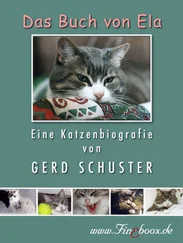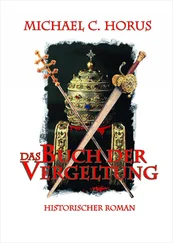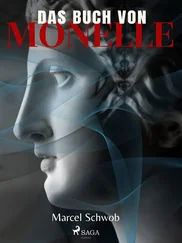Die Rückkehr des Heeres nach Antiochia löste trotz des Sieges keinen Jubel aus. Zu hoch war der Blutzoll, den die Schlacht gefordert hatte, vom Verlust unzähliger Reit- und Lasttiere ganz zu schweigen. Auch war das eigentliche Ziel, Vorräte aus dem Hinterland heranzuschaffen, nicht erreicht worden, sodass sich der Mangel im Lager zu einer regelrechten Hungersnot auswuchs. Brot und Fleisch waren nur noch mit Gold zu bezahlen, und erneut kam es zu Auflösungserscheinungen im Heer, weil die Zahl jener Ritter, die mittellos geworden waren und deshalb mit den Ihren abziehen mussten, von Tag zu Tag wuchs. Die Stimmung im Lager litt entsprechend, und es gehörte nicht viel dazu, sich auszumalen, was vor diesem Hintergrund mit einem Kämpfer geschehen würde, den man der Feigheit und des Verrats bezichtigte.
Irgendwann – Conn wusste nicht einmal, welche Tageszeit es war – wurden die Steine über seinem dunklen Gefängnis weggewälzt, und der hölzerne Deckel, der die Grube verschloss, wurde angehoben.
Sonnenlicht fiel ein, so grell und blendend, dass es Conn in den Augen schmerzte und er sie mit den Händen abschirmen musste.
»Rauskommen«, forderte ihn eine barsche Stimme auf, und noch ehe er reagieren oder auch nur etwas erkennen konnte, packten ihn grobe Hände unter den Achseln und zerrten ihn aus der Grube. Conn stieß sich das Kinn und bekam Staub in den Mund. Er hustete und würgte, was seine Häscher arg belustigte. Dann wurde er in die Höhe gerissen und aufgefordert, mitzukommen, was ihn vor große Schwierigkeiten stellte, denn infolge der drückenden Enge seines Gefängnisses waren seine Beine wie taub. Conn versuchte, einen Schritt zu machen, brach jedoch sogleich wieder zusammen. Erneut lachten die Kerle, die er nun blinzelnd als hünenhafte, mit Helmen und Speeren bewehrte Schatten wahrnahm. Mühsam raffte er sich auf die Knie. Als er jedoch versuchte, wieder auf die Beine zu kommen, fiel er um wie ein nasser Sack, worauf die Wachen ihn kurzerhand ergriffen und mitschleppten. Immer wieder gaben Conns Beine nach, sodass er unentwegt strauchelte und stürzte, bis sie endlich ihr Ziel erreichten.
Es war das Zelt Renald de Reins.
Die Behausung des Barons war so groß, dass problemlos zwanzig Mann darin Platz gefunden hätten, bunte Banner wehten darüber im kalten Wind. Durch seine tränenden Augen, die allmählich ihre Sehkraft zurückgewannen, sah Conn den Baron.
Breitbeinig und mit vor der Brust verschränkten Armen hatte sich de Rein vor seinem Zelt aufgebaut, umrahmt von seinen Kämpen. Vor ihm auf dem Boden kauerte eine kümmerliche Gestalt, deren Kleider kaum noch mehr als Lumpen waren. Der Mann hatte das Gesicht im Staub und wagte nicht aufzublicken. Er zitterte am ganzen Körper.
»So«, hörte Conn den Baron sagen. »Du hast also Brot gestohlen.«
»N-nur einen Bissen, Herr«, drang es kleinlaut und stammelnd zurück. »Um die größte Not zu lindern.«
»Du leidest Not?«
»Ja, Herr.«
»Glaubst du, du wärst der Einzige? Viele im Lager hungern in diesen Tagen, dennoch werden sie deswegen nicht zu Dieben.«
»Verzeiht, Herr. Ich werde es niemals wieder tun.«
»Das ist richtig, denn dazu wird dir in Zukunft eine wichtige Voraussetzung fehlen. Gerard?«
»Sire?«, antwortete einer der Bewaffneten.
»Hackt ihm die Hände ab, und dann schleppt ihn durch das Lager, damit alle sehen können, was mit denen geschieht, die sich am Eigentum anderer vergreifen.«
»Ja, Sire.«
»Nein!«, schrie der Dieb, der noch immer am Boden kauerte. »Bitte tut das nicht, Herr! Lasst Gnade walten!«
Renald de Rein reagierte nicht.
Weder als der Verurteilte unter lautem Gezeter gepackt und davongeschleppt wurde, noch als ein dumpfer Schlag und ein gellender Schrei davon kündeten, dass die Strafe vollzogen worden war. Die Aufmerksamkeit des Barons galt dem nächsten Straffälligen, der ihm vorgeführt wurde, auf dass er über ihn richte.
Conn.
Die Wachen zerrten ihn nach vorn, und es gelang ihm, einige Schritte zu gehen, bevor er erneut in die Knie brach. Genau dort, wo eben noch der bedauernswerte Dieb gelegen hatte.
»Nun, Conwulf, des Baldrics Sohn?«, erkundigte sich Renald de Rein streng. »Hattest du in der Gefangenschaft Zeit zum Nachdenken?«
Conn blieb eine Antwort schuldig, er wusste nicht, was er erwidern sollte. Vor die Wahl gestellt, de Rein beizustehen oder Bertrand vor dem sicheren Tod zu bewahren, würde er immer wieder dieselbe Entscheidung treffen – auch wenn sie ins Verderben führen würde.
»Ich nehme an, das heißt Nein«, gab der Baron sich selbst die Antwort. »Was also soll ich mit dir anfangen? Du bist ein guter Kämpfer, Conwulf, aber dein von Unrast getriebener Geist neigt zur Auflehnung, und das kann ich nicht dulden.«
»Bedenkt, dass er Euch das Leben gerettet hat, Herr.«
»Wer hat das gesagt?« Wütend schaute de Rein in die Richtung, aus der der Einwurf gekommen war. Einige Soldaten, Diener und Knappen hatten sich dort versammelt, die aus Neugier zuschauten, wie der Baron über die Seinen zu Gericht saß. Auch ein Mönch war dabei, der eine schwarze Kutte trug. Ihn wiederzusehen war Conn in diesem Moment eine willkommene Freude.
»Das war ich, Herr«, erwiderte Berengar und beugte das Haupt. »Bitte verzeiht, dass ich ungefragt das Wort an Euch richte, aber ich sehe es als meine Pflicht an, Euch davor zu bewahren, Euch an diesem Mann zu versündigen, in dessen Schuld Ihr steht.«
»So«, knurrte de Rein mit einem schiefen Grinsen im Gesicht. »Wie es aussieht, hast du fromme Fürsprecher, Conwulf. Ich fürchte nur, dass Ihr über die jüngsten Entwicklungen nicht im Bilde seid, Pater. Denn ich habe diesem da ebenfalls das Leben gerettet, sodass mich keine Schuld mehr bindet.«
Berengar, der dies tatsächlich nicht gewusst zu haben schien, schaute Conn fragend an, der de Reins Worte mit einem knappen Nicken bestätigte. Es stimmte, der Vater seines Erzfeindes hatte ihm in der Schlacht das Leben gerettet, wohingegen er ihn schmählich im Stich gelassen hatte.
»Du magst es glauben oder nicht, Junge«, wandte sich der Baron wieder seinem Gefangenen zu, »aber ich habe viel über dich nachgedacht in letzter Zeit. Ich habe große Hoffnungen in dich gesetzt, aber im Grunde hätte ich wissen müssen, dass Baldrics Sohn …«
Er unterbrach sich, als zwei Gestalten unter dem Baldachin hervortraten, der den Eingang des Zeltes überdachte. Den einen der beiden Männer kannte Conn nicht – er war schlank und hatte langes schwarzes Haar, seiner Kleidung nach war er Südfranzose. Den anderen Mann hingegen erkannte Conn sofort.
Es war Guillaume de Rein.
Nias Mörder.
Hätte sich Conn nicht so schwach und elend gefühlt, hätte er vermutlich über die Ironie dieser Situation gelacht. Solange er Renald de Rein gedient und unter Einsatz seines Lebens für ihn in die Schlacht gezogen war, hatte er Guillaume niemals zu sehen bekommen; nun jedoch, da er seine Pflichten vernachlässigt hatte und dafür bestraft werden sollte, stand der Mörder plötzlich vor ihm, ein hämisches Grinsen in seinem blassen Gesicht, das sich für Conn anfühlte, als würde ein glühendes Eisen in eine alte Wunde gebohrt.
Sein Blick verengte sich, sodass er das Gefühl hatte, nur noch Guillaume zu sehen. Hass züngelte in ihm empor wie eine Flamme, die neue Nahrung erhielt.
»Was willst du?« Renald de Rein war offensichtlich nicht sehr erbaut über das Auftauchen seines Sohnes.
»Verzeiht mein unvermitteltes Erscheinen, Vater«, sagte Guillaume und trat näher, wobei der französische Ritter ihm wie ein Schatten folgte. »Aber ich kam nicht umhin zu hören, wie Ihr einen Namen nanntet – einen Namen, den ich in der Vergangenheit öfter zu hören bekam, wie Ihr vielleicht noch wisst.«
Conn sah den Mörder näher kommen. Sein Herzschlag steigerte sich, Blut rauschte in seinen Ohren. Nur wenige Schritte von ihm entfernt blieb Guillaume stehen.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу