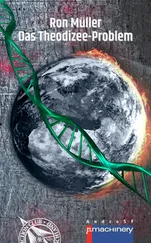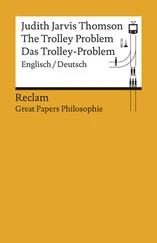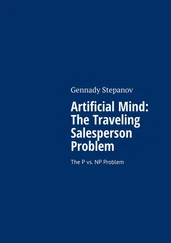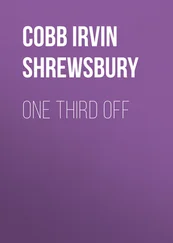»Ständig verteidigst du die Juden.«
»Er repräsentiert nicht die Juden. Er tritt für die reine Vernunft ein. Die Juden haben ihn verstoßen.«
»Seit langem habe dich schon davor gewarnt, mit Juden zusammen zu studieren. Ich habe dich davor gewarnt, dieses jüdische Gebiet zu betreten. Ich habe dich vor der großen Gefahr gewarnt, in der du dich befindest.«
»Du kannst dich entspannen. Die Gefahr ist vorüber. Alle Juden im Psychoanalytischen Institut haben das Land verlassen. Darunter auch Albert Einstein. Und all die anderen großen jüdisch-deutschen Wissenschaftler. Und auch die großen deutschen, nichtjüdischen Schriftsteller – wie Thomas Mann und zweihundertfünfzig unserer begnadetsten Schriftsteller. Glaubst du wirklich, dass das unser Land stärkt?«
»Mit jedem Juden oder Judenfreund, der das Land verlässt, wird Deutschland stärker und reiner.«
»Glaubst du, ein solcher Hass …«
»Es geht nicht um Hass. Es geht darum, die Rasse zu bewahren. Für Deutschland ist die Judenfrage erst dann gelöst, wenn der letzte Jude den großdeutschen Raum verlassen hat. Ich wünsche ihnen nichts Schlimmes. Ich will nur, dass sie woanders leben.«
Friedrich hatte gehofft, Alfred zu zwingen, die Konsequenzen seiner Ziele zu betrachten. Er spürte die Sinnlosigkeit, diesen Pfad weiter zu beschreiten, konnte sich aber nicht beherrschen. »Empfindest du es nicht als schlimm, Millionen von Menschen zu entwurzeln und mit ihnen – ja was eigentlich – zu machen?«
»Die müssen woandershin – nach Russland, Madagaskar, was weiß ich.«
»Benutze deine Vernunft! Du hältst dich für einen Philosophen …«
»Es gibt höhere Werte als Vernunft. Nämlich Ehre, Blut, Mut.«
»Überlege dir die Konsequenzen dessen, was du vorschlägst, Alfred. Ich bitte dich dringend, den Mut aufzubringen, dir die menschlichen Konsequenzen deiner Vorschläge anzusehen, und zwar genau anzusehen. Aber vielleicht kennst du sie ja bis zu einem gewissen Grad schon. Vielleicht stammt deine beträchtliche Unruhe aus dem Teil deines Gehirns, das um das Grauen weiß …«
Es klopfte. Alfred stand auf, ging zur Tür, öffnete sie und erschrak, als er Rudolf Hess sah.
»Heil Hitler, Reichsleiter Rosenberg. Der Führer ist hier und will Sie besuchen. Er hat Neuigkeiten für Sie und erwartet Ihr Erscheinen im Konferenzraum. Ich werde draußen warten und Sie begleiten.«
Alfred erstarrte einen Augenblick lang. Dann streckte er sich, ging zu seinem Schrank und nahm seine Uniform heraus. Er drehte sich zu Friedrich um – und sah fast überrascht aus, dass er noch immer da war. »Herr Oberleutnant Pfister, begeben Sie sich auf Ihr Zimmer. Warten Sie dort auf mich.«
Schnell legte er die Uniform an, stieg in die Stiefel und ging zu Hess hinaus. Schweigend marschierten die beiden auf den Raum zu, in dem Hitler sie erwartete.
Hitler stand auf, um Alfred zu begrüßen, erwiderte dessen militärischen Gruß, zeigte auf einen Stuhl und bedeutete Hess, draußen zu warten.
»Gut sehen Sie aus, Rosenberg. Ganz und gar nicht wie ein Krankenhauspatient. Ich bin erleichtert.«
Alfred, von Hitlers Leutseligkeit geschmeichelt, murmelte ein Dankeschön.
»Gerade habe ich Ihren Artikel im Völkischen Beobachter vom letzten Jahr über die Verleihung des Nobelpreises an Carl von Ossietzky noch einmal gelesen. Hervorragende journalistische Arbeit, Rosenberg. Weit besser als der farblose Kram, der während Ihrer Abwesenheit in unserer Zeitung veröffentlicht wird. Genau der richtige Ton von Würde und Aufschrei gegenüber dem Nobelkomitee, das den Friedenspreis einem Bürger verleiht, der in seinem eigenen Land wegen Hochverrats hinter Gittern sitzt. Ich bin mit Ihrer Auffassung voll und ganz einverstanden. Es ist wirklich eine Beleidigung und ein Frontalangriff gegen das souveräne Reich. Bitte bereiten Sie den Nachruf auf Ossietzky vor. Er verträgt das Konzentrationslager nicht sehr gut, und vielleicht haben wir Glück, und wir können schon bald seinen Tod melden.
Aber ich bin heute nicht nur gekommen, um mich nach Ihrem Befinden zu erkundigen und Ihnen meine Grüße zu überbringen, sondern um Ihnen auch Neuigkeiten mitzuteilen. Mir hat Ihr Vorschlag in dem Artikel ausgesprochen gut gefallen, dass Deutschland die Arroganz von Stockholm nicht mehr tolerieren sollte und wir unser eigenes Gegenstück zum mittlerweile anrüchigen Nobelpreis ins Leben rufen sollten. Ich bin aktiv geworden und habe ein Auswahlkomitee geschaffen, das Kandidaten für den deutschen Nationalpreis für Kunst und Wissenschaft in Erwägung ziehen soll. Ich habe Müller-Erfurt beauftragt, ein aufwendiges, diamantbesetztes Pendant zu entwerfen. Es wird einen Preis in Höhe von hunderttausend Reichsmark geben. Ich möchte, dass Sie als Erster erfahren, dass ich Sie für den ersten Deutschen Nationalpreis vorgeschlagen habe. Hier ist ein Exemplar der öffentlichen Verlautbarung, die ich in Kürze herausgeben werde.«
Alfred nahm das Blatt in die Hand und las begierig:
»Die nationalsozialistische Bewegung und darüber hinaus das ganze deutsche Volk werden es mit tiefer Genugtuung begrüßen, daß der Führer in Alfred Rosenberg einen seiner ältesten und treuesten Mitkämpfer durch Verleihung des Deutschen Nationalpreises auszeichnet.«
»Danke. Danke, mein Führer. Danke für den stolzesten Augenblick in meinem Leben.«
»Und wann werden Sie wieder an Ihre Arbeit gehen? Der Völkische Beobachter braucht Sie.«
»Morgen. Ich bin jetzt vollkommen einsatzfähig.«
»Der neue Arzt, dieser Freund von Ihnen, muss ein Wunderarzt sein. Wir sollten ihn belobigen und befördern.«
»Nein, nein – ich gesundete bereits, bevor er eintraf. Er verdient keine Belobigung. Übrigens wurde er in diesem Freud-Institut in Berlin ausgebildet, das von Juden geführt wurde, und vergießt bittere Tränen darüber, dass die jüdischen Psychiater allesamt das Land verlassen haben. Ich habe es versucht, aber ich glaube nicht, dass ich den Juden in ihm austreiben kann. Wir sollten ein Auge auf ihn haben. Vielleicht hat er ein wenig Resozialisierung nötig. Und nun mache ich mich an die Arbeit. Heil, mein Führer!«
Aufgekratzt marschierte Alfred in sein Zimmer und begann sogleich zu packen. Ein paar Minuten später klopfte Friedrich an seine Tür.
»Alfred, du reist ab?«
»Ja, ich reise ab.«
»Was ist geschehen?«
»Was geschehen ist, ist, dass ich keinen Bedarf mehr an Ihren Diensten habe, Herr Oberleutnant Pfister. Kehren Sie augenblicklich auf Ihren Posten nach Berlin zurück.«
31
VOORBURG, DEZEMBER 1666
Verehrter Bento,
Simon versprach mir, diesen Brief innerhalb einer Woche an Sie zu schicken, und wenn ich ihm nichts anderes sage, werde ich Sie am späten Vormittag des zwanzigsten Dezember in Voorburg besuchen. Ich habe Ihnen viel zu erzählen und viel von Ihrem Leben zu erfahren. Wie sehr Sie mir gefehlt haben! Ich stand unter einer derart quälenden Überwachung, dass ich es nicht einmal wagte, Simon zu besuchen, um einen Brief an Sie zu übergeben. Sie sollen wissen, dass ich Sie all die Jahre stets im Herzen getragen habe, auch wenn wir voneinander getrennt waren. Kein Tag vergeht, an dem ich Ihr strahlendes Gesicht nicht vor mir sehe und Ihre Stimme nicht in meinen Ohren höre.
Wahrscheinlich wissen Sie, dass Rabbi Mortera nicht allzu lange nach unserem letzten Treffen gestorben ist und dass Ihr Schwager, Rabbi Samuel Casseres, der die Begräbnisfeierlichkeiten zelebrierte, ein paar Wochen danach ebenfalls starb. Ihre Schwester Rebecca wohnt nun allein mit ihrem Sohn Daniel. Er ist nun sechzehn Jahre alt und für das Rabbinat vorgesehen. Ihr Bruder Gabriel, der nun Abraham heißt, ist mittlerweile ein erfolgreicher Kaufmann und reist oft zu Handelsgeschäften nach Barbados.
Читать дальше