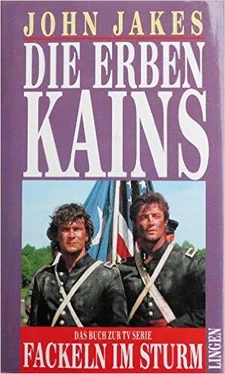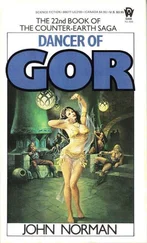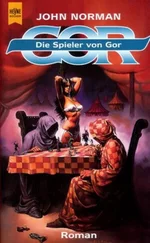Er war ein kleiner, sehniger Mann mit sonnengebräuntem Gesicht und im Gegensatz zu seinem Bruder ohne jeglichen Charme. Er sah gereizt aus. Da momentan keine Gäste um sie herum waren, tranken er und Justin Punsch. Madeline unterhielt sich ganz in der Nähe mit dem Episkopalisten-Pfarrer.
»Ich weiß nicht, wer im Herbst die Wahlen gewinnen wird, Vater Viktor«, hörten die Brüder sie sagen. »Aber der Ausgang der Wahlen wird offensichtlich von der Annexion von Texas abhängig sein.«
»Sind Sie sich darüber im klaren, daß ein Mann aus South Carolina diese Frage vor die Öffentlichkeit gebracht hat?«
»Sie meinen wohl Mr. Calhoun?«
Vater Viktor nickte. Calhoun war dritter Staatssekretär in der unruhigen Regierung Tyler. Nachdem er zu Beginn des Jahres in sein Amt berufen worden war, hatte er den Entwurf für den Annexionsvertrag ausgearbeitet, der im April von der Republik Texas und den Vereinigten Staaten unterzeichnet wurde.
»Sie haben vollkommen recht. Die Frage ist von ungeheurer Brisanz«, sagte der Pfarrer. »Bevor das Jahr um ist, wird jeder Mann, der im öffentlichen Leben steht, Stellung beziehen müssen.«
»So sollte es sein«, sagte Madeline. »Man sagt, daß die Texasfrage tiefere Wurzeln hat, als einige der Politiker zugeben wollen. Ich habe gehört, daß es in Tat und Wahrheit um die Expansion der Sklaverei geht.«
Der Pfarrer fuhr auf. »Die einzigen, die so was sagen, sind Agitatoren, skrupellose Agitatoren der Yankees.«
Aus Höflichkeit gab Madeline zu, daß dies möglich sei, dann aber murmelte sie: »Ich frage mich …«
Der Pfarrer sagte nicht sonderlich erfreut: »Sollen wir uns etwas zu essen holen?«
Madeline merkte, daß sie ihn verärgert hatte. »Ja, natürlich. Bitte gehen Sie vor.«
Sie lächelte ihren Mann an. Er lächelte eher gezwungen zurück.
Nachdem sie und der Pfarrer in der Menge verschwunden waren, warf Francis seinem Bruder einen verstohlenen Blick zu. »Deine Braut hat zu einer ganzen Reihe von Fragen des öffentlichen Lebens ihre Meinung.«
Justin kicherte.
»So, ist dir das aufgefallen?«
»Sie sollte nicht so offen daherreden. Es ist zwar erfreulich, wenn eine Frau intelligent ist, aber das sollte sich in Grenzen halten.«
»Mein lieber Bruder, alles hat seinen Preis, auch die Mitgift des alten Fabray.« Justin starrte über den Rand seines silbernen Punschbechers auf das gewölbte Mieder von Madelines Hochzeitskleid. Mit halbgeschlossenen, schläfrigen Augen berechnete er den Sonnenstand. In wenigen Stunden würde er all das, was hinter diesem spitzenbesetzten Satin verborgen war, sein Eigentum nennen können. Er konnte kaum noch warten.
Wie merkwürdig war doch das Schicksal, dachte er. Vor etwa zwei Jahren hatte er beschlossen, nach New Orleans zu reisen, obwohl er sich das kaum leisten konnte. Er war in der Absicht hingereist, sich an den Spieltischen zu vergnügen und an einem jener legendären Bälle teilzunehmen. Doch bevor er zum Ball ging und sich die Niggerschönheiten ansehen konnte, lenkte das Schicksal ihn an die Bar eines modischen Spielsalons neben Nicholas Fabray. Fabray spielte nicht, aber er kam öfters hierher, weil sich hier die einflußreichen Männer der Stadt trafen. Dem Besucher wurde bald klar, daß Fabray zu ihnen gehören mußte. Er kannte jedermann, seine Kleidung war elegant und teuer, und er gab sein Geld mit einer Nonchalance aus, die jenen eigen ist, die sich keine Sorgen darüber zu machen brauchen. Später stellte Justin einige Fragen und erfuhr, daß seine Vermutungen richtig gewesen waren.
Zwei Abende später traf er Fabray zufällig wieder am gleichen Ort. Und jetzt erfuhr er, daß der Zuckerfabrikant eine junge, unverheiratete Tochter hatte. Von nun an triefte Justin vor Höflichkeit und guter Laune. Fabray ließ sich beeindrucken; in der Tat, wenn Justin charmant sein wollte, konnte es niemand mit ihm aufnehmen.
Justin ließ einige Male die Bemerkung einfließen, daß er ein Fremder in dieser Stadt sei, worauf Fabray ihn zu sich nach Hause zum Abendessen einlud. Justin lernte die Tochter kennen, und vom Augenblick an, da er sie gesehen hatte, war er fast verrückt nach ihr.
Er ließ sich jedoch nichts anmerken und behandelte Madeline Fabray mit derselben zurückhaltenden Höflichkeit wie ihren Vater. Bevor der Abend zu Ende war, zog Justin die Schlußfolgerung, daß das schöne Geschöpf zwar Respekt vor seinem Alter und seiner Erfahrung, jedoch keine Angst vor ihm hatte.
Er verlängerte seinen Aufenthalt in New Orleans um eine Woche und dann noch um eine weitere. Fabray schien sich darüber zu freuen, daß ein Gentleman von Justins Kaliber seiner Tochter den Hof machte. Und alles, was Justin über den Vater erfuhr, verstärkte bloß seinen Wunsch, Madeline zu besitzen. Vor allen Dingen gab es keine religiösen Probleme. Die Familie war deutsch – der ursprüngliche Name lautete Faber – und protestantisch. Madeline ging zur Kirche, obwohl ihr Vater dies nicht tat; er war nicht an seiner Seele, sondern an seinem Vermögen interessiert. Fabray, der ahnte, was Justin durch den Kopf ging, ließ durchblicken, daß er für seine Tochter eine große Mitgift vorgesehen hatte.
Einmal fragte Justin nach Madelines Mutter. Er erfuhr jedoch bloß, daß sie vor einigen Jahren gestorben sei. Sie war Kreolin gewesen, was bedeutete, daß sie in New Orleans als Kind europäischer Eltern geboren worden war. Wahrscheinlich waren es Franzosen gewesen; es hätten aber auch Spanier sein können. Justin, der sich die kleine Ahnengalerie von Fabray ansah, fragte, ob es irgendwelche Bilder der Frau gab, aber Fabray antwortete ausweichend: »Nein, hier nicht.«
An diesem Punkt beschloß Justin, mit seinen Nachforschungen nicht fortzufahren. Jede ehrbare Familie, einschließlich seiner eigenen, wies einige verborgene Makel auf. Meistens handelte es sich um Frauen, die ihrem Mann davonliefen oder einer nervösen Krankheit anheimfielen, so daß man sie bis zu ihrem Tod einsperren mußte. Er hatte nichts Skandalöses über die Verstorbene erfahren – alle, die er befragt hatte, hatten sie nicht einmal erwähnt –, also würde er diese Sorge im Austausch für Madelines Schönheit und das Geld, das er für seinen Lebenswandel so dringend benötigte, begraben.
Wenn Fabrays Tochter überhaupt einen Makel aufwies, so war es ihre offenkundige Intelligenz und die Tatsache, daß sie ihre Meinung zu Fragen, die sonst Männern vorbehalten waren, nicht zu verbergen gewillt war. Fabray hatte dafür gesorgt, daß sie die für eine Frau in New Orleans bestmögliche Ausbildung bekommen hatte – jene, die die Ursulinerinnenschule vermittelte. Fabray hatte viele gute Freunde in der katholischen Gemeinde der Stadt, und es war allgemein bekannt, daß er die katholische Kirche unterstützte. Er hatte die Schwestern dazu bewegen können, eine protestantische Schülerin zu akzeptieren, indem er dem von ihnen geleiteten Kranken- und Waisenhaus eine beträchtliche Summe stiftete.
Doch die direkte Art Madelines konnte Justin nicht abschrecken. Er wußte, wie man mit solchen Problemen fertig wurde, obwohl er die Absicht hatte, diese Methoden zu verbergen, bis sie seine rechtmäßige Frau geworden war.
Bevor er die Stadt verließ, bat er um die Erlaubnis, um Madelines Hand anhalten zu dürfen. Dies wurde ihm auch gestattet. Madeline hörte sich seine lange, komplizierte Liebeserklärung an, und er wurde zusehends sicherer, daß sie am Ende ja sagen würde. Doch sie sagte nein, obwohl sie sich mehrere Male für den Antrag bei ihm bedankte.
Um sich physisch und geistig abzureagieren, nahm er sich an jenem Abend eine Nutte und mißhandelte sie mit Stock und Fäusten. Nachdem sie aus seinem Hotelzimmer hinausgeschlichen war, lag er während mehr als einer Stunde in der Dunkelheit wach. Er rief sich Madelines Gesicht in Erinnerung, als sie ihn ablehnte, und kam zum Schluß, daß sie doch Angst hatte. Da sie aber unmöglich Angst vor ihm haben konnte – er war schließlich höflich wie ein Engel gewesen –, mußte sie Angst vor der Heirat an und für sich haben. Diese Haltung war ja unter Mädchen weit verbreitet; dem konnte Abhilfe geschaffen werden. Ihr Nein war eine Verzögerung, keine endgültige Absage.
Читать дальше