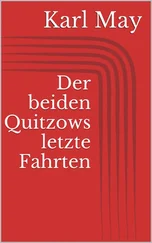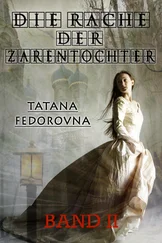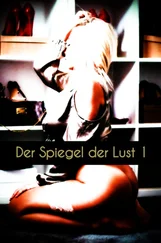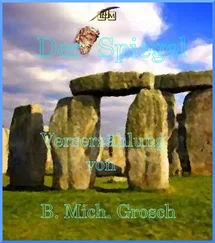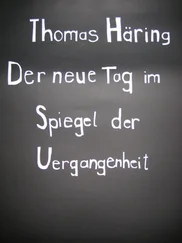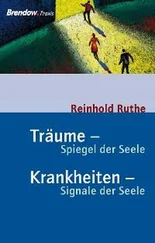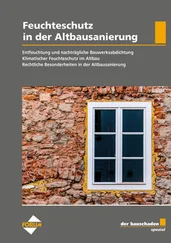Jan hatte das Gröbste schon hinter sich. So versprach er sich schon lange nicht mehr, wenn er nach seinem Namen gefragt wurde, weil ihm inzwischen genügend gegenwärtig war, dass er jetzt Jan Fellgiebel hieß. Aber eigentlich fühlte er sich immer noch als Jean Hossenlopp , und der Name Fellgiebel, obwohl er ihm ganz gut gefiel, war nur eine Haube, die ihm übergestülpt worden war. ‚Aber das weißt du doch!‘, hatte ihn neulich der Klassenlehrer sanft getadelt, als er sich wieder einmal verhaspelt hatte, und das war ihm peinlich gewesen, nicht nur weil die ganze Klasse gelacht hatte. Natürlich hatte er das gewusst! Aber sein Versprecher hatte mit dem, was er wusste, nicht viel zu tun.
Enrico, sein Banknachbar und neuer Freund, der zu einer verzweigten Artistenfamilie drüben auf dem Waldhof gehörte und sich vom ersten Tag an hilfsbereit um ihn gekümmert hatte, gab ihm in der Pause recht: Etwas richtig zu wissen, heiße noch lange nicht, es richtig zu tun, das würde ihnen bei der artistischen Ausbildung immer wieder eingetrichtert; nicht Wissen müsse man erwerben, sondern Automatismen, heiße es da, und das gelte auch für das Sprechen. Wissen könne dabei ganz nützlich sein, manchmal aber würde es einem auch im Weg stehen, und besonders schwer sei es, einen bereits erworbenen Automatismus aufzugeben und ihn durch einen neuen zu ersetzen, das sei ihm früher einmal bei der Parterreakrobatik passiert, und restlos würde man wahrscheinlich einen alten Automatismus nie loswerden, und ‚Hossenlopp‘ zu sagen, das sei ein solcher Automatismus. Von Automatismen hatte Jan noch nie etwas gehört, aber was ihm Enrico da erzählte, leuchtete ihm ein.
Auch das lähmende Heimweh hatte Jan inzwischen überwunden. Es war ein eigentümliches Heimweh gewesen, und ihm war deshalb so schwer zu entkommen, weil es nur noch aus der Trauer und aus Lethargie bestand, jedoch die Sehnsucht wonach , die sonst ein Heimweh vor allem bestimmt, die fehlte bei ihm gänzlich. Wonach hätte er sich auch sehnen sollen? Der Jan ist zu oft umgetopft worden, hatte neulich der Klassenlehrer gesagt.
An die Zeit vor Hossenlopps, das musste in einem Kinderheim in Frankreich gewesen sein, hatte er nur noch ganz vage Erinnerungen, eigentlich überhaupt keine mehr, auch seine Schwester Germaine tauchte erst in der Hossenlopp-Zeit in seinen Erinnerungen auf und wurde dann immer wichtiger für ihn. Nach dem Tod der Eltern hatte man sie beide in das Kinderheim in Herrlingen getan, was sie erst so richtig zusammengeschweißt hat, doch es war nicht lange gegangen, bis man das ganze Kinderheim zusammengepackt hatte und aufgebrochen war nach Palästina, während er im Krankenhaus landete. An seiner Stelle wurde Fellgiebels behinderter Sohn Siegfried mitgegeben. Von da an war er endgültig allein gewesen. Er war in das Internat nach Stefansfeld gekommen, was nicht schlecht war, aber zusammen mit Germaine wäre es gewiss erträglicher gewesen. Aber auch das war nicht lange gegangen. Kaum war er mit der neuen Situation einigermaßen vertraut – alles war neu gewesen für ihn: neue Erzieher und neue Lehrer, neue Kameraden und neue Orte, neue Schulbücher und neue Kleider –, da war er von seinem jetzigen Stiefvater dringend nach Mannheim ‚zurückbeordert‘ worden, wie dieser in einem langen Brief an ihn schrieb ‚ zurück beordert‘ nach Mannheim, obwohl er vorher noch nie dort gewesen war.
Die Not in seinem neuen Elternhaus war tatsächlich groß. Fellgiebels Frau Marianna war schon bald nach der Ausreise ihres Sohnes Siegfried in eine schwere Krise geraten. Obwohl sie in dieser Ausreise die einzige Rettung für Siegfried sah, hatte sie sich nicht von dem immer wieder aufsteigenden Selbstvorwurf befreien können, Siegfried abgeschoben zu haben. Eine große Leere war über sie gekommen, die im Laufe der Zeit vielleicht überwindbar gewesen wäre, hätte sie sich nicht allmählich mit einer schweren Depression aufgefüllt.
„Ich liebe Siegfried so sehr“, hatte sie tonlos bekannt, „und das tut hier so weh!“, wobei sie die flache Hand auf die Magengrube presste.
„Oh ja, du spürst das im Sonnengeflecht“, hatte Fellgiebel sachlich diagnostiziert. „Menschen mit einem hohen Integrationsgrad erleben gewisse Gefühle, wenn sie allzu heftig werden, im Solarplexus geradezu körperlich, bis hin zu einem gewissen Schmerz“, dozierte Fellgiebel weiter, was ihr aber auch nicht weiterhalf.
Später war er dann auf die Idee gekommen, dass man ihre mütterlichen Instinkte stärker beanspruchen müsse, denn ihre Tochter aus erster Ehe, die ja noch im Hause war und sich übrigens rührend um sie bemühte, war schon fast eine junge Dame und ließ sich längst nicht mehr so innig bemuttern, wie das für Mariannas Balance, nachdem man ihr den pflegebedürftigen Siegfried weggenommen hatte, offenbar notwendig war. So lag es für Fellgiebel nahe, sich über ein neues Objekt für ihre Mutterliebe Gedanken zu machen, und dabei hätte es gar nicht anders sein können, als dass er alsbald auf Jan kam. So geschah es denn auch – Jan wurde aus dem Internat kurzerhand zurückbeordert.
Jan war kaum eingetroffen, da schlug Fellgiebels Therapie auch schon an. Marianna setzte sich jeden Abend zu Jan ans Bett, las ihm vor oder plauderte mit ihm, am Morgen weckte sie ihn behutsam und half ihm sogar beim Anziehen. In den ersten Tagen brachte sie ihn noch zur Schule, und bei Tisch war sie bestrebt, ihn, der sich in der neuen Umgebung eher still verhielt, möglichst in alle Gespräche einzubeziehen. Wenn er abends in der Badewanne saß, wusch sie ihn mit Zärtlichkeit und Sorgfalt, was ihm schon seit Jahren nicht mehr widerfahren war. Schon nach wenigen Tagen zeigte sich Marianna fast glücklich und lachte endlich einmal wieder, und ihr Zustand besserte sich rasch. Zwar sprach sie, wenn sie mit ihrem Mann allein war, immer noch viel von Siegfried, oft in einer sehr nachdenklichen Weise, aber längst nicht mehr in diesem gequälten Ton wie in den vergangenen Wochen.
Der arme Jan, der in seinem Leben noch nicht viele Erfahrungen mit derart robuster Bemutterung hatte sammeln können, verhielt sich eher scheu, aber keineswegs abweisend, und genoss es offensichtlich, plötzlich so viel Beachtung zu finden. Dagegen waren ihm die polternde Freundlichkeit und die aufdrängende Zuwendung seines Stiefvaters, der er bei jeder zufälligen Begegnung in Haus und Hof ausgesetzt war, eher lästig. So konnte es schon einmal vorkommen, dass er beim Verlassen seines Zimmers erst einen Augenblick lauschte, ob der Weg nach unten frei war, denn wenn er seinem neuen Vater begegnete – auch wenn dieser mit jemandem sprach und er sich vorbeizustehlen versuchte –, konnte das ein ausführliches, wenn auch meistens ziemlich einseitiges Gespräch nach sich ziehen mit vielen Fragen, die er beantworten sollte. ‚Halt, mein Freund‘, rief Fellgiebel dann, ‚ist alles in Ordnung? – Geht es dir gut? – Warst du heute schon auf der Toilette? – Kommst du mit deinen Hausaufgaben zurecht?‘
Wenn er dann womöglich noch näher auf die Schule zu sprechen kam und seine Auffassung über die Bedeutung der einzelnen Fächer kundtat, konnte das Gespräch sehr lange gehen. Jan war ja durchaus bereit, geduldig zuzuhören, wenn sein ruhiges Zuhören nur nicht immer wieder durch die vielen eingestreuten Vergewisserungsfragen, auf die er antworten musste, unterbrochen worden wäre. Da wurde ihm dann jedes Mal deutlich, in welch einem Missverhältnis das raumfüllende Dröhnen seines neuen Vaters zu dem dünnen Fiepsen seiner kurzen Antworten stand, und er fühlte sich fast erdrückt. –
„Ich habe Ihren Sohn neben ein auffallend aktives und kontaktfreudiges Kind gesetzt“, sagte der Klassenlehrer, „einen gewissen Enrico, er kommt aus einer bekannten Artistenfamilie. Der Einzige in der Klasse, den alle Lehrer mit seinem Vornamen aufrufen. Das ist eigentlich sein Künstlername. Der wird uns helfen, den stillen Jan ein wenig aufzulockern.“
Читать дальше