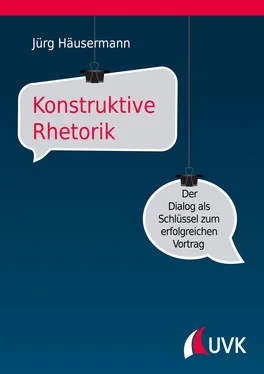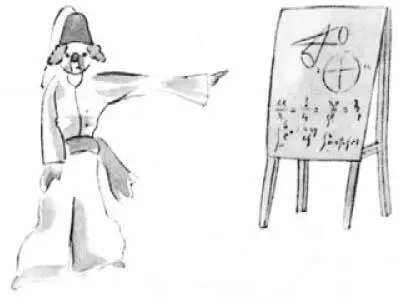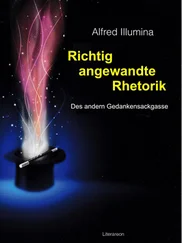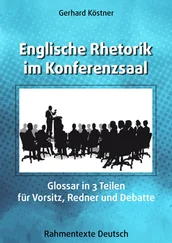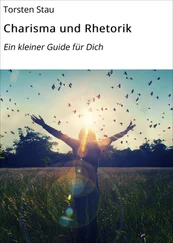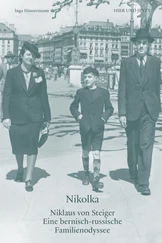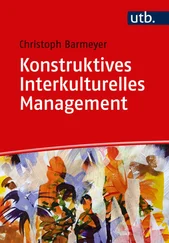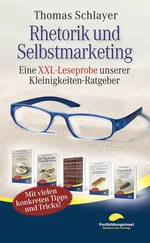In der Fernsehserie Wie man mit Mord davonkommt 24 steht eine Juraprofessorin im Mittelpunkt, die ihre Strafrechtsvorlesung nicht als Theorie von Recht und Unrecht konzipiert hat, sondern als Anleitung, das Gesetz zu umgehen. Damit hebt sie sich explizit von ihren Kollegen ab. Gleichzeitig erzielt sie auf diese Weise einen enormen Zulauf von Studierenden und nützt damit nicht nur ihrem eigenen Renommee, sondern auch dem ihrer Universität.
Zu berücksichtigen bleibt, dass institutionelle Vorgaben auch etwas Gutes haben. Auch wenn sie in vielen Fällen lächerlich oder veraltet wirken, erleichtern sie andererseits auch die Kommunikation. Sie unterstreichen die Funktion der betreffenden Person und verleihen ihr damit mehr Autorität. Zur rhetorischen Praxis gehört es, sich zu überlegen, inwieweit es möglich ist, von den Normen des Veranstalters zu profitieren, aber auch von ihnen abzuweichen, um nicht nur als Vertreter einer abstrakten Instanz, sondern auch als Individuum in den Dialog mit dem Publikum zu treten.
4Normen von Kultur und Gesellschaft
Antoine de Saint-Exupéry berichtet in seiner Geschichte vom Kleinen Prinzen über die Entdeckung des Planeten, von dem er stammt. Ein türkischer Astronom habe ihn als erster erspäht. Als dieser aber seine Entdeckung beim internationalen Astronomen-Kongress bekannt machte, habe ihm niemand geglaubt, „und zwar ganz einfach seines Anzuges wegen“.
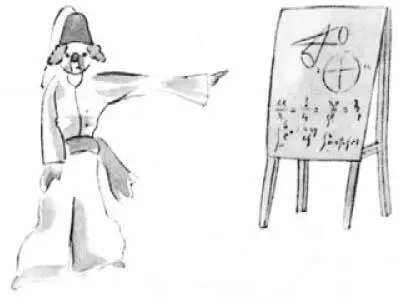
Abb. 4: Antoine de Saint-Exupéry: Der Astronom in traditioneller Kleidung.
Es dauerte elf Jahre, bis die wissenschaftliche Community den Mann ernst nahm. Dazwischen lagen die Gesellschaftsreformen unter Atatürk, und als der Astronom seinen Vortrag wiederholte, trug er einen Anzug nach westlicher Mode. „Und diesmal gaben sie ihm alle recht“ 25 , berichtet Saint-Exupéry.
Abb. 5: Antoine de Saint-Exupéry: Der Astronom elf Jahre später.
Die Geschichte erinnert daran, dass Verhaltensnormen sich von Kultur zu Kultur unterscheiden – und dass diese auch für Voraussetzungen des öffentlichen Redens, seiner Organisation und seiner Funktion gilt. Die Vertreter einer vermeintlich überlegenen Kultur verlangten die Unterwerfung unter ihre Normen, um den Redner überhaupt als solchen anzuerkennen.
Das Redeverhalten wird oft als Kriterium der Beurteilung der Persönlichkeitmissbraucht. Am 6. Dezember, abends, wenn es dunkel war, besuchte uns der Nikolaus. Er hatte einen Sack mit Nüssen, Äpfeln und Lebkuchen bei sich und war ein Vorbote der Bescherung zu Weihnachten. Nur stellte er uns Kinder auch vor eine Aufgabe, die nicht allen leichtfiel. Wir mussten in den Tagen zuvor ein kurzes Verslein auswendig lernen. Am Nikolausabend galt es dann, vor diesem Mann, den wir als ziemlich bedrohlich empfanden, und vor der ganzen versammelten Familie dieses Verslein vorzutragen.
Wer dies gut hinter sich brachte, wurde als „brav“ gelobt. Nun hat zwar brav zu sein, nichts mit der Fähigkeit zu tun, ein Gedicht auswendig zu sprechen. Aber es ist nicht ganz untypisch dafür, wie im Alltag mit Sprachnormen umgegangen wird. Eine persönliche Eigenschaft, die damit nichts zu tun hat, wird damit verknüpft, wie sich jemand sprachlich äußert. Uns wurde damals mit der Pflichtübung vor dem Nikolaus eingebläut, dass öffentliches Reden etwas Besonderes ist.
Was für den kleinen Jungen im Vorschulalter galt, gilt für ihn auch im späteren Leben. Eine rednerische Aufgabe ist zu lösen und das Resultat wird dazu genutzt, den Redner als Gesamtpaket zu beurteilen. Das Reden – die Sprachverwendung überhaupt – dient als Indiz für Charaktermerkmale und Fähigkeiten, die damit wenig zu tun haben. Die rednerische Brillanz oder das rednerische Ungeschick überdeckt alle anderen, wichtigeren Fähigkeiten.
Derartige Voraussetzungen lassen sich nicht durch einen einzigen Auftritt torpedieren. Das Spiel muss im Rahmen seiner Regeln gespielt werden. Aber es lässt sich sanft in einer Richtung korrigieren, die es sowohl dem Redner leichter macht als auch die Informationsvermittlung verbessert: in Richtung Dialog. Die Schwerpunkte im praktischen Teil dieses Buchs haben genau dies zum Ziel.
Dass gesprochene Spracheund Ritualeng zusammengehören, wird zu einem gewissen Grad immer so bleiben. Ohne den rituellen mündlichen Vortrag, der noch im Mittelalter weit wichtiger war als der Umgang mit der Schrift, wäre unsere Literatur arm dran. 26 Reden werden gehalten, um Jubilare zu ehren, um Begräbnissen einen würdigen Rahmen zu geben oder auch um an einem politischen Feiertag ein Zeichen zu setzen. Nicht was gesagt wird, sondern dass etwas gesagt wird, ist wichtig. Ohne gesprochene Formeln bei Gründungsakten, Taufen oder Ernennungen könnte die betreffende Handlung gar nicht durchgeführt werden. Einen negativen Einfluss auf den Umgang mit dem Reden hat erst der Umstand, dass in vielen Fällen Äußerlichkeiten, Form und Gehabe wichtiger genommen werden als der Inhalt. Und so lange es das Reden als Ritual gibt, wird man es auch mit Werten verknüpfen, die sich weitab vom Inhalt des Gesagten bewegen.
Dies ist in der öffentlichen Rede ständig präsent. Umso wichtiger ist es für den Einzelnen, sich vom sozialen Druck, der daraus entsteht, so weit wie möglich zu emanzipieren und nur diejenigen Rahmenbedingungen zu akzeptieren, ohne die man nicht auskommt. Es geht also darum, sich an die Erwartungen der Umgebung so weit anzupassen, dass die Verständigung nicht darunter leidet.
Dass der Versuch, den rhetorischen Machtverhältnissen eigene Werte entgegenzustellen, in der klassischen Rhetoriktradition aber bald auf Grenzen stößt, zeigt drastisch auch die Genderproblematik.
Das Reden in der Öffentlichkeit galt seit jeher generell als Männerdomäne. Die klassische Rhetorik demonstriert dies sehr gut, deren Vorannahmen und Regeln auf männliche Juristen, Politiker oder Kulturschaffende ausgerichtet waren. Die ideale Rednerpersönlichkeit war der vir bonus , der rechtschaffene Mann. Frauen, die sich in der Antike poetisch oder politisch im männlich definierten öffentlichen Raum äußerten, wurden von männlicher wie weiblicher Seite gleichermaßen kritisch beäugt und ihr Einfluss und Respekt wurden „in der Regel unterminiert.“ 27 Konrad Lienert, Verfasser einer „Einführung in die Redekunst“, die es vor gut hundert Jahren zu sieben Auflagen brachte, setzte dem Buch mit dem Titel Der moderne Redner noch ohne Bedenken die folgenden Zeilen voran:
»Das war ein Mann! Sein Schwert hat er geschwungen,
Das Schwert des Wortes, männlich, kühn und scharf,
Und Jauchzen schallte, wenn dies Schwert erklungen,
Wenn es zu Boden jeden Gegner warf.« 28
Da ist alles drin, was zur Verherrlichung der „Macht des Wortes“ gehört, 29 und nicht nur der Führer des Schwertes ist ein Mann, sondern auch das Schwert selbst, das jeden Gegner niederschlägt, ist männlich.
Nun hat sich zur Zeit des besagten türkischen Astronomen in Europa einiges getan. Die Frauenbewegung kämpfte für die Gleichberechtigung, Politikerinnen wie Rosa Luxemburg verschafften sich trotz Anfeindungen Gehör. Aber die Normen blieben männliche Normen. Auch die kriegerische Vorstellung, dass öffentliches Reden ein Kampfsei, in dem das stärkere Argument obsiegt, passt zu einer Welt, in der die Männer für Sieg und Niederlage zuständig sind, die Frauen dagegen für den Ausgleich und das Zusammenkehren der Scherben.
Es ist zwar ein Topos der praktischen Rhetorikliteratur, dass „Frauen den Beziehungsaspekt in ihrer Rede in den Vordergrund stellen und einen partnerschaftlichen, kooperativen und integrativen Redestil pflegen.“ Männer dagegen bevorzugen angeblich einen Stil der Auseinandersetzung und der Sachlichkeit. 30 Es existieren moderne Rhetorikratgeber für Frauen, die ein Redeverständnis vertreten, „das nicht auf der Unterscheidung von Sieg und Niederlage basiert, sondern das Raum für ein Nebeneinander von souveränen Subjekten lässt.“ 31 Doch dies hat bisher in der öffentlichen Rede weder zu einem erkennbaren weiblichen Stil noch zu einem Umdenken männlicher Redner geführt.
Читать дальше