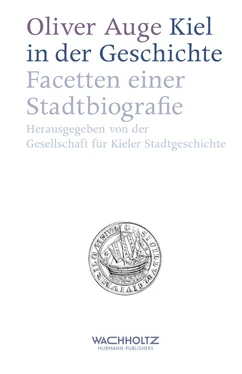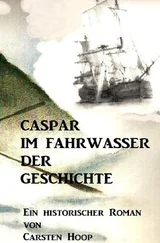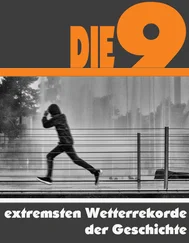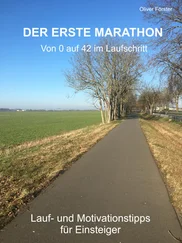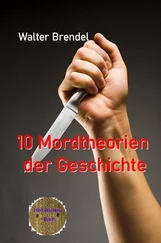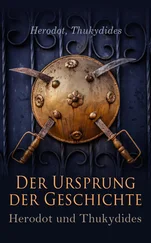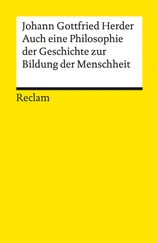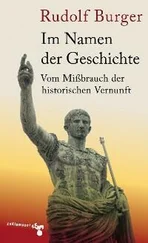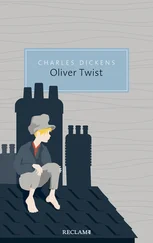Dies zeigte sich etwa bei einem Vorfall des Jahres 1386, als ein Lübecker Söldnerkontingent bei der Verfolgung holsteinischer Adeliger in einen Hinterhalt geriet. Die Kieler weigerten sich, das Holstentor zu öffnen, und so wurden die bedrohten Lübecker Söldner vor ihren Augen überwältigt und getötet. Lübeck beantragte daraufhin die erneute Verhansung Kiels. Das problematische Verhältnis kam auch im nur mäßigen Engagement der Stadt für hansische Aktivitäten zum Ausdruck: Zwar war Kiel auf den Hansetagen in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts regelmäßig vertreten. Aber es leistete mit lediglich drei Bewaffneten zwischen 1407 und 1475 jeweils den geringsten Beitrag zu den hansischen Bündnissen, Tohopesaten genannt. Gleichzeitig entwickelte sich die Stadt zu einer Art Piratennest, was den anderen Hansestädten verständlicherweise ein Dorn im Auge war. Auf dem Wismarer Tag von 1417 forderte Lübeck die Rückgabe von Beutegut, das die Piraten in Kiel umgeschlagen hatten. Das hinderte die Kaperfahrer jedoch nicht, weiterhin den Kieler Hafen anzusteuern. Dies erklärt auch, warum Lübeck ein starkes Interesse daran hatte, sich die Stadt Kiel 1472 als Pfand von Christian I. zu sichern. Man wollte das Piratennest endlich besser kontrollieren. Der erhoffte finanzielle Nutzen für Lübeck blieb aber aus. Zur wachsenden Entfremdung von der Hanse passte es, dass die Städte Holsteins ab 1496 nicht mehr der Rechtsprechung Lübecks unterlagen, den die einzelnen Stadtrechtsurkunden schriftlich fixiert hatten, und dass stattdessen ein holsteinisches Vierstädtegericht, bestehend aus den Vertretern Kiels, Itzehoes, Rendsburgs und Oldesloes, als neuer gerichtlicher Oberhof ins Leben gerufen wurde. Letztlich war dann das offizielle Ende von Kiels Hansemitgliedschaft wegen »Verwirkung und Ungehorsam« im Zeitraum vor 1518 nur der konsequente Schlusspunkt einer langen Entwicklung. Ein Anlauf zur Wiederaufnahme im Jahr 1554 wurde von Lübeck abgeblockt. Und Kiels schwieriges Verhältnis zur Hanse setzt sich bis in die Gegenwart fort! 2014 unterbreitete der Lübecker Oberbürgermeister Bernd Saxe (*1954) Kiel das Angebot zur Aufnahme in die »neue Hanse«, die 1980 im niederländischen Zwolle aus der Taufe gehoben worden ist und mittlerweile aus 185 Städten in 16 verschiedenen Ländern besteht. Kiel ist auf diese Offerte nicht eingegangen.
Die Stadt Kiel war nicht nur, aber auch von der Hanse geprägt. Größere Spuren als die Hanse aber hat der Adel in der Stadt hinterlassen. Bereits im 13. Jahrhundert finden sich Belege dafür, dass Adelige Stadtbewohner und Mitglieder des städtischen Rats waren, sodass die Vermutung naheliegt, dass sie sich auch aktiv in die Vorgänge rund um die Stadterhebung 1242 eingebracht haben. Im späteren Mittelalter, vor allem im 15. Jahrhundert, setzte sich der holsteinische Adel immer mehr in der Stadt fest. Die adeligen Familien waren hierzu vermehrt in der Lage, da sie sich im Zuge der landesherrlichen Expansionspolitik gegenüber Schleswig und Dänemark zum Unternehmeradel mit großem Sozialprestige wandelten. Nach dem für Kiel geltenden Lübischen Recht war dem Adel wie der Geistlichkeit zwar der Erwerb städtischen Grundbesitzes eigentlich verwehrt. Doch umging der Adel dieses Verbot geschickt, indem er sich Kieler Bürger als Treuhänder beim Grundstückskauf bediente. Kiel wurde so zu einer bevorzugten Adelsresidenz, einer wahrhaftigen »civitas Holsatorum«, und im Zuge der wachsenden Bedeutung des Kieler Umschlags zum Hauptfinanzort des Adels.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.