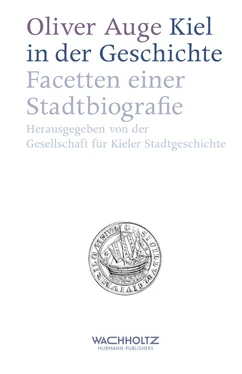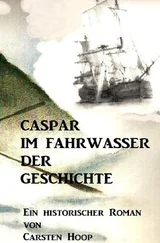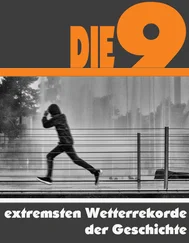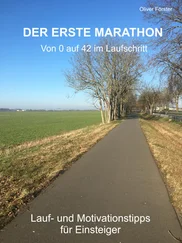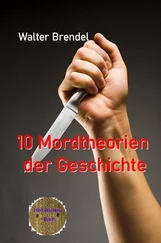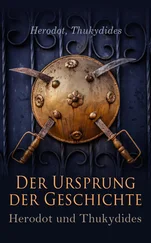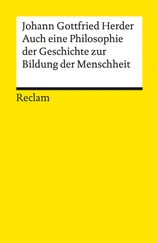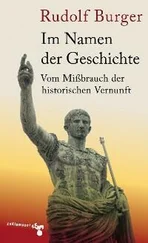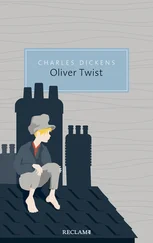Oliver Auge - Kiel in der Geschichte
Здесь есть возможность читать онлайн «Oliver Auge - Kiel in der Geschichte» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Kiel in der Geschichte
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Kiel in der Geschichte: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Kiel in der Geschichte»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Kiel in der Geschichte — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Kiel in der Geschichte», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Mit dem Ersten Weltkrieg kamen Jubel und Huldigungseifer der Kieler jedoch mehr und mehr zum Erliegen. Als schließlich während des Matrosenaufstands im November 1918 die roten Fahnen auf den kaiserlichen Schiffen gehisst wurden, ergriff den im Schloss befindlichen Prinzen die Panik und er floh mit seiner Familie im eigenen Auto auf sein Gut Hemmelmark bei Schleswig. Auf dem Weg dorthin kam es auf der 1894 fertiggestellten Levensauer Hochbrücke zu einem verhängnisvollen Schusswechsel: Ein Matrose wurde dabei getötet, Prinzessin Irene durch einen Streifschuss leicht verletzt.
Damit war die Zeit, in der Kiel Fürstenresidenz war, ein für alle Mal beendet. Nichts brachte dies sinnfälliger zum Ausdruck als der Einzug der städtischen Arbeitsnachweisstelle in das Erdgeschoss des Schlosses und die Nutzung der Pferdeställe und der Remise des Schlosses als Kartoffellager. 1928 wurde das Schloss immerhin Sitz der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek. Dahinter stand die Idee, das Schloss zu einem Kulturzentrum des Landes machen. Diese Konzeption wurde in der NS-Zeit weiterentwickelt und dann nach dem Zweiten Weltkrieg, in dem das Schloss 1944 größtenteils zerstört worden war, tatsächlich realisiert. In dem ab 1961 in der Architektursprache der Nachkriegszeit weitgehend neu errichteten und 1965 während der Festwoche zum 300-jährigen Gründungsjubiläum der Universität offiziell eingeweihten Schlossbau fanden Versammlungs- und Ausstellungsräume, das Landesamt für Denkmalpflege, die Landesbildstelle, die Schleswig-Holsteinische Landeshalle und weitere öffentliche Einrichtungen ihren Platz. Dem Konzept zufolge sollte aus dem Schloss, das über Jahrhunderte das Zuhause adeliger Stadt- und Landesherren gewesen war, ein Ort demokratischer Landeskultur werden. Das Konzept ging lange auf. Heute wird das Gebäude, das 2003 vom Land an Privathand verkauft wurde, vor allem für Konzerte, Messen und ähnliche öffentliche Veranstaltungen genutzt. Auch ein Restaurant befindet sich darin. Mittlerweile ist der vielgenutzte Konzertsaal freilich wiederum in die Jahre gekommen, und das ganze Gebäude müsste grundlegend renoviert werden. Dies nimmt die Stadt Kiel gegenwärtig zum Anlass, die Einbettung des Schlosses in seine Umgebung noch einmal zu über- und vielleicht neu zu denken. Das Land hat eine nennenswerte finanzielle Unterstützung in Aussicht gestellt.
Kiel war allerdings über lange Strecken seiner Geschichte nicht nur ein Fürstensitz-, sondern auch eine Hansestadt – übrigens neben Lübeck die einzige im Bereich des heutigen Schleswig-Holsteins. Diese scheinbar widersprüchliche Verbindung – scheinbar, weil die meisten Hansestädte wie Kiel niemals volle Autonomie und Souveränität erlangten, sondern immer auch landes- bzw. stadtherrliche Städte blieben –, bringt das mittelalterliche Stadtsiegel bestens zum Ausdruck. Umrahmt von der Umschrift »SIGILLUM : CIVIUM : KILENSIUM«, was »Siegel der Kieler Bürger« bedeutet, ist darauf ein Schiff in vollen Segeln auf hoher See zu sehen. Es handelt sich nicht um die Darstellung einer Kogge, sondern eines älteren Schiffstypus. Die Koggen waren freilich die Schiffe, mit denen die Hansekaufleute ihren gewinnbringenden Fernhandel übers Meer betrieben. Sie stehen sinnbildlich für die Hanse. Am Heck des Schiffes auf dem Siegel sitzt in zeittypischer Kleidung ein Steuermann mit zum Schwur erhobener Hand als Fingerzeig auf die eidlich zusammengefügte Fahrgemeinschaft der Kaufleute zur See. Am Schiffsbug ist hingegen das Nesselblatt als Wappen der Grafen von Holstein zu sehen, die, wie gesagt, die Stadtherren waren. Kiel gerät im Kontext der Hansegeschichte 1283 erstmalig in den Blick. In diesem Jahr nämlich erhielt die Stadt gemeinsam mit Hamburg vom dänischen König Erich V. Klipping (*um 1249; †1286) je eine Vitte, also einen Heringslandeplatz, in Falsterbo. Die Heringsmessen in Schonen nahmen innerhalb des Ostseehandels eine ganz herausragende Position ein und trugen nicht unwesentlich zum handelspolitischen Aufstieg Lübecks und der anderen wendischen Hansestädte bei. Kiel erhielt die Verbindung zu den Messen lange aufrecht, wie man weiß: Noch zum Ausgang des 15. Jahrhunderts lässt sich die Anlandung von Hering aus Schonen im Kieler Hafen nachweisen.
Schon im Jahr darauf, 1284 also, war Kiel dann Vertragspartner der Städte Lübeck, Hamburg, Wismar, Rostock, Stralsund, Greifswald, Demmin, Anklam und Stettin in einem Landfriedensbündnis zur Sicherung der Verkehrswege zu Wasser und zu Lande. Helmut G. Walther möchte Kiel deswegen von da an »mit gutem Grund« als Hansestadt bezeichnen, was er zusätzlich dadurch untermauert, dass Kiel 1295 an einer hansischen Entscheidung beteiligt war: Der Kieler Rat trug damals einen Beschluss mit, der Lübeck zur übergeordneten Rechtsinstanz für das hansische Handelskontor in Nowgorod machen wollte. Offenbar hatten also Kieler Kaufleute Handelsinteressen bis nach Russland hinein. Doch hat Thomas Hill jüngst einer solchen Charakterisierung Kiels als Hansestadt für das späte 13. Jahrhundert widersprochen. Erst ab 1356, als sich durch die feste Etablierung des Hansetages als politisches Forum der Hanse auch eine Städtehanse herauskristallisierte, könne man von einer Hansestadt Kiel sprechen.
Kiel hatte sich mit dem bereits beschriebenen, 1315 erfolgten dynastischen Umsturz im Hause der Schauenburger in bester Weise arrangiert. Es hatte von den gräflichen Profiteuren Gerhard III. und Johann III. die Zusicherung erhalten, den Kieler Stadtvogt künftig nur aus den Reihen der eigenen Bürger und im Einverständnis mit dem Rat zu wählen. Auch sollte das stadtherrliche Befestigungsrecht fortan allein auf das Areal der Burg beschränkt sein. Der abgesetzte Johann II. hatte sodann 1317 das Dorf Wik dem Kieler Heiliggeisthospital zum Geschenk gemacht und auch sein gräfliches Münzrecht an die Stadt abgetreten. Kiel nutzte seinerzeit geschickt jede Gelegenheit, die stadtherrlichen Rechte zu beschränken und sie sich selbst anzueignen. Augenscheinlich stand bei diesen Autonomiebestrebungen das Beispiel Lübecks Pate. Ein weiterer Erfolg in diese Richtung war 1334 die Ausdehnung des Kieler Hafenrechts bis Bülk, welche Herzog Waldemar von Schleswig als Mündel der beiden holsteinischen Grafen Gerhard III. und Johann III. gewährte. Von Johann und seinem künftigen Nachfolger Adolf VII. ließ Kiel sich zudem die Zusage geben, dass die Burg künftig nicht mehr ohne Zustimmung des Rats verpfändet würde. Zuvor hatte die Stadt die Burg auf ihre Kosten ausgelöst, nachdem der dauernd unter akuter Geldnot leidende Johann III. diese an den Ritter Nicolaus Split verpfändet hatte. Auch ihre Rechte an St. Nikolai traten die fürstlichen Stadtherren im 14. Jahrhundert im Übrigen ab, aber nicht an die Städter, sondern an die Augustinerchorherren, die ihren Sitz bis 1332 von Neumünster nach Bordesholm verlegt hatten. Wegen ihres Patronatsrechts durften sie die Pfarrstelle besetzen und über die Einkünfte der Kirche verfügen. Ihre Versuche, ihr Stift aus Bordesholm weiter nach Kiel zu verlegen, scheiterten indes am harten Widerstand der Kieler Bürger. Diese sperrten sich gegen einen solche kirchliche Machtposition innerhalb ihrer Mauern.
Auf dem Höhepunkt seiner städtischen Autonomie beteiligte sich Kiel am Krieg der Hansestädte, den diese ab 1361 gegen den dänischen König wegen der Eroberung Gotlands mit der Hauptstadt Visby führten. Dazu stellte die Stadt ein Schiff von 40 Lasten mit 40 Bewaffneten für die hansische Kriegsflotte und einen Beitrag von 42 Mark Pfundzoll für die Kriegskasse bereit. Vor Helsingborg ging das Schiff mit Besatzung und Ausrüstung aber verloren. Dies veranlasste die Kieler, von den anderen Städten eine Entschädigung für den herben Verlust zu verlangen, weswegen die beiden Bürgermeister Vater und Sohn Johann Visch zwischen 1363 und 1365 regelmäßig die Versammlungen der Städte in Stralsund, Rostock, Wismar, Lübeck und Greifswald aufsuchten. Trotz des wiederholten Drängens erhielt die Stadt wohl kaum einen vollständigen Ersatz. Kiel verhandelte dann zwar im hansischen Auftrag gemeinsam mit Hamburg mit den Grafen von Holstein, war bei den Friedensverhandlungen mit dem dänischen König zugegen und beteiligte sich am Friedensschluss mit demselben am 30. September 1365. Doch nach der Wiederaufnahme der Kampfhandlungen im Kontext der Kölner Konföderation von 1367 brachte Kiel sich nicht mehr aktiv ins Kriegsgeschehen ein. Die Enttäuschung über die mangelnde Entschädigung mag ein Motiv dafür gewesen sein, sich aus dem Krieg herauszuhalten, ein weiterer Grund sicherlich, dass Kiel selbst nur geringes eigenes Handelsinteresse am eigentlichen Kriegsgrund, den Schonenmessen, hatte. Nicht zuletzt aber war der Kieler Stadtherr Adolf VII. im Sommer 1367 in das gegnerische Lager übergewechselt, weswegen man in Kiel genau abwägen musste, ob man sich künftig für die Interessen der anderen Städte im Ostseehandel oder für die eigenen im Regionalbereich stark machen wollte. Schließlich hatte sich Kiel mittlerweile zu einem bedeutenden regionalen Zentralort im holsteinischen Herrschaftsgefüge entwickelt. Die eigenen Vorteile und das Bemühen um ein gutes Verhältnis zum Stadtherrn gaben letztlich den Ausschlag für die Stadt, sich nicht uneingeschränkt für die Hanse einzusetzen. Die 1370 nach dem Abschluss des für die Hansestädte günstigen Stralsunder Friedens erfolgende Verhansung Kiels mochte die Stadt in ihrer Haltung der Hanse gegenüber bestärken: Kiel wurde wegen der Prägung schlechter Münzen von der Nutzung der hansischen Privilegien ausgeschlossen. Obwohl Kiel dann bereits im Folgejahr wieder in die Hanse aufgenommen wurde, blieb sein Verhältnis zum Bündnis fortan problematisch.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Kiel in der Geschichte»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Kiel in der Geschichte» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Kiel in der Geschichte» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.