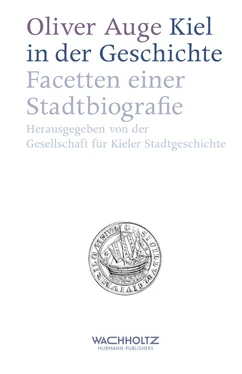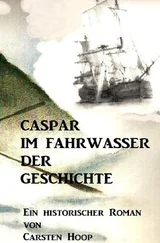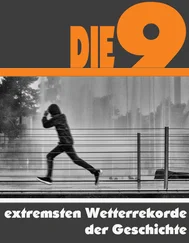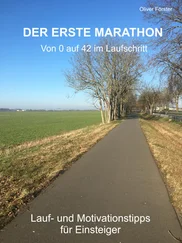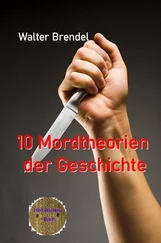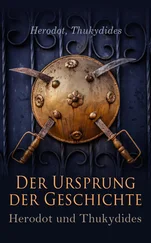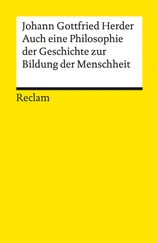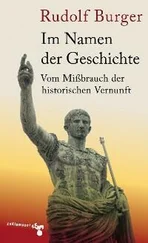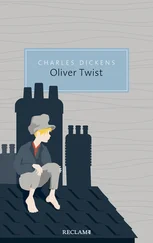Oliver Auge - Kiel in der Geschichte
Здесь есть возможность читать онлайн «Oliver Auge - Kiel in der Geschichte» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Kiel in der Geschichte
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Kiel in der Geschichte: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Kiel in der Geschichte»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Kiel in der Geschichte — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Kiel in der Geschichte», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Zwangsläufig spielte Kiel nach dem Nordischen Krieg im Restherzogtum Holstein-Gottorf zu Beginn des 18. Jahrhunderts die Rolle einer Hauptresidenz. Für Kiel war dies ein Glücksfall, denn dadurch wurde es rangmäßig aufgewertet und konnte es auf einen wirtschaftlichen Aufschwung hoffen: Ein fürstlicher Hof brachte im Regelfall den lokalen Konsum in Fahrt. Nicht zuletzt setzte man auf russisches Kapital, denn der Fürst und Stadtherr Carl Friedrich hatte sich am 20. Mai 1725 in St. Petersburg mit einer Tochter Zar Peters des Großen namens Anna Petrowna vermählt. Die Feier fand zwar nicht in Kiel statt, wurde jedoch auch hier groß gefeiert: In Abwesenheit des Brautpaares fand am 8. Juli 1725 eine Hochzeitszeremonie in der Nikolaikirche statt. Das Hochzeitspaar selbst blieb noch zwei weitere Jahre in St. Petersburg und kam erst am 26. August 1727 nach Kiel, nachdem Peter der Große gestorben und ein Aufenthalt am russischen Zarenhof für Carl Friedrich und Anna Petrowna daraufhin zu unsicher geworden war. Durch eine am Hafen errichtete, reich geschmückte Ehrenpforte mit den Initialen CFA wurden die Eheleute freudig von den Kielern empfangen. Unglücklicherweise waren die Lebensumstände in Kiel und seinem Schloss zu diesem Zeitpunkt offenkundig aber mehr als bescheiden und nicht gerade für eine Frau geeignet, die im dritten Monat schwanger und obendrein lungenkrank war. Der ohnehin schon angegriffene Gesundheitszustand von Anna Petrowna verschlechterte sich nach der Geburt des Sohnes und Thronfolgers Carl Peter Ulrich so rapide, dass sie keine drei Monate später, am 15. Mai 1728, starb. Aus diesem Anlass ließ ihr verwitweter Gemahl für die Dauer eines Jahres täglich drei Stunden lang alle Glocken in der Stadt läuten. Der kleine Sohn wuchs nun als Halbwaise in Kiel auf. Viel weiß man nicht über seine damaligen Lebensumstände, doch scheint er lebhafte Aufnahme in der städtischen Gesellschaft gefunden zu haben. So weiß man z. B., dass er 1732 – vierjährig – zum Schützenkönig der Brunswiker Schützengilde von 1638 erkoren wurde. Auch 1756/57 war er nochmals ihr König. Doch da lebte Carl Peter Ulrich schon lange gar nicht mehr in Kiel. Vielmehr hatte ihn seine kinderlose Tante, die russische Zarin Elisabeth, 1742 an ihren Hof nach St. Petersburg geholt, wo er fortan zu ihrem Thronfolger erzogen wurde. Tatsächlich sollte er den Zarenthron 1762 auch besteigen, diesen jedoch nur für ein knappes halbes Jahr innehaben.
Seine an seinem Sturz und Tod offenbar nicht ganz unschuldige Frau und Nachfolgerin, Katharina II. die Große, hinterließ in Kiel dann einige bauliche Spuren, auch wenn sie selbst rund 2000 Kilometer davon entfernt residierte. Sie beschloss bereits 1763 die Renovierung des inzwischen stark heruntergekommenen Kieler Schlosses und beauftragte zu diesem Zweck den für den Neubau der Hamburger Michaeliskirche oder Hamburger Michels verantwortlichen Architekten Ernst Georg Sonnin (*1713; †1794). Ein in die Schlossmauer eingelassener Gedenkstein erinnert heute noch daran. Bei dieser Baumaßnahme wurde der als mittlerweile altmodisch empfundene reiche Renaissanceschmuck am Schloss beseitigt. Auch einen Teil der Gewölbe entfernte man, darunter dasjenige in der Schlosskapelle, das von Granitsäulen getragen worden war. An ihre Stelle traten ganz im Stil der Zeit schlichte Fassaden und Stuckdecken. Derart baulich verändert bzw. modernisiert gab das Kieler Schloss dann am 16. November 1773 die passende Bühne für die offizielle Übergabe der Herrschaft über Holstein-Gottorf an den dänischen König ab. Dieser Tausch war im August 1773 zwischen Russland und Dänemark im Vertrag von Zarskoje Selo vereinbart worden. Von diesem Zeitpunkt an bis zum Ende des 19. Jahrhunderts war Kiel keine fürstliche Residenz. Das Kieler Schloss wurde als Sitz der gesamtstaatlichen Verwaltung genutzt. Zudem beherbergte es Räumlichkeiten der Universität; so fand hierin ab 1775 die Universitätsbibliothek ihre neue Heimstatt. Später, im 19. Jahrhundert, wurde die bedeutende Gipsabdrucksammlung der Universität im Schloss untergebracht. Auch sei nochmals daran erinnert, dass 1848 die konstituierende Landesversammlung hier tagte und späterhin, ab 1866/67, der Oberpräsident der preußischen Provinz Schleswig-Holstein seinen Sitz im Schloss nahm. 1838 hatte das Schloss dabei eine schwere Heimsuchung durch einen Brand erfahren. Das Feuer zerstörte weite Teile der Anlage, darunter die ehrwürdige Schlosskapelle.
Zum Ausgang des 19. Jahrhunderts wurde Kiel freilich erneut zum Fürstensitz und das Kieler Schloss zur herrschaftlichen Residenz. Ab 1888 nämlich diente das Schloss dem kaiserlichen Bruder Prinz Heinrich von Preußen und seiner Familie als ständiger Wohnsitz. Heinrich war bereits 1877 mit Kiel in Kontakt gekommen, als er als knapp 15-Jähriger in die Kaiserliche Marine eingetreten war. Seither wuchs der Hohenzollernspross in die Rolle einer preußischen Integrationsfigur für Kiel und Schleswig-Holstein hinein, was umso schwerer wog, als anfänglich die preußische Herrschaft über Schleswig-Holstein von der Mehrheit seiner Einwohner abgelehnt wurde. Diese integrative Rolle bringt ein monumentales Historiengemälde des Künstlers Carl Saltzmann (*1847; †1923) von 1886 mit dem Titel »Zurück im Heimathafen«, das für den Neubau der Marineakademie in Kiel im Jahr 1888 bestimmt war, bestens zum Ausdruck. Auf seiner rund neun Meter breiten Bildfläche zeigt es nämlich Heinrichs umjubelte Rückkehr von einer anderthalbjährigen Auslandsfahrt auf der Glattdeckskorvette namens »Olga« am 13. März 1884 nach Kiel. Im Hintergrund ist selbstverständlich das Kieler Schloss zu sehen.
Ab 1888 musste Heinrich jedoch seinen Ruf als überregional bekannte Propagandafigur für die Marine an seinen älteren Bruder, Kaiser Wilhelm II., abtreten. Denn dieser war von der Seefahrt so begeistert, dass er selbst diese Rolle zu übernehmen wünschte. In Kiel aber gründete Heinrich mit seiner Frau Irene von Hessen (*1866; †1953), die er am 24. Mai 1888 geheiratet hatte, eine eigene Hofhaltung. Im Jahr davor war die Schlossanlage durch Hofbaurat Albert Geyer (*1846; †1938) eigens dafür umgebaut worden. Heinrich hatte zwar bereits seit 1879 über eine Wohnung im Schloss verfügt, nachdem der Oberpräsident nach Schleswig versetzt worden war, doch nun entstand eine repräsentative Residenz für den Kaiserbruder und seine Familie. Diese wurde auch mit Wohn- und Schlafräumlichkeiten ausgestattet, in denen die kaiserlichen Majestäten untergebracht werden konnten, die Kiel des Öfteren besuchten. Das Herzstück des Schlosses bildete seinerzeit der sogenannte Wappensaal: eine neugotische Halle, die ganz im historistischen Stil der Zeit eingerichtet war. In den folgenden Jahren entfaltete sich ein stattliches höfisches Leben in Kiel mit zahlreichen Repräsentationsterminen, vor allem während der Kieler Woche und der Festballsaison im Winterhalbjahr. Diesem Hof stand Freiherr Albert von Seckendorff (*1849; †1921), der sich bereits seit 1877 an Prinz Heinrichs Seite befand, als Hofmarschall vor. Natürlich aber hatte auch der Kaiserhof in Berlin stets ein achtsames Auge darauf, dass in Kiel alles mit rechten Dingen zuging. Selbst die Annahme von Geschenken wurde von Berlin aus genau kontrolliert.
Die Stadt Kiel zeigte jedenfalls über alle Bevölkerungsgruppen hinweg eine anhaltend große Begeisterung für das hier residierende Prinzenpaar, das als Stellvertreter des Kaiserhauses wahrgenommen wurde. Die Begeisterung legt nahe, dass die Anwesenheit des preußischen Prinzen dazu beitrug, dass die Bevölkerung die preußische Herrschaft über die Stadt und das Land mehr und mehr akzeptierte und sich mit dieser gar identifizierte. Der Kilia-Brunnen mit seiner allegorischen Frauengestalt, den die Stadt dem Ehepaar zur Hochzeit schenkte und der auf Prinz Heinrichs Wunsch im Innenhof des Schlosses aufgestellt wurde, war das steingewordene Symbol für diese Treue der Stadt zum Kaiserhaus. Zur positiven Grundeinstellung trug sicher auch bei, dass der Hof von Prinz Heinrich einen nicht unbedeutenden Wirtschaftsfaktor in der Stadt darstellte. So ließ sich allein der Kieler Marstall durch 30 feste Lieferanten und Handwerker, unter anderem Schmiede, Sattler oder Futterlieferanten, versorgen. Neben der hohen Nachfrage, die durch den Hof selbst entstand, war es gut für das Geschäft, sich »Hoflieferant« nennen zu können, z. B. für die Wäschefabrik Meislahn, die Bett- und Tischwäsche an den Hof lieferte. Obwohl es gar nicht so viele offizielle Berührungspunkte zwischen dem Hof und der Stadt gab – diese beschränkten sich auf Ereignisse wie die Einweihung der örtlichen Kirchen, wie beispielsweise die der Ansgarkirche im Jahr 1903 oder der St. Jürgenkirche 1904, bei denen Prinz Heinrich anwesend war –, nahm die Stadt stets einen regen Anteil am Hofgeschehen. Trotzdem lässt sich dieses aus heutiger Sicht nur schwer rekonstruieren. Das liegt nicht zuletzt daran, dass Prinz Heinrich ganz anders als sein kaiserlicher Bruder, der sich zum ersten modernen Medienstar entwickelte, kamerascheu war. Unter Paul Fuß (*1844; †1915), seit 1888 Bürgermeister bzw. seit 1890 Oberbürgermeister Kiels, organisierte die Stadt immer wieder Huldigungen für den Prinzen in Form von Aufmärschen oder Umzügen. Dies geschah etwa aus Anlass von Heinrichs Ostasienreise, deren Beginn im Dezember 1897 ebenso aufwändig gefeiert wurde wie deren Ende im Jahr 1900. Der Festumzug bei Heinrichs Rückkehr nach Kiel zählte ganze 8000 Personen. Zudem veranstaltete die Stadt einen Fackelzug anlässlich der Silberhochzeit des Prinzenpaares im Jahr 1913. Die Stadtwerke scheuten keine Kosten und sorgten durch modernste Beleuchtungstechnik für eine glanzvolle Illumination der ganzen Stadt. Die hierfür nötigen Gasbrausen waren eigens aus Berlin besorgt worden. Es verwundert angesichts dessen wenig, dass Prinz Heinrich als ein Aushängeschild der Stadt schon 1911 im Zusammenhang mit der damaligen Rathauseinweihung zum Kieler Ehrenbürger gemacht und dass die im Jahr darauf fertiggestellte Holtenauer Hochbrücke nach ihm benannt wurde. Neben Kircheneinweihungen besuchte der Prinz auch die Einweihungsfeiern von Schulen und übernahm ferner den Vorsitz örtlicher Vereine. Zu nennen ist z. B. der Golfklub Kitzeberg. Im Yacht-Club war er lange Jahre als Vizekommodore aktiv. Dessen Mitglieder trugen ihre eigene Kluft, zu der nicht von ungefähr die bekannte Prinz-Heinrich-Mütze gehörte. Einen Namen machte sich Prinz Heinrich ebenfalls dadurch, dass er das Seemannsheim in der Flämischen Straße im Jahr 1895 initiierte und dass er einer der ersten Autofahrer Kiels war. Ähnlich technikbegeistert wie sein älterer Bruder übernahm er auch die Schirmherrschaft der Internationalen Motorbootausstellung, die im Jahr 1907 in Kiel stattfand. Nicht unerwähnt bleiben darf, dass er natürlich auch den Segelsport und die Regatten bei der Kieler Woche rege förderte.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Kiel in der Geschichte»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Kiel in der Geschichte» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Kiel in der Geschichte» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.