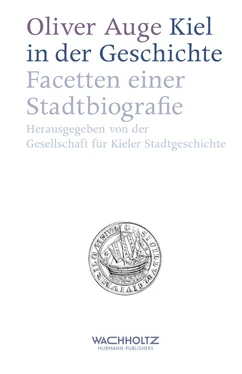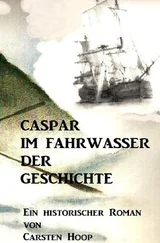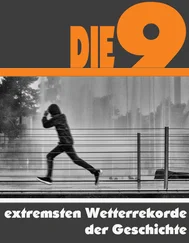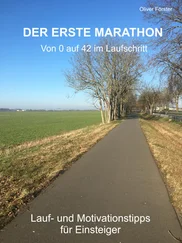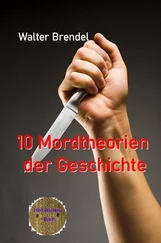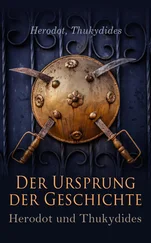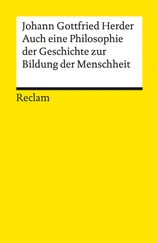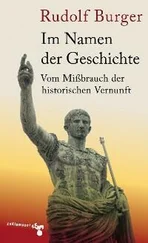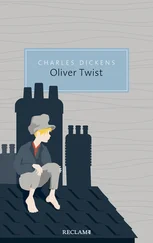Oliver Auge - Kiel in der Geschichte
Здесь есть возможность читать онлайн «Oliver Auge - Kiel in der Geschichte» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Kiel in der Geschichte
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Kiel in der Geschichte: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Kiel in der Geschichte»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Kiel in der Geschichte — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Kiel in der Geschichte», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Da so viele alte Baulichkeiten nicht mehr zu retten waren, konnte man das Kieler Stadtbild großzügig und modern umplanen. Dazu gehörte, dass man Mitte der 1950er Jahre die Holstenstraße zur ersten Fußgängerzone in Deutschland überhaupt umgestaltete oder dass man den 1944 stark zerstörten Hauptbahnhof bis Anfang der 1950er Jahre ohne seine bisherigen Kuppeln oder den Treppenturm mit Kaiserkrone wieder benutzbar machte. Erst durch einen umfassenden Umbau zwischen 1999 und 2004 wurde die alte Raumhöhe der Eingangshalle wiederhergestellt, ebenso die ehemalige Kaisertreppe an der Ostseite. Auch die schwer beschädigte St. Jürgenkirche wurde komplett abgerissen und durch einen Neubau im Königsweg ersetzt, der am 12. Dezember 1954 eingeweiht wurde. Allein bis 1948 wurden 20 000 Quadratmeter Straßen erneuert und auch neue Straßen gebaut. So wurde im Mai 1950 die Neue Straße, die heutige Andreas-Gayk-Straße, als eine Magistrale der Moderne dem Straßenverkehr übergeben, die schnurgerade durch ein vor dem Krieg dicht bebautes Stadtgelände geführt worden war.
Im Rückgriff auch auf Planungen der 1930er und 1940er Jahre nutzte Kiel den baulichen Neuanfang nach dem Zweiten Weltkrieg für eine Gestaltung des Stadtinneren, die in der Fachwelt für Aufsehen sorgte. Mustergültig führt dies heute noch, trotz der Veränderungen nach 1989, die Holtenauer Straße in ihrem unteren Verlauf bis zum Dreiecksplatz vor Augen, wo ab 1949 durch die Architekten Kurt Malzahn und Roland Lukas fünfgeschossige Flachdachwohnblocks mit zur Straße hin vorgeschobener Ladenzeile errichtet wurden. Der Komplex erhielt im Volksmund den Namen »Klagemauer« – vielleicht weil viele Ladengeschäfte über die hohen Mieten klagten oder an den hier zuvor vorhandenen Ruinen Vermisstenlisten angebracht gewesen waren. Insgesamt stand hinter der teils radikalen Um- und Neugestaltung der Innenstadt und ihrer durchweg verkehrsgünstigen Erschließung die Idee, dass sie nicht länger als vorwiegendes Wohnviertel dienen, sondern sich vor allem zum Geschäftsviertel entwickeln sollte. Das viele Lob für die richtungsweisende moderne Konzeption darf indes nicht darüber wegtäuschen, dass es durchaus auch etliche Gegenstimmen gab, die ihren Unmut über den vielen Beton äußerten, mit dem das neue Kiel errichtet wurde
Vater des »Kunstwerks Kiel« bzw. Schöpfer der städtischen Neuplanung ganz im Sinne zeitgenössischer Vorstellungen von einer aufgelockerten und durchgrünten Stadt wurde der Stadtbaurat Herbert Jensen (*1900; †1968), der dafür zahlreiche Ehrungen erhielt. Unter anderem wurde er 1954 zum Vizepräsidenten der Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung gewählt und ein Jahr später zum Kieler Honorarprofessor ernannt.
3.Kiel als Fürstensitz, Hansestadt und Adelszentrum
Im Laufe seiner langen, mehr als 775-jährigen Geschichte hatte Kiel viele verschiedene Funktionen zu erfüllen. Den Status der fürstlichen Residenz hatte die Stadt bis zum Ende der Monarchie in Preußen und Deutschland im November 1918 inne, den einer Hansestadt hingegen nur bis ca. 1518. Über wirklich lange Zeit, beginnend im späteren Mittelalter bis ins 18. Jahrhundert hinein, fungierte Kiel daneben als eine Art Hauptstadt und Zentrum des holsteinischen Adels bzw. der schleswig-holsteinischen Ritterschaft. Diese drei genannten Aspekte geben jeder für sich ein beredtes Zeugnis von der Vielseitigkeit der Geschichte Kiels und zeigen daher, zusammengenommen, eindrucksvoll, wie unterschiedlich die Faktoren waren, die Kiels Geschichte beeinflusst haben, und gleichzeitig, wie eng diese miteinander verzahnt waren.
Von Beginn an spielte der Status der fürstlichen Residenz eine prägende Rolle für die Stadt Kiel. Als Kiel 1242 sein Stadtrecht verliehen bekam, war die Stadt nämlich als Hauptstadt oder Vorort Holsteins konzipiert. Dahinter stand vermutlich die Intention, Kiel zum zentralen Punkt für wirtschaftliches und politisches Geschehen zu machen. Nahe legen tut dies die Stiftung des Franziskanerklosters als einer monastischen Mustereinrichtung mit der Funktion einer dynastischen Grablege, die nahezu zeitgleich wie die Stadtgründung stattfand. Adolf IV., der das Kloster gestiftet hatte und ihm als Mönch beigetreten war, und sein ebenfalls zum Mönch gewordener Sohn Ludolf fanden im Kloster ihre letzte Ruhestätte. Kurze Zeit später gab es dann sogar für ein paar Generationen eine eigene Kieler Linie der Schauenburger Grafendynastie: Unter Adolfs IV. Söhnen Johann I. (*um 1229; †1263) und Gerhard I. (*1232; †1290) erfolgte 1273 eine Teilung des Landes, bei der sich ein Zweig der großen Schauenburger Familie abspaltete und Quartier in Kiel bezog. In der nachfolgenden Generation spaltete sich diese Linie nochmals auf, in eine nur kurz bestehende Segeberger und eine etwas länger existierende Kieler Linie. Letztere verbindet sich mit Johann II. (*ca. 1253; †1321) und seinen beiden Söhnen Christoph (†um 1313/15) und Adolf (†1315).
Die Schicksale dieser drei könnten gut und gern Stoff für ein Shakespeare-Drama liefern. Bei Johann II. handelte es sich offenbar um eine überaus traurige Herrschergestalt, war er doch auf einem Auge erblindet, weil sein Hofnarr in Wut einen Knochen auf den Kämmerer geworfen, versehentlich damit aber den Grafen getroffen hatte. Das berichtet zumindest der Lübecker Chronist Detmar (*um/nach 1395). Johanns Sohn Christoph, der in Kiel residierte, fand bei einem Sturz aus einem Fenster seiner Burg den Tod – unter ungeklärten Umständen. Schon seine Zeitgenossen spekulierten, ob da nicht doch jemand nachgeholfen hatte. Der zweite Sohn Adolf hingegen wurde im Schlafgemach seiner Segeberger Burg, schlafend im Bett neben seiner Gemahlin, von seinen Vasallen unter Führung Hartwich Reventlows (†1380) erschlagen. Dieser sagte später, er habe Rache üben wollen, weil er Adolf verdächtigt hatte, sich an seiner, Reventlows, Tochter vergangen zu haben. Allerdings wurden gleichzeitig die Burgen Bramhorst und Grömitz von den gräflichen Vettern Gerhard III. von Rendsburg (*1293; †1340) und Johann III. von Plön (*ca. 1297; †1359) besetzt und obendrein Johann II. gefangen genommen. Es lag daher sogar schon dem Verfasser der Lübecker Annalen die Vermutung nahe, dass »es geplant gewesen sei«. Handelte es sich um ein Komplott gegen die Vertreter der Kieler Linie, an dem die Verwandten beteiligt waren? Dieser Verdacht wird noch erhärtet durch den »Persilschein«, den der dänische König Erich VI. Menved (*1274; †1319) den beiden Schauenburgern am 4. August 1316 deswegen explizit ausstellte. Ein halbes Jahr zuvor hatten beide die Kieler Grafschaft untereinander aufgeteilt, wobei der Segeberger Teil an Gerhard III., der Kieler an Johann III. gefallen war. Johann II. indes, der als Gefangener in die Kieler Burg geführt worden war, konnte aber von dort fliehen und begab sich zum Markgrafen von Brandenburg, der seinerseits wiederum mit dem dänischen König verfeindet war. Als beide Kontrahenten, der dänische König und der Markgraf von Brandenburg, 1317 den Frieden von Templin miteinander schlossen, wurde die besagte Teilung der Kieler »Beute« zwar bestätigt, doch immerhin wurde Johann II. die Nutznießung der Einkünfte von Kiel und Umland als Versorgung bis zu seinem Lebensende zugesprochen. 1318 kehrte er daher nach Kiel zurück und verbrachte hier seinen Lebensabend, bis er 1321 verstarb. Erst mit seinem Tod endete die Funktion Kiels als einer gräflichen Hauptresidenz, und die Stadt fiel endgültig an seinen Vetter Johann III.
Seither fungierte die Kieler Burg lediglich als Nebenresidenz bzw. als Witwensitz, so z. B. für Anna von Mecklenburg-Schwerin (*1343; †1415), die Gemahlin von Johanns III. Sohn Adolf VII. (*um 1327; †1390), oder für Sophia von Pommern (*1498; †1568), zweite Ehefrau Herzog Friedrichs I. (*1471; †1533). Bereits um 1500 war zu diesem Zweck die mittelalterliche Burg zum großen Teil abgerissen und durch einen repräsentativen Renaissanceneubau, das sogenannte Neue Haus, mit einer Fürsten- und Jungfrauenstube, einem großen Treppenturm und einem Tanzsaal ersetzt worden. Zwischen 1558 und 1568 fügte Friedrichs Sohn Adolf I. (*1526; †1586) diesem Ensemble einen stattlichen Erweiterungsbau ebenfalls im Stil der Renaissance hinzu, der eigentlich aus vier parallelen Giebelhäusern mit zwei Treppentürmen zur Landseite und zwei Erkertürmchen zur Förde hin bestand und mit einem reichen Giebelschmuck ausgestattet war. Dieses Schloss bildete dann die erhabene Bühne für die pompöse Gründungsfeier der Kieler Universität Anfang Oktober 1665. Der Friedrichsbau wich nach seinem teilweisen Einsturz 1685 einem nüchternen Neubau aus zwei rechtwinklig aneinanderstoßenden Flügeln, für dessen Entwurf der Schweizer Festungsbaumeister Dominicus Pelli (*1657; †1728) verantwortlich zeichnete. Der bis heute erhaltene Westflügel erhielt später fälschlicherweise den Namen »Rantzaubau«. Die innere Ausstattung des Neubaus, der nunmehr der wohlhabenden Herzoginwitwe Friederike Amalie als Wohnsitz diente, war den zeitgenössischen Berichten zufolge ungemein prächtig.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Kiel in der Geschichte»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Kiel in der Geschichte» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Kiel in der Geschichte» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.